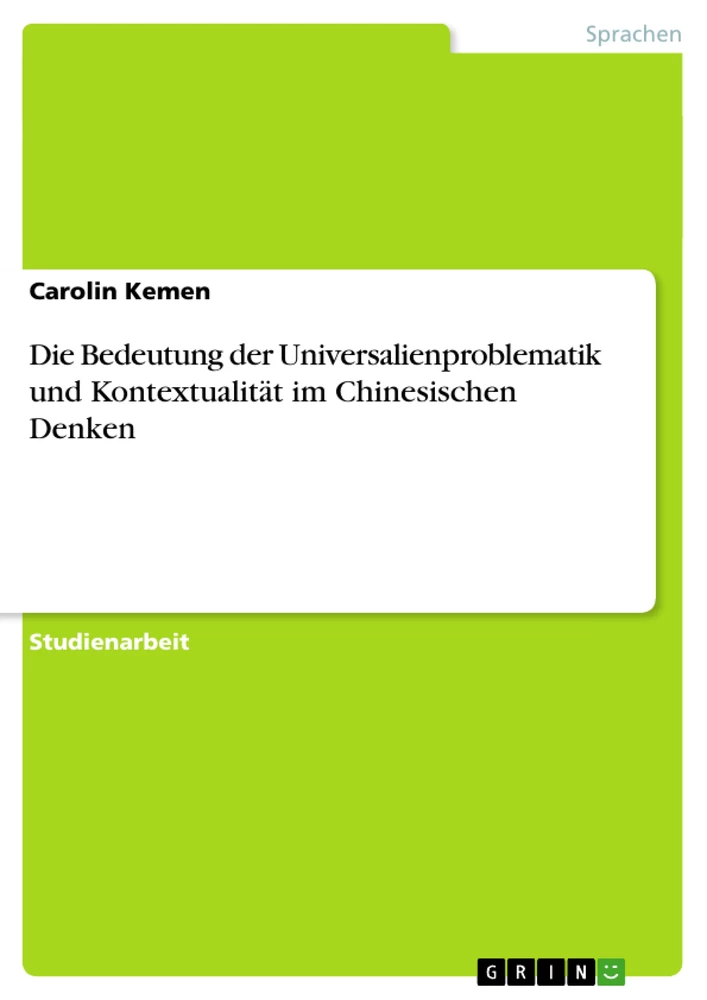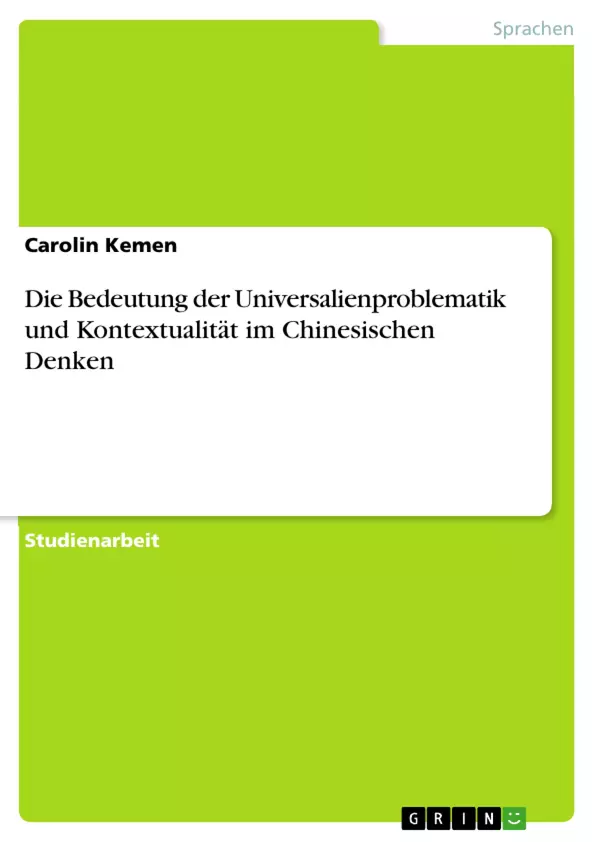Denken die Chinesen anders? Diese Frage beschäftigt seit jeher westliche Sinologen, Philosophen und andere Wissenschaftler, die versuchen zwischen Europäischem und Chinesischem Denken einen Vergleich zu ziehen. Das Bild der Europäer von China ist ambivalent und stark geprägt zwischen einer Mischung aus Bewunderung und Ablehnung. Herrschte im europäischen Barockzeitalter noch weitgehend Bewunderung für die Chinesische Kultur und regelrechte „Chinahysterie“, was den Erwerb von Luxusprodukten wie Seide und Porzellan anging, so machte man sich gleichzeitig bis in die 70er Jahre auf Grund der geographischen Entfernung und der fast durchgehenden politischen Abgeschlossenheit des Landes ein relativ unrealistisches Bild von einem, Europa in vieler Hinsicht unterlegenen, China. Die Chinesische Gesellschaft wurde vor allem im Bezug zur Europäischen Gesellschaft der Neuzeit als das „zivilisatorische Gegenmodell schlechthin“ dargestellt (Osterhammel, 1989: 3). Auf Grund ihrer sprachlichen und kulturellen Andersartigkeit wurde sie von den Europäern als sehr fremd und teilweise auch sehr unterentwickelt eingestuft, vor allem was den technischen und naturwissenschaftlichen Fortschritt angeht. So war China „manchmal Vorbild, manchmal Zerrbild, immer jedoch Gegenbild Europas“(Osterhammel, 1989: 3).
Was von der westlichen Welt lange als diametrale Gegensätzlichkeit empfunden wurde, ist jedoch im Grunde nichts anderes als eine Form der kulturell bedingten Andersartigkeit, in deren Rahmen Situationen, mit denen sich auch Europa konfrontiert sah, mit unterschiedlichen Reaktionen begegnet wurden und für die gleichen Probleme, mit denen sich auch die westliche Welt auseinandersetzen musste, unterschiedliche Lösungen entwickelt wurden. So existierte in China, schon lange bevor sich in Europa der „naturwissenschaftliche“ Ansatz herauskristallisierte, traditionelle Konzepte von Medizin und Heilung, die in ihrer Wirksamkeit den westlichen Methoden um nichts nachstehen, sich aber beispielsweise in ihrer Terminologie und Auffassung der Beziehung zwischen Körper, Gesundheit und Krankheit grundlegend voneinander unterscheiden. Die Gründe hierfür sind vor allem in den historischen Hintergründen der westlichen und östlichen Kultur- und Geistesgeschichte zu suchen, im Zuge derer jeweils unterschiedliche Denkmuster und Auffassungen entstanden, die prägend für die Entwicklung Chinas und der westlichen Welt waren.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Westliches und Östliches Weltdenken
- 1.1. Ursprünge der Wissenschaften
- 1.2. Grundlagen der Chinesischen Philosophie
- 2. Die Kontextualität der Chinesischen Sprache
- 2.1. Phonetik und Phonologie
- 2.2. Grammatik
- 2.3. Sprachliche Tradition und Zukunft
- 3. Die Universalienproblematik
- 3.1. Erste Kontakte der Chinesen mit Westlichem Gedankengut
- 3.2. Die Handhabung westlicher Universalien in der Chinesischen Sprache
- 3.3. Zentrale Begriffe der Chinesischen Philosophie
- 3.4. Fazit
- 4. Schlussbemerkung
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern sich das chinesische Denken vom westlichen Denken unterscheidet. Sie untersucht die Universalienproblematik und die Kontextualität der chinesischen Sprache, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Denksystemen aufzuzeigen.
- Die Ursprünge und Entwicklung des westlichen und östlichen Denkens
- Die Bedeutung der Kontextualität der chinesischen Sprache
- Die Frage nach der Universalität von Begriffen und Konzepten
- Die Auswirkungen des westlichen Denkens auf die chinesische Kultur
- Die Rolle der Philosophie in der Gestaltung von Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die historische Entwicklung des westlichen Bildes von China. Sie zeigt, dass die Unterschiede zwischen den beiden Kulturen nicht als diametrale Gegensätze, sondern als kulturell bedingte Andersartigkeit betrachtet werden sollten.
Kapitel 1 befasst sich mit den Ursprüngen des westlichen Denkens, insbesondere mit der Philosophie des antiken Griechenlands und der Bedeutung des Primats der Theorie. Es werden die Lehren von Parmenides und Heraklit sowie die platonische Ideenlehre vorgestellt.
Kapitel 2 untersucht die Kontextualität der chinesischen Sprache und zeigt, wie die Sprache das Denken und die Wahrnehmung der Welt beeinflusst. Es werden die phonetischen, grammatischen und kulturellen Besonderheiten der chinesischen Sprache beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der Universalienproblematik und der Frage, ob zentrale Begriffe, die im Westen als Universalien gelten, im chinesischen Bewusstsein einen ähnlichen Stellenwert haben. Es werden die ersten Kontakte der Chinesen mit westlichem Gedankengut sowie die Handhabung westlicher Universalien in der chinesischen Sprache untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Universalienproblematik, die Kontextualität der chinesischen Sprache, das westliche und östliche Weltdenken, die chinesische Philosophie, die Geschichte der Philosophie, die Kulturgeschichte, die Sprachphilosophie und die interkulturelle Kommunikation.
- Quote paper
- Carolin Kemen (Author), 2005, Die Bedeutung der Universalienproblematik und Kontextualität im Chinesischen Denken, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/180806