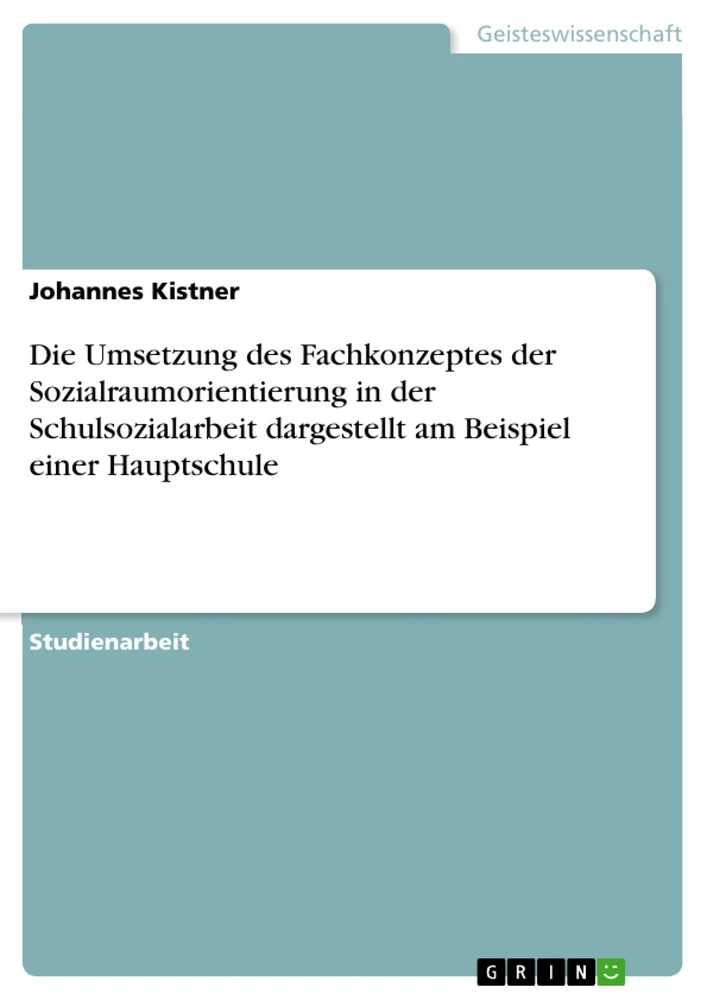Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Übertragbarkeit der fünf Prinzipien der Sozialraumorientierung (SRO), die ich im Rahmen meines Projektstudiums beim Institut für Sozialraumorientierung, Soziale Arbeit und Beratung (IS-SAB) kennengelernt habe, auf die Schulsozialarbeit.
Zu Beginn werden sowohl die generellen Entwicklungen als auch die Handlungsleitlinien für die Schulsozialarbeit auf dem Hintergrund verschiedener Veröffentlichungen offengelegt und zusammengetragen.
Im Folgenden werde ich das Fachkonzept der SRO darstellen.
Darauf aufbauend werden meine praktischen Erfahrungen aus dem Projektstudium geschildert und ausgewertet.
Das abschließende Fazit führt die Einzelbestandteile der Hausarbeit dann thematisch verbindend und auswertend zusammen.
Der Hintergrund der Hausarbeit ist, dass ich im Rahmen des Theorie-Praxis-Projektes des ISSAB in Essen im Stadtteil Altendorf an einer Hauptschule unter der Anleitung des dortigen Schulsozialarbeiters gearbeitet habe. Im Zeitraum vom 1.4.2010 bis zum 30.3.2011 habe ich eigenständig eine Fußballgruppe für Schüler der 6. Klasse, bzw. in meinem 2. Projektsemester der 7. Klasse, geplant, initiiert und geleitet.
Zudem habe ich ein erlebnispädagogisches Gruppenangebot des Schulsozialarbeiters begleitend geleitet, welches ausschließlich für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit vor kurzem erfolgter Migration angelegt war.
Diese Hausarbeit soll sich auf die von mir allein geführte Fußballgruppe für Jungen beziehen. Hier konnte ich meine Handlungsprinzipien, meine Haltung und meine Arbeit, die geprägt war durch das Fachkonzept der SRO - ohne den Schulsozialarbeiter - umsetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulsozialarbeit
- Aufgabe von Schulsozialarbeit
- Sozialarbeit in der Schule
- Sozialpädagogik in der Schule
- Sozialpädagogische Schule
- Lebensweltorientierung & aktueller Stand der Schulsozialarbeit
- Fazit Schulsozialarbeit + Ausblick
- Fachkonzept Sozialraumorientierung
- Orientierung an den geäußerten Interessen und am Willen
- Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe(kräften)
- Konzentration und Nutzung der Ressourcen
- a) der Menschen
- b) des Sozialraums
- Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise
- Kooperation und Koordination (der sozialen Dienste)
- Persönliche Erfahrungen & Arbeit anhand der Prinzipien des Ansatzes der Sozialraumorientierung im Praxisfeld
- Auswertung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Übertragbarkeit der fünf Prinzipien der Sozialraumorientierung (SRO) auf die Schulsozialarbeit. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung und Analyse dieser Prinzipien, sowie deren praktische Anwendung in der Schulsozialarbeit am Beispiel einer Hauptschule.
- Darstellung der generellen Entwicklungen und Handlungsleitlinien der Schulsozialarbeit
- Detaillierte Analyse des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung
- Beschreibung der persönlichen Erfahrungen des Autors in der Praxis der Schulsozialarbeit
- Auswertung der Erfahrungen im Hinblick auf die Anwendung der SRO-Prinzipien
- Verknüpfung der Einzelbestandteile der Hausarbeit zu einem zusammenhängenden Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Hausarbeit vor und erläutert den Hintergrund des Projekts. Sie gibt zudem eine Übersicht über die Struktur der Hausarbeit und die Methodik der Untersuchung.
- Schulsozialarbeit: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen Ansätze und Definitionen von Schulsozialarbeit. Es werden die drei vorherrschenden Grundkonzepte (Sozialarbeit in der Schule, Sozialpädagogik in der Schule, Sozialpädagogische Schule) vorgestellt und deren Stärken und Schwächen beleuchtet.
- Fachkonzept Sozialraumorientierung: In diesem Kapitel werden die fünf Prinzipien der Sozialraumorientierung (SRO) detailliert erläutert. Es geht um die Orientierung an den Interessen und dem Willen der Menschen, die Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe, die Konzentration auf Ressourcen, die zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise und die Kooperation und Koordination sozialer Dienste.
- Persönliche Erfahrungen & Arbeit anhand der Prinzipien des Ansatzes der Sozialraumorientierung im Praxisfeld: Dieses Kapitel beschreibt die persönlichen Erfahrungen des Autors im Rahmen seines Projektstudiums an einer Hauptschule in Essen. Er erläutert seine Arbeit mit einer Fußballgruppe für Schüler der 6. und 7. Klasse und wie er dabei die Prinzipien der Sozialraumorientierung umsetzen konnte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schulsozialarbeit, Sozialraumorientierung, Lebensweltorientierung, Eigeninitiative, Ressourcen, Kooperation, Koordination, Praxis, Hauptschule, Fußballgruppe. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die Prinzipien der Sozialraumorientierung in der Praxis der Schulsozialarbeit angewendet werden können, um die Lebenswelt und die Bedürfnisse der Schüler zu berücksichtigen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
- Quote paper
- Johannes Kistner (Author), 2011, Die Umsetzung des Fachkonzeptes der Sozialraumorientierung in der Schulsozialarbeit dargestellt am Beispiel einer Hauptschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/180323