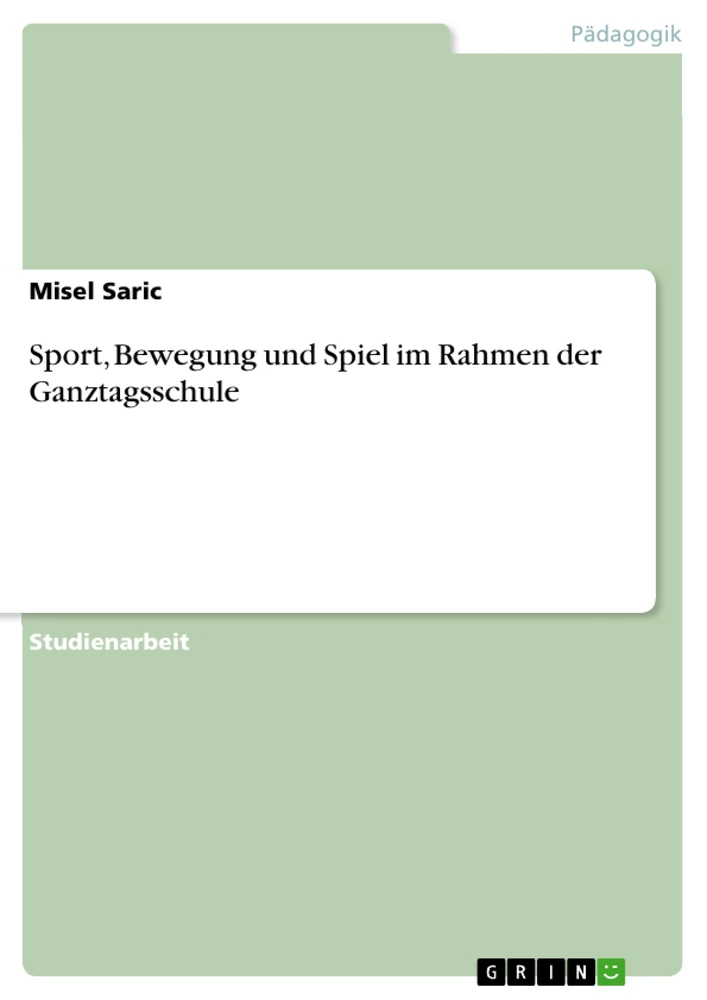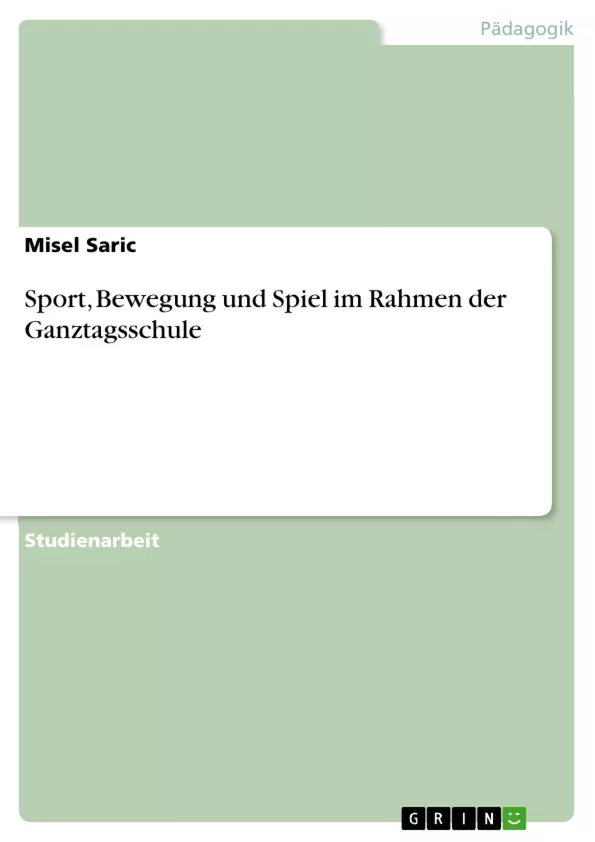Inhaltsverzeichnis
1. Prolog
2. Die Ganztagsschule
2.1 Historische Betrachtungsweise
2.1.1 Entwicklung der Schulformen
2.1.2. Entwicklung seit Gründung der BRD
2.2 Verschiedene Formen der Ganztagsschule
2.2.1 Die offene Ganztagsschule
2.2.2 Die voll gebundene Ganztagsschule
2.2.3 Die teilweise gebundene Ganztagsschule
2.3 Gründe für die Einführung der ganztägigen Konzeption
2.3.1 Pädagogische Begründungen im Sinne der Schulreform
2.3.2 Sozialpolitische Argumentationen zur Ganztagesschule
2.4 Kritische Betrachtung
3. Ganztagsschule in Baden-Württemberg
4. Ganztagsschule in Frankreich
4.1 Aufbau des Schulsystems
4.2 Schultag
4.3 Probleme
5. Stellenwert von Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule
5.1 Argumente für einen hohen Stellenwert von Bewegung, Spiel und Sport in
der Ganztagsschule
5.1.1 Entwicklungs- und lerntheoretische Begründung
5.1.2 Medizinisch- gesundheitswissenschaftliche Begründung
5.2 Bildungsplanbezüge
6. Bewegungsgestaltung in der Ganztagsschule
6.1 Kooperation Schule und Verein
6.1.2 Ziele der Zusammenarbeit
6.1.3 Allgemeine Ziele
6.1.4 Ziele und Motive der Schule zur Zusammenarbeit
6.1.5 Ziele und Motive des Vereins zur Zusammenarbeit
6.2 Schülermentorenausbildung in Baden-Württemberg
6.2.2 Schülermentorin/-mentor Sport an Gymnasium und Realschule
6.2.3 Schülermentorin/-mentor Sport an der Hauptschule
6.2.4 Ziele der Ausbildung
6.3 Jugendbegleiter Programm
6.3.1 Ziele des Programms
7. Legitmation des Sports als Unterrichtsfach
8. Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Die Ganztagsschule
- Historische Betrachtungsweise
- Entwicklung der Schulformen
- Entwicklung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland
- Verschiedene Formen der Ganztagsschule
- Die offene Ganztagsschule
- Die voll gebundene Ganztagsschule
- Die Teilweise Gebundene Ganztagsschule
- Gründe für die Umsetzung der ganztägigen Konzeption
- Pädagogische Begründungen
- Sozialpolitische Argumentationen zur Ganztagesschule
- Kritische Betrachtung
- Historische Betrachtungsweise
- Ganztagsschule in Baden-Württemberg
- Ganztagesschule in Frankreich
- Aufbau des Schulsystems
- Schultag
- Probleme
- Stellenwert von Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule
- Argumente für einen hohen Stellenwert von Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule
- Entwicklungs- und lerntheoretische Begründung
- Medizinisch- gesundheitswissenschaftliche Begründung
- Bildungsplanbezüge
- Argumente für einen hohen Stellenwert von Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule
- Bewegungsgestaltung in der Ganztagsschule
- Kooperation Schule und Verein (Landeskooperationsprogramm Baden-Württemberg)
- Ziele der Zusammenarbeit
- Allgemeine Ziele
- Ziele und Motive der Schule zur Zusammenarbeit
- Ziele und Motive des Vereins zur Zusammenarbeit
- Schülermentorenausbildung in Baden-Württemberg
- Schülermentorin/-mentor Sport an Gymnasium und Realschule
- Schülermentorin/-mentor Sport an der Hauptschule
- Ziele der Ausbildung
- Jugendbegleiter-Programm
- Ziele des Programms
- Kooperation Schule und Verein (Landeskooperationsprogramm Baden-Württemberg)
- Legitimation des Sports als Unterrichtsfach
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Sport, Bewegung und Spiel im Rahmen der Ganztagsschule. Sie untersucht die historische Entwicklung der Ganztagsschule, verschiedene Formen der Ganztagsschule sowie die Gründe für deren Umsetzung. Die Arbeit beleuchtet auch den Stellenwert von Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule und analysiert die Argumente für einen hohen Stellenwert. Zudem werden die Möglichkeiten zur Bewegungsgestaltung in der Ganztagsschule, insbesondere die Kooperation Schule und Verein, die Schülermentorenausbildung und das Jugendbegleiter-Programm, dargestellt. Die Arbeit befasst sich auch mit der Legitimation des Sports als Unterrichtsfach.
- Die historische Entwicklung der Ganztagsschule
- Verschiedene Formen der Ganztagsschule und deren Vor- und Nachteile
- Die Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Die Rolle des Sports in der Ganztagsschule
- Möglichkeiten zur Bewegungsgestaltung in der Ganztagsschule
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prolog thematisiert die aktuelle Debatte um die Zukunft des Schulsports in Deutschland. Die Ganztagsschule wird als Chance für den Sport präsentiert, da sie mehr Zeit für Bewegung, Spiel und Sport bietet. In Kapitel 2 wird die historische Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland beleuchtet. Die verschiedenen Formen der Ganztagsschule werden vorgestellt und die Gründe für deren Umsetzung erläutert. In Kapitel 3 wird die Ganztagsschule in Baden-Württemberg näher beleuchtet, während Kapitel 4 einen Blick auf die Ganztagesschule in Frankreich wirft. Kapitel 5 befasst sich mit dem Stellenwert von Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule und argumentiert für deren Bedeutung. Kapitel 6 beleuchtet die Bewegungsgestaltung in der Ganztagsschule und fokussiert auf die Kooperation Schule und Verein, die Schülermentorenausbildung und das Jugendbegleiter-Programm. Kapitel 7 widmet sich der Legitimation des Sports als Unterrichtsfach.
Schlüsselwörter
Ganztagsschule, Sport, Bewegung, Spiel, Schulsport, Bildungsplan, Kooperation Schule und Verein, Schülermentorenausbildung, Jugendbegleiter-Programm, Entwicklung, Lernen, Gesundheit, Sozialisation.
- Quote paper
- Misel Saric (Author), 2009, Sport, Bewegung und Spiel im Rahmen der Ganztagsschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/180181