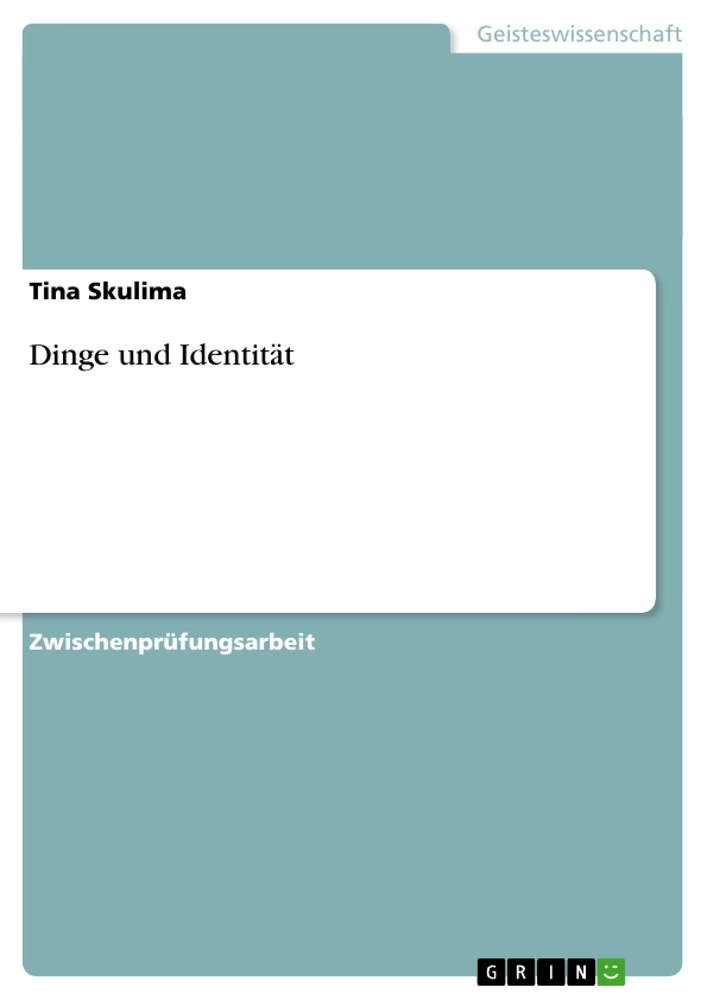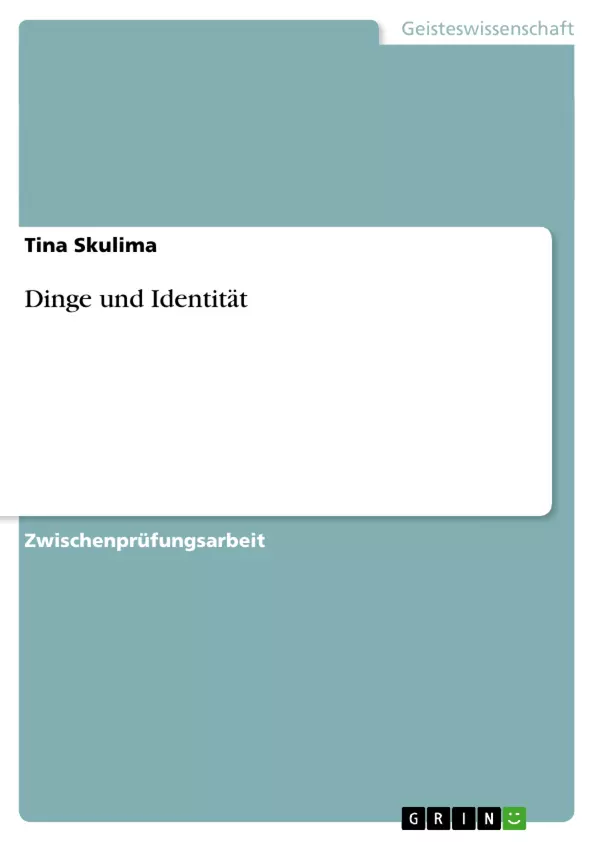Kugelschreiber, Foto, Kuscheltuch – scheinbar profane Gegenstände
sind ein sehr handfestes Untersuchungsobjekt innerhalb des weiten
Feldes der Psychologie. Ihre Bedeutung darf für den Menschen und
seine Entwicklung in onto- wie phylogenetischer Hinsicht und der
seiner Identität nicht unterschätzt werden.
Wie Alfred Lang in einer Rezension von Ernst E. Boeschs „Das Magische
und das Schöne: zur Symbolik von Objekten und Handlungen“
(1983) schreibt, nehmen wir die Dinge um uns herum „gewöhnlich
für Gegebenes, zu bestimmtem Tun instrumentell Verfügbares;
natürlich sind sie das auch, aber näheres Hinsehen lehrt, dass nicht
nur sie, die Objekte, ihre Bedeutungen aus unserem Umgang mit
ihnen beziehen, sondern dass auch wir, die Subjekte uns erst durch
sie erfahren, vielleicht konstituieren.“
Einstieg in diese Thematik bot mir ein Referat zum umfangreichen
Werk über einen bis dato relativ unerforschten Bereich der Psychologie:
„Der Sinn der Dinge“ von Mihalyi Csikszentmihalyi und Eugene
Rochberg-Halton erforscht die häusliche Umwelt der Menschen unserer
Zeit, ihre Beziehungen zu Alltagsgegenständen – und was sich
aus der Auswahl bestimmter „Lieblingsobjekte“ über Mensch und
soziale Bindungen sagen lässt.
Ausgangspunkt für den „Sinn der Dinge“ bildet eine empirische Studie,
eine Befragung repräsentativ ausgewählter amerikanischer Familien
zu bevorzugten Objekten in ihrem Zuhause. Es wird beleuchtet,
inwiefern nicht nur der Mensch die Objekte in seiner Umgebung
aktiv aussucht und „benutzt“, sondern überraschenderweise auch,
wie sehr diese Objekte „aktiv“ an der Ausbildung der jeweiligen eigenen
Persönlichkeit beteiligt sind. Ich orientiere mich im Folgenden an der Struktur der Arbeit von
Csikszentmihalyi und Rochberg-Halton, zur Vertiefung der Thematik
und zu einer Erweiterung um Aspekte der neueren Vergangenheit
dienen weitere Veröffentlichungen zu diesem Sachverhalt und wissenschaftlichen
Hintergründen sowie diverse Quellen aus dem Internet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschen und Dinge
- Aufmerksamkeit und soziale Systeme
- Die Repräsentationsebenen
- Wahrnehmen und Wiedererkennen
- Die sozialisierende Wirkung von Dingen
- Die Bedeutung der Dinge
- Symbole
- Transitorische Objekte
- Ausdrucksmittel
- Statussymbole
- Symbole sozialer Integration
- Totemismus
- Animismus
- Tauschhandel
- Die beliebtesten Objekte im Wohnbereich
- Die Studie
- Die Ergebnisse
- Erkenntnisse der empirischen Untersuchung
- Objektbeziehungen und Persönlichkeitsentwicklung
- Altersspezifität der Objektbeziehungen
- Geschlechtsspezifität
- Das Heim als symbolische Umwelt
- Merkmale harmonischer Heime
- Teilnahme am öffentlichen Leben
- Wahl von Rollenmodellen
- Persönlichkeitstypen
- Transaktionen zwischen Menschen und Dingen
- Geschichtlicher und gesellschaftlicher Kontext der Kultivation
- Materialismus
- Medien als Dinge des täglichen Gebrauchs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Dingen für die menschliche Entwicklung und Identität. Sie untersucht, wie Objekte im täglichen Leben unsere Aufmerksamkeit lenken, soziale Systeme beeinflussen und unsere Wahrnehmung und Wiedererkennung prägen. Der Text beleuchtet außerdem, wie Gegenstände unsere Persönlichkeit formen und uns in soziale Zusammenhänge einbinden.
- Die Rolle von Dingen in der menschlichen Entwicklung und Identität
- Der Einfluss von Objekten auf soziale Systeme und die Wahrnehmung
- Die Bedeutung von Dingen als Symbole, Ausdrucksmittel und Statussymbole
- Die Beziehung zwischen Objekten und der Persönlichkeitsentwicklung
- Das Heim als symbolische Umwelt und die Transaktionen zwischen Mensch und Ding
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Relevanz von Alltagsgegenständen für die Psychologie. Sie stellt die Arbeit von Mihalyi Csikszentmihalyi und Eugene Rochberg-Halton vor, die sich mit den Beziehungen von Menschen zu ihren Lieblingsobjekten im häuslichen Umfeld auseinandersetzt. Kapitel 1 analysiert die Auswirkungen von Dingen auf die menschliche Wahrnehmung und die Entwicklung sozialer Systeme. Es untersucht die Repräsentationsebenen und die sozialisierende Wirkung von Dingen. Kapitel 2 erörtert die vielfältigen Bedeutungen von Dingen, von Symbolen über transitorische Objekte bis hin zu Statussymbolen und Totems. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Studie über die beliebtesten Objekte im Wohnbereich. Kapitel 4 beleuchtet die Beziehung zwischen Objektbeziehungen und der Persönlichkeitsentwicklung, unter Berücksichtigung von Altersspezifität und Geschlechtsspezifität. Kapitel 5 behandelt das Heim als symbolische Umwelt und beschreibt Merkmale harmonischer Heime, die Teilnahme am öffentlichen Leben und die Wahl von Rollenmodellen. Kapitel 6 untersucht die Transaktionen zwischen Menschen und Dingen, insbesondere im Kontext von Materialismus und Medien.
Schlüsselwörter
Dinge, Identität, Objektbeziehungen, Psychologie, soziale Systeme, Wahrnehmung, Symbole, Statussymbole, Persönlichkeitsentwicklung, Heim, Materialismus, Medien, Empirische Studie
- Quote paper
- Tina Skulima (Author), 2003, Dinge und Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/17934