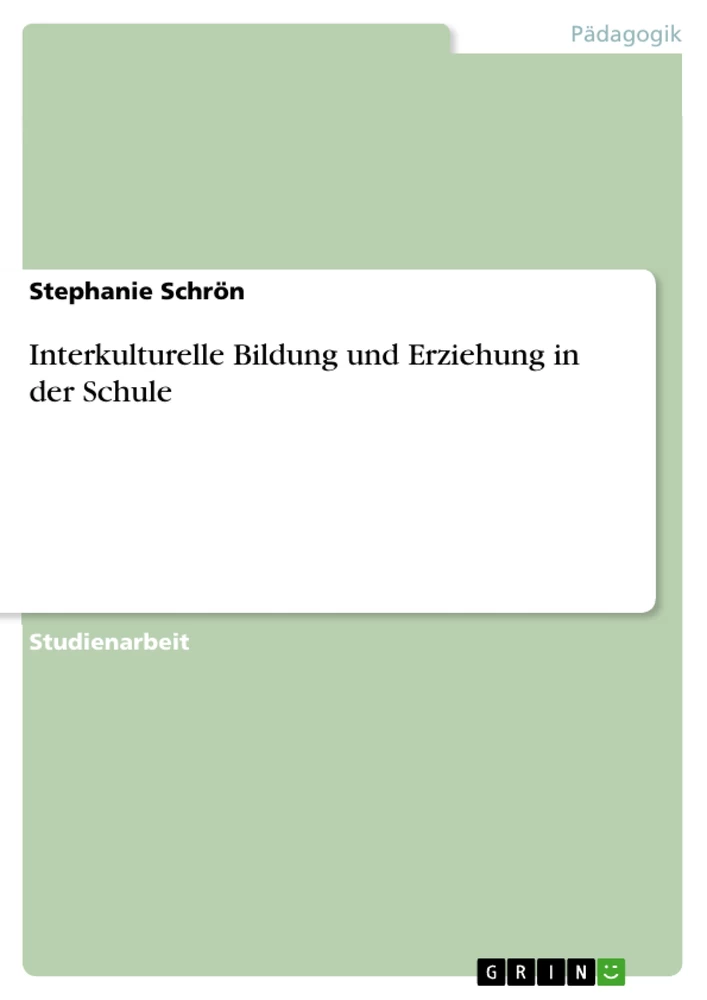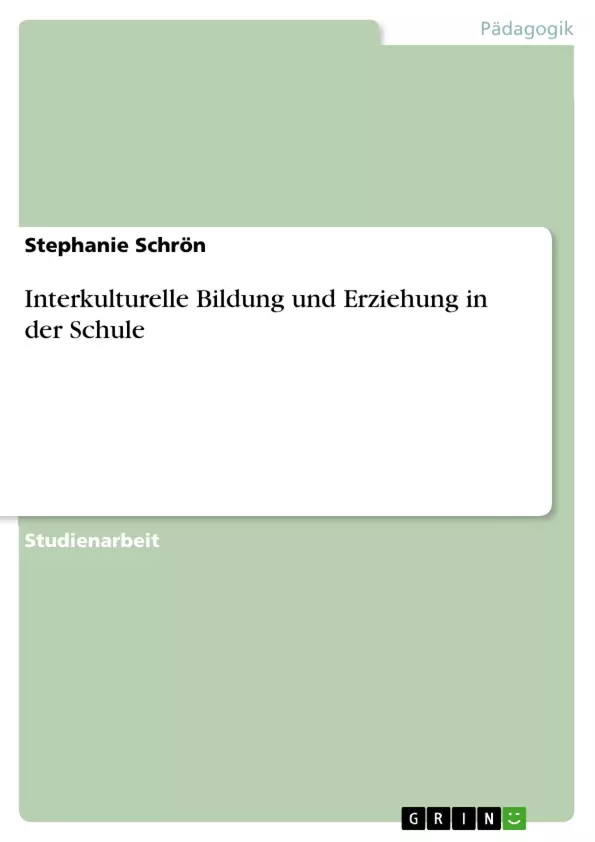In der Mitte der 50er Jahre begann die Zuwanderung durch Arbeitsmigranten in Deutschland. Seitdem sind Jahr für Jahr mehr Migranten unterschiedlichster Herkunft zugezogen; mit der Entscheidung auf Dauer zu bleiben. Doch diese Tatsache sollte sich als nicht ganz einfach zu lösende Aufgabe darstellen. Aufgrund der unterschiedlichen Sprache, der Herkunft und auch der Weltanschauung wurden Verunsicherungen ausgelöst. [...] Hierbei kommt der Schule als Erziehungs- und Sozialisationsinstanz eine besondere Rolle zu. Sie ist ein Ort, an dem sich die Pluralität der Einwanderungsgesellschaften in besonderer Form widerspiegelt. „Als wichtige Sozialisationsinstitutionen wirken Schulen bei der Vermittlung von Normen und Werten mit, die eine Basis für den sozialen Zusammenhalt bilden.“ [...] Die Aufgabe der interkulturellen Bildung besteht darin, Kinder und Jugendliche auf ein Leben in einer multikulturellen Gesellschaft vorzubereiten. Zudem müssen Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile gegenüber Migranten abgebaut werden. Die Integration von Migranten stellt also eine große Herausforderung dar, sowohl für die Migranten selbst, als auch für die einheimische Bevölkerung.
Zu Beginn der Arbeit soll ein Überblick über die Heterogenität in Deutschland und Migration gegeben werden. Bevor ich verschiedene Typologien der Migration vorstelle, gebe ich eine Definition von „Migration“. Den nächsten Teil werde ich mit einer Definition von „Interkultureller Bildung“ beginnen, um im Anschluss auf die sechs Ansätze der Pluralität einzugehen. Abschließen möchte ich dieses Kapitel mit dem Entwurf einer Bildung zum Pluralismus.
Im letzten Teil schreibe ich über die Kultusministerkonferenz und deren Empfehlung zur Interkulturellen Bildung und Erziehung. Hier werden die Ziele erläutert und deren Umsetzung, sowie die inhaltlichen Schwerpunkte im Unterricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftliche Heterogenität in Deutschland
- Migration in Deutschland
- Typologien der Migration
- Chancen
- Die interkulturelle Idee in der Bildung
- Definition „Interkulturelle Bildung"
- Sechs Ansätze der Pluralität
- Entwurf einer Bildung zum Pluralismus
- Die Kultusministerkonferenz
- Einführung
- Ziele
- Umsetzung und inhaltliche Schwerpunkte im Unterricht
- Umsetzung in den Bundesländern
- Schlussbetrachtung
- Quellen & Literatur
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der interkulturellen Bildung und Erziehung in der Schule und untersucht die Herausforderungen, die die zunehmende gesellschaftliche Heterogenität durch Migration mit sich bringt. Das Ziel der Arbeit ist es, das Konzept der interkulturellen Bildung zu erläutern und dessen Relevanz für die Schule aufzuzeigen.
- Migration als gesellschaftliche Herausforderung
- Die Bedeutung von interkultureller Bildung
- Vielfalt als Chance für die Schule
- Die Rolle der Kultusministerkonferenz
- Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der interkulturellen Bildung und Erziehung ein und erläutert die Bedeutung der Schule als Ort der Begegnung und des Lernens in einer multikulturellen Gesellschaft. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Heterogenität in Deutschland und beleuchtet die Entwicklung der Migration sowie die verschiedenen Typologien der Migration. Im zweiten Kapitel wird das Konzept der interkulturellen Bildung definiert und die sechs Ansätze der Pluralität vorgestellt. Der Entwurf einer Bildung zum Pluralismus wird im Anschluss erläutert und die vier Bereiche einer pluralistisch allgemeinen Bildung aufgezeigt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Interkulturellen Bildung und Erziehung in der Schule. Die Ziele der Empfehlung werden erläutert und die Umsetzung sowie die inhaltlichen Schwerpunkte im Unterricht dargestellt. Das Kapitel beleuchtet auch die Umsetzung der Empfehlung in den Bundesländern und zeigt die unterschiedlichen Ansätze in den Schulgesetzen auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Interkulturelle Bildung und Erziehung, die gesellschaftliche Heterogenität, Migration, die Kultusministerkonferenz, die Förderung von Vielfalt und Toleranz in der Schule sowie die Entwicklung von interkultureller Kompetenz.
- Quote paper
- Stephanie Schrön (Author), 2007, Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177980