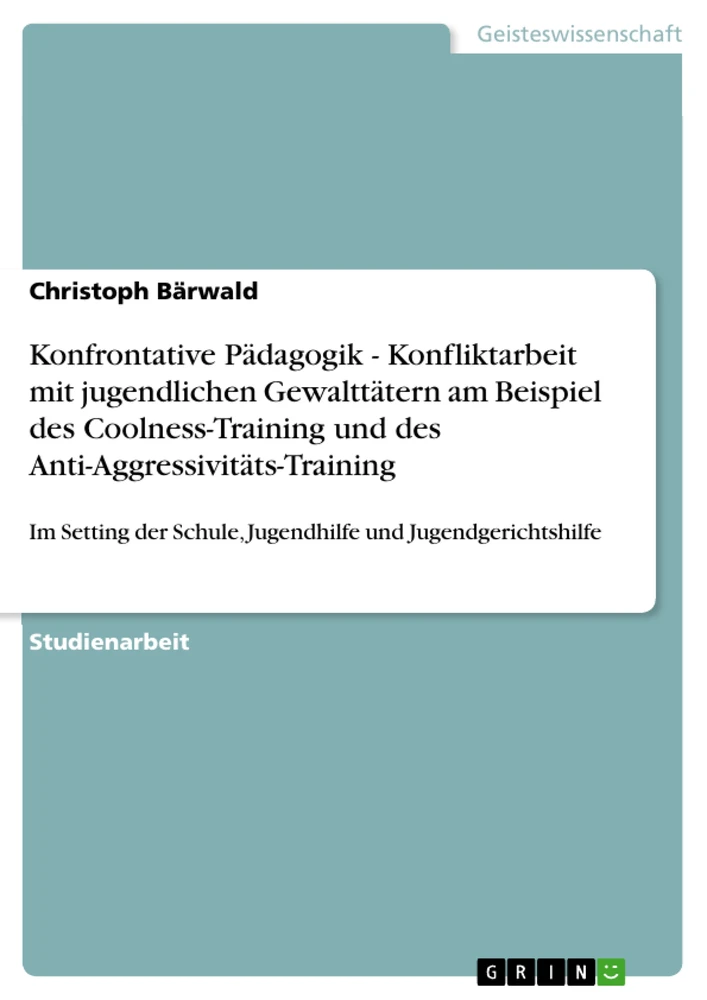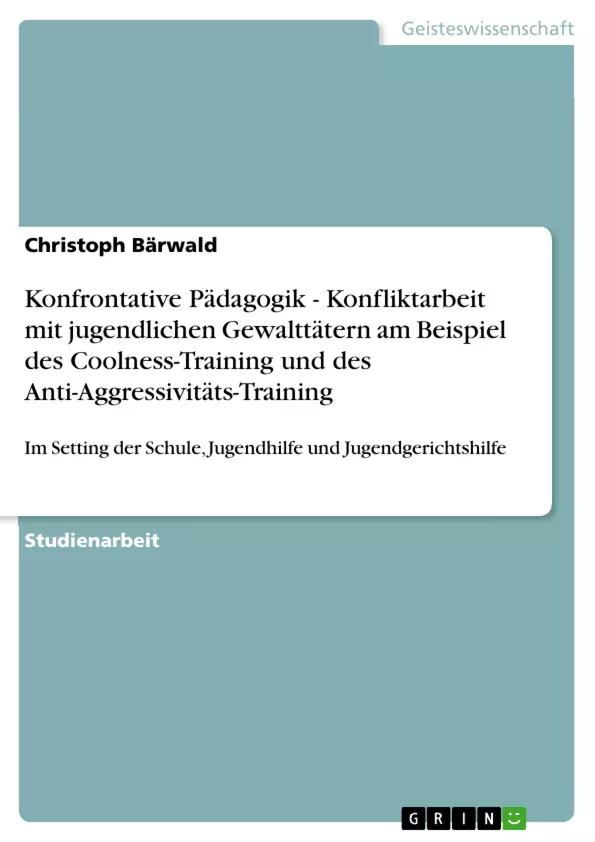Inhaltsverzeichnis II
1 Einleitung 1
2 Definition / Begriffserklärung „konfrontative Pädagogik“ 2
3 Coolness-Training 4
3.1 Konzept 4
3.2 Methoden 6
3.3 Ziele 8
4 Anti-Aggressivitäts-Training 9
4.1 Konzept 9
4.2 Methoden 10
4.3 Ziele 11
5 Forschungsergebnisse vs. Kritik 12
6 Kampfsport - Eine präventive Alternative 14
7 Fazit 15
Quellenverzeichnis IV
1 Einleitung
Laut einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Hannover, in der 2007 und 2008 rund 45.000 Schüler der neunten Klasse in 61 repräsentativen Städten und Landkreisen befragt wurden, wurde deutlich, dass jeder siebte Jugendliche starke „ausländerfeindliche“ Einstellungen hegt. 4,9 Prozent der befragten Jungen gehören einer rechtsextremen Gruppe an. Bei Mädchen betrifft es nur die Hälfte. Fast jeder sechste Befragte war in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Opfer einer Gewalttat, jeder Zwanzigste Opfer eines Raubes oder einer Erpressung und jeder dreißigste Jugendliche Opfer einer schweren Körperverletzung. Umgekehrt gaben zwischen 11,5 und 18,1 Prozent der Jugendlichen an, in den letzten zwölf Monaten selbst straftätig geworden zu sein. Trotz allem ist die Zahl der Gewalttaten Jugendlicher in den letzten zehn Jahren in Deutschland leicht gefallen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass 57,9 Prozent der Neuntklässler in Deutschland in ihrer Kindheit Opfer familiärer Gewalt wurden. Somit geht laut Dirk Baier, dem Verfasser der Studie über Jugendgewalt, die größte Gefahr für Gewalt von der Familie und der Schule aus. Auch wenn die Zahlen der Gewalttaten leicht gesunken sind, so steigt jedoch die Intensität und Schärfe der durchgeführten Taten.
Anhand der oben dargestellten Zahlen sowie prägnanter vergangener Ereignisse, die in den Medien heftig und vielseitig diskutiert wurden, wie etwa der Amoklauf in Erfurt 2002, der Amoklauf 2009 in Winnenden oder die U-Bahn-Schläger von 2007 in München, zeigen deutlich, dass in Deutschland gravierender pädagogischer Handlungsbedarf besteht. Es scheint immens wichtig geworden zu sein, Konflikte und auffälliges bzw. abweichendes Verhalten früher zu erkennen oder präventiv erst gar nicht entstehen zu lassen, um auch geplanten Gewaltdelikten entgegenzuwirken. Durch die Medienpräsenz besonders schwerwiegender Delikte werden gesellschaftliche Forderungen für härtere juristische und pädagogische Maßnahmen laut...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition / Begriffserklärung „konfrontative Pädagogik“
- Coolness-Training
- Konzept
- Methoden
- Ziele
- Anti-Aggressivitäts-Training
- Konzept
- Methoden
- Ziele
- Forschungsergebnisse vs. Kritik
- Kampfsport - Eine präventive Alternative
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der konfrontativen Pädagogik und ihrer Anwendung im Umgang mit jugendlichen Gewalttätern. Sie zielt darauf ab, ausgewählte Ansätze und Methoden der konfrontativen Pädagogik im Detail zu erläutern und darzustellen, insbesondere das Coolness-Training und das Anti-Aggressivitäts-Training. Darüber hinaus soll die Kritik an der konfrontativen Pädagogik beleuchtet und eine mögliche Alternative aufgezeigt werden.
- Definition und Begriffserklärung der konfrontativen Pädagogik
- Beschreibung und Analyse des Coolness-Trainings
- Beschreibung und Analyse des Anti-Aggressivitäts-Trainings
- Kritik an der konfrontativen Pädagogik
- Mögliche Alternativen zur konfrontativen Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung liefert einen Überblick über die Problematik von Jugendgewalt in Deutschland, beleuchtet die Häufigkeit und Intensität von Gewaltdelikten sowie die gesellschaftlichen Forderungen nach effektiven pädagogischen Maßnahmen.
- Definition / Begriffserklärung „konfrontative Pädagogik“: Dieses Kapitel definiert den Begriff der „Konfrontation“ und erklärt den pädagogischen Handlungsstil der „konfrontativen Pädagogik“. Es werden die Ziele und Anwendungsbereiche dieser Pädagogik sowie ihre Ursprünge in der amerikanischen Glen Mills School vorgestellt.
- Coolness-Training: Dieses Kapitel widmet sich dem Coolness-Training, einem wichtigen Ansatz der konfrontativen Pädagogik. Es werden das Konzept, die Methoden und die Ziele des Coolness-Trainings erläutert.
- Anti-Aggressivitäts-Training: Das Anti-Aggressivitäts-Training wird in diesem Kapitel detailliert behandelt. Es werden das Konzept, die Methoden und die Ziele des Trainings sowie seine Entstehung und Verbreitung in Deutschland dargestellt.
- Forschungsergebnisse vs. Kritik: Dieses Kapitel beleuchtet die Forschungsergebnisse und die Kritik an der konfrontativen Pädagogik. Es werden die Wirksamkeit und die ethischen Aspekte dieser Methode diskutiert.
- Kampfsport - Eine präventive Alternative: Dieses Kapitel stellt Kampfsport als eine mögliche Alternative zur konfrontativen Pädagogik vor. Es werden die Vorteile und die Risiken von Kampfsport im Umgang mit jugendlichen Gewalttätern beleuchtet.
Schlüsselwörter
Konfrontative Pädagogik, Jugendgewalt, Konfliktarbeit, Coolness-Training, Anti-Aggressivitäts-Training, Glen Mills School, Selbstverantwortung, präventive Maßnahmen, Kampfsport, Resozialisierung.
- Quote paper
- Christoph Bärwald (Author), 2011, Konfrontative Pädagogik - Konfliktarbeit mit jugendlichen Gewalttätern am Beispiel des Coolness-Training und des Anti-Aggressivitäts-Training, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177855