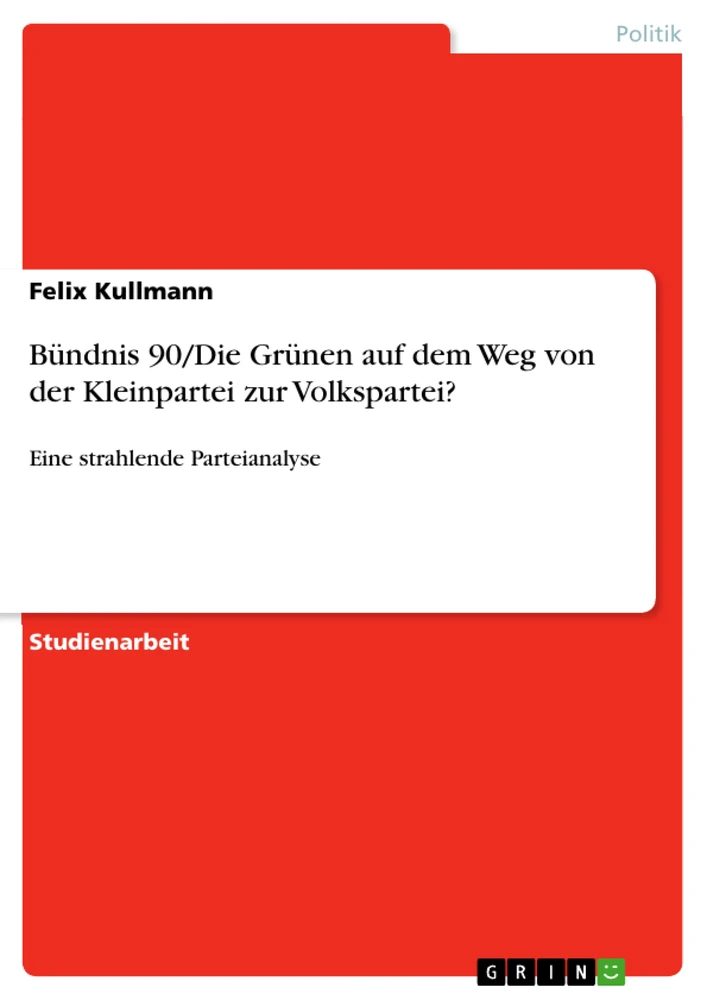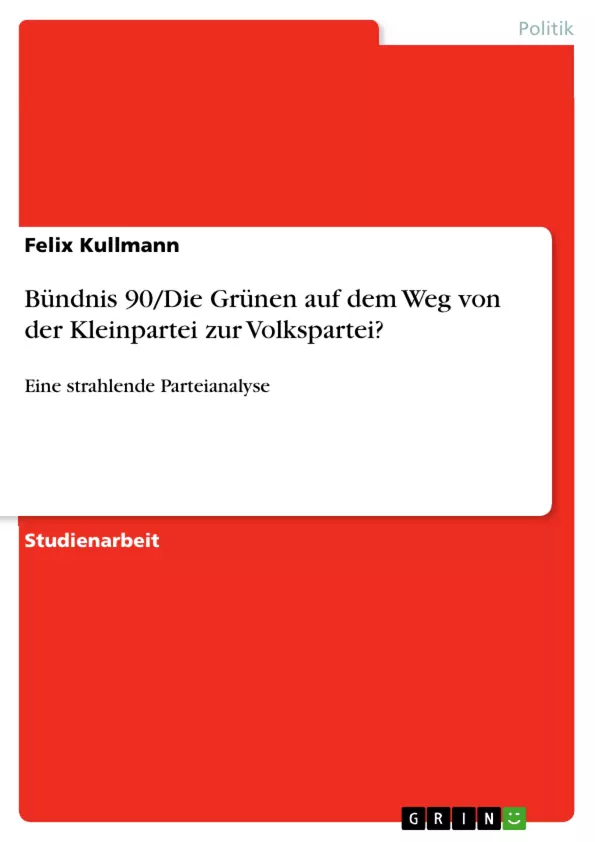Aktuell werden die Grünen von der Parteienforschung als etablierte Kleinpartei eingeordnet, im Unterschied zu CDU/CSU und SPD, denen trotz sinkender Wahlergebnisse der Status von Volksparteien zukommt (vgl. Schubert 2010: 234).
Unabhängig vom eigenen Anspruch der Partei stellt sich daher die Frage, inwieweit haben sich die Grünen bereits von einer Kleinpartei zu einer Volkspartei gewandelt beziehungsweise sind sie im Wandel begriffen?
Um auf diese Frage eine Antwort geben zu können, werden im Kapitel 2 zunächst die theore-tischen Grundlagen zu Kleinpartei und Volkspartei erarbeitet. Dabei wird auf die Definition einer Volkspartei von Peter Lösche und dessen Indikatoren zurückgegriffen. Zur Anwendung dieser Definition auf die Realität und Analyse der aktuellen Situation werden die vier Indika-toren von Lösche zu dreien zusammengefasst und im folgenden Kapitel 3 untersucht. Dies werden die Wähler und Wahlergebnisse der Grünen, ihre Programmatik und abschließend ihre Mitglieder, alle im Zeitverlauf seit ihrer Gründung 1980, sein. Diese werden im Fazit bewertet und eine Antwort auf die Leitfrage der Arbeit gegeben.
In der Literaturauswahl wurde der Fokus vor allem auf neuere Publikationen zu Bündnis 90/Die Grünen gelegt, um ein möglichst aktuelles Bild des Forschungsstands zu zeichnen. Wichtige Autoren sind hierbei Serkan Agci, Melanie Haas und Lothar Probst sowie die Ver-fasser des Standardwerks zu den Bündnisgrünen, Markus Klein und Jürgen Falter.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen - Kleinpartei und Volkspartei
- Empirische Parteianalyse
- Wähler, Wahlen, Potenziale...
- Grüne Programmatik im Wandel der Zeit...
- Die Mitglieder der Grünen.....
- Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit sich die Grünen von einer Kleinpartei zu einer Volkspartei gewandelt haben oder befinden. Im Mittelpunkt stehen die theoretischen Grundlagen von Klein- und Volksparteien sowie die empirische Analyse der Grünen anhand ihrer Wähler, ihrer Programmatik und ihrer Mitglieder.
- Entwicklung der Grünen als Kleinpartei und mögliche Transformation zur Volkspartei
- Theoretische Definitionen und Merkmale von Klein- und Volksparteien
- Analyse der Wähler, Wahlergebnisse und Programmatik der Grünen im Zeitverlauf
- Bewertung der Mitgliederzahl und ihrer Bedeutung für die Parteistruktur
- Bedeutung der Grünen im deutschen Parteiensystem
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Fragestellung der Arbeit eingeführt und die Entwicklung der Grünen als Partei beleuchtet. Kapitel 2 widmet sich den theoretischen Grundlagen von Klein- und Volksparteien. Es werden verschiedene Definitionen des Begriffs "Volkspartei" vorgestellt, insbesondere die Typologie von Peter Lösche mit seinen vier Indikatoren für Volksparteien. Kapitel 3 widmet sich der empirischen Analyse der Grünen anhand der drei Indikatoren: Wähler und Wahlergebnisse, Programmatik und Mitglieder. Die Analyse erfolgt anhand von Daten und Entwicklungen im Zeitverlauf seit der Gründung der Partei 1980.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Kleinpartei, Volkspartei, Bündnis 90/Die Grünen, Parteientheorie, Wählerverhalten, Programmatik, Mitgliederstruktur, Parteiensystem, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Sind die Grünen heute eine Volkspartei oder eine Kleinpartei?
In der Parteienforschung werden sie noch als etablierte Kleinpartei geführt, wobei die Arbeit den möglichen Wandel zur Volkspartei untersucht.
Welche Kriterien definieren laut Peter Lösche eine Volkspartei?
Lösche nutzt Indikatoren wie die Wählerschaft, die Programmatik, die Mitgliederstruktur und die Wahlergebnisse.
Wie hat sich die Programmatik der Grünen seit 1980 verändert?
Die Arbeit analysiert den Wandel von einer Ein-Themen-Partei (Umwelt) hin zu einem breiteren politischen Spektrum über mehrere Jahrzehnte.
Welche Rolle spielt die Mitgliederstruktur bei der Einordnung?
Die Analyse der Mitgliederentwicklung gibt Aufschluss darüber, ob die Partei in der Breite der Gesellschaft verankert ist.
Welche Forscher sind für die Analyse der Grünen zentral?
Wichtige Autoren sind unter anderem Markus Klein, Jürgen Falter, Lothar Probst und Melanie Haas.
- Quote paper
- Felix Kullmann (Author), 2011, Bündnis 90/Die Grünen auf dem Weg von der Kleinpartei zur Volkspartei? , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177801