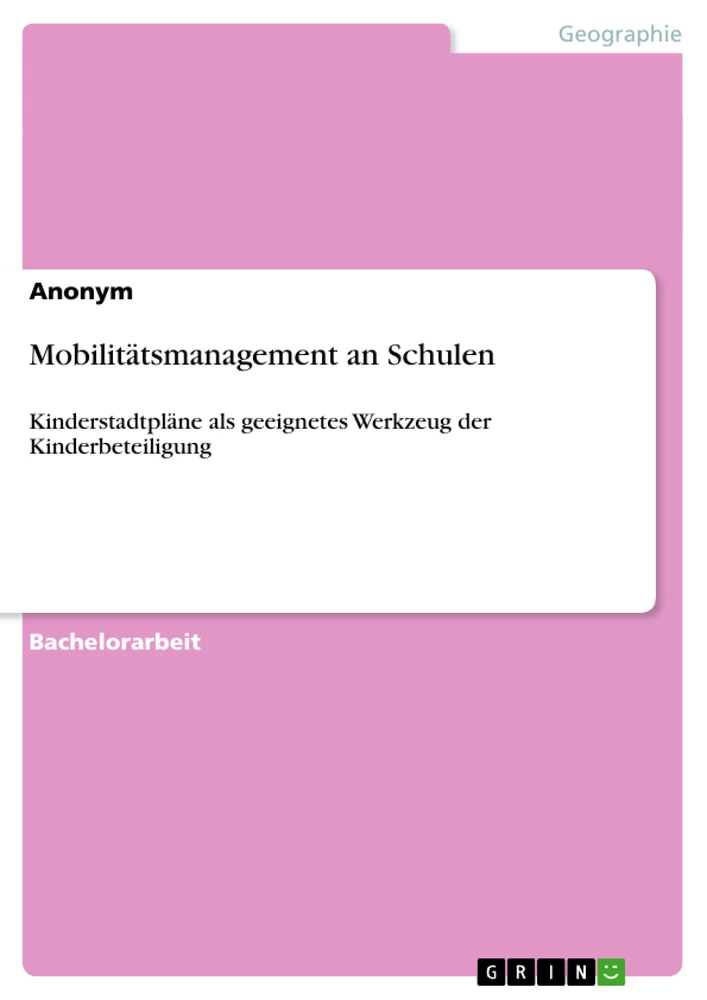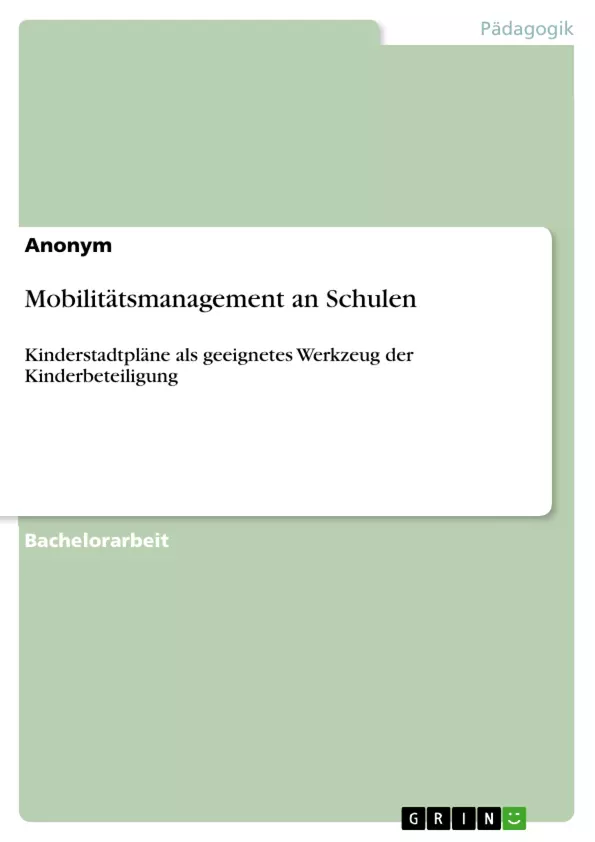Das Mobilitätsverhalten von Kindern hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verändert. Unfallstatistiken zeigen, dass es für Kinder in Städten immer gefährlicher wird sich alleine, sei es auf dem Weg zur Schule oder in der Freizeit, zu bewegen. Um dem entgegen zu wirken, wird die Mobilitätserziehung an Schulen immer wichtiger und ein grundlegender Baustein schulischer Ausbildung. Kinder sollen zum einen geschult werden viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen, andererseits sollen ihnen mögliche Gefahrenstellen und das richtige Verhalten im Straßenverkehr näher gebracht werden.
Um diese meist sehr theoretische Ausbildung der Kinder durch praktische Übungen zu ergänzen, gibt es die sogenannte Kinderbeteiligung. Eine Möglichkeit der Partizipation von Kindern ist ein Kinderstadtplan – ein Stadtplan von Kindern für Kinder. Hier werden mit Hilfe der Kinder nicht nur Gefahrenstellen untersucht, sondern auch mögliche Freizeitziele analysiert und bewertet. Kinder sollen mit diesem Kinderstadtplan lernen sich alleine zu orientieren, Entfernungen einschätzen zu können und sich eventuell auch eigenständig ein bereits bekanntes oder neues Freizeitziel aussuchen zu können und dieses ausfindig zu machen.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst allgemein in das Thema Mobilitätsmanagement bzw. Mobilitätserziehung sowie Partizipation eingeleitet. Im zweiten Teil soll zunächst versucht werden Verknüpfungen bzw. Zusammenhänge zwischen der Mobilitätserziehung an Schulen und der kommunalen Kinderbeteiligung darzustellen. Die Erstellung eines Kinderstadtplans sowie die spezifische Beteiligung von Kindern werden dann näher erläutert. Hierbei wird ebenfalls näher auf den Projektverlauf, von der Vorbereitung über die Erstellung bis hin zum Layout, eines solchen Stadtplanes eingegangen. Anschließend soll im empirisch-analytischen Teil vorab auf die Konzeption und Durchführung der Erhebung eingegangen werden. Um herauszufinden, welche unterschiedlichen Ansichten verschiedene Befragungsgruppen haben, wurden neben Kindern im Grundschulalter ebenso auch Eltern und Experten befragt. Mit Hilfe der empirischen Erhebung sollen die verschiedenen Standpunkte und Blickwinkel gegenübergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärungen
- 2.1 Mobilität und Mobilitätsmanagement
- 2.2 Partizipation
- 3 Mobilitätsmanagement an Schulen
- 3.1 Die Entwicklung der Verkehrserziehung in Deutschland
- 3.2 Kinder im Straßenverkehr
- 3.3 Unfälle
- 4 Mobilitätserziehung in der Praxis
- 4.1 Schulwege früher und heute
- 4.2 Mental Maps - Auswirkungen des Mobilitätsverhaltens
- 4.3 Beispielkampagne „FahrRad in Aachen“
- 5 Die Rolle der Kinderbeteiligung in der Mobilitätserziehung
- 5.1 Voraussetzungen und gesetzliche Rahmenbedingungen
- 5.2 Formen der Kinderbeteiligung
- 5.3 Ziele der Kinderbeteiligung
- 6 Kinderleben in der Stadt
- 6.1 Lebenswelten
- 6.2 Warum Kinderstadtpläne?
- 7 Stadtpläne von Kindern für Kinder
- 7.1 Projektverlauf
- 7.2 Kinderbeteiligung bei der Planerstellung
- 7.3 formelle Kriterien
- 8 Kinderstadtpläne als geeignetes Werkzeug der Kinderbeteiligung?
- 8.1 Empirische Datenerhebung – methodisches Vorgehen
- 8.2 Sichtweisen - Kinder, Eltern, Experten
- 9 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Eignung von Kinderstadtplänen als Werkzeug der Kinderbeteiligung im Mobilitätsmanagement an Schulen. Ziel ist es, die Perspektiven von Kindern, Eltern und Experten zu diesem Thema zu analysieren und die praktische Umsetzbarkeit und den Nutzen von Kinderstadtplänen zu evaluieren.
- Mobilitätsmanagement an Schulen und die Rolle der Verkehrserziehung
- Kinderbeteiligung als Konzept und Methode
- Analyse von Kinderstadtplänen als Partizipationsinstrument
- Empirische Untersuchung der Akzeptanz und des Nutzens von Kinderstadtplänen
- Bewertung der Eignung von Kinderstadtplänen für die Verbesserung der Schulwegsicherheit und des Mobilitätsverhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Relevanz von Kinderbeteiligung im Mobilitätsmanagement an Schulen. Sie skizziert die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgenden Kapitel und stellt den Kontext der Untersuchung dar. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die Perspektive von Kindern in die Gestaltung ihrer Mobilität einzubeziehen.
2 Begriffserklärungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Mobilität, Mobilitätsmanagement und Partizipation. Es klärt die verwendeten Definitionen und stellt sicher, dass die Arbeit auf einer gemeinsamen terminologischen Basis aufbaut. Die präzise Definition dieser Begriffe ist essentiell für das Verständnis der weiteren Ausführungen und die Interpretation der Ergebnisse.
3 Mobilitätsmanagement an Schulen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Verkehrserziehung in Deutschland, die Herausforderungen im Straßenverkehr für Kinder, und die Problematik von Kinderunfällen. Es stellt den Zusammenhang zwischen Mobilitätsmanagement, Verkehrserziehung und der Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr her und unterstreicht die Notwendigkeit von präventiven Maßnahmen. Die Darstellung der Unfallstatistik verdeutlicht den Handlungsbedarf.
4 Mobilitätserziehung in der Praxis: Dieses Kapitel untersucht den Wandel der Schulwege im Laufe der Zeit und analysiert die "Mental Maps" von Kindern, also ihre subjektive Wahrnehmung ihres Schulweges und ihrer Umgebung. Ein Beispiel einer Kampagne zur Förderung des Fahrradfahrens in Aachen wird vorgestellt und analysiert. Hier wird der Fokus auf die praktische Umsetzung von Mobilitätserziehung und die verschiedenen Faktoren gelegt, die das Mobilitätsverhalten von Kindern beeinflussen.
5 Die Rolle der Kinderbeteiligung in der Mobilitätserziehung: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen für Kinderbeteiligung, und präsentiert verschiedene Methoden der Beteiligung. Es analysiert die Ziele und den Nutzen der Kinderbeteiligung in der Mobilitätserziehung, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Die Bedeutung von Partizipation für die Entwicklung von eigenverantwortlichem Handeln und die Stärkung des Selbstbewusstseins bei Kindern wird hervorgehoben.
6 Kinderleben in der Stadt: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebenswelten von Kindern und argumentiert für den Einsatz von Kinderstadtplänen als geeignete Methode der Beteiligung. Es beschreibt die spezifischen Bedürfnisse und Sichtweisen von Kindern auf die Stadt und zeigt die Vorteile von Kinderstadtplänen auf, um diese Perspektiven zu erfassen und in Planungsprozesse einzubeziehen. Der Fokus liegt auf den spezifischen Bedürfnissen und der Wahrnehmung von Kindern in Bezug auf ihre Umgebung.
7 Stadtpläne von Kindern für Kinder: Dieses Kapitel beschreibt den Projektverlauf und die konkrete Beteiligung von Kindern an der Erstellung von Stadtplänen. Es behandelt die methodischen Vorgehensweisen und die formalen Kriterien für die Gestaltung dieser Pläne. Es wird die praktische Umsetzung der Kinderbeteiligung im Detail beleuchtet und die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren erörtert.
8 Kinderstadtpläne als geeignetes Werkzeug der Kinderbeteiligung?: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Datenerhebung präsentiert und analysiert. Die unterschiedlichen Sichtweisen von Kindern, Eltern und Experten auf Kinderstadtpläne werden verglichen und interpretiert. Die Ergebnisse liefern Aufschluss über die Akzeptanz und den Nutzen von Kinderstadtplänen als Partizipationsinstrument. Der Fokus liegt auf der Auswertung der Daten und der Beantwortung der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Mobilitätsmanagement, Schulen, Kinderbeteiligung, Kinderstadtpläne, Partizipation, Verkehrserziehung, Schulwegsicherheit, Mental Maps, empirische Forschung, Stadtplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Kinderstadtpläne als Werkzeug der Kinderbeteiligung im Mobilitätsmanagement an Schulen
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Eignung von Kinderstadtplänen als Werkzeug der Kinderbeteiligung im Mobilitätsmanagement an Schulen. Sie analysiert die Perspektiven von Kindern, Eltern und Experten und evaluiert die praktische Umsetzbarkeit und den Nutzen dieser Pläne.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, inwiefern Kinderstadtpläne die Perspektiven von Kindern, Eltern und Experten im Kontext von Mobilitätsmanagement an Schulen widerspiegeln und ob sie zur Verbesserung der Schulwegsicherheit und des Mobilitätsverhaltens beitragen. Die zentrale Frage lautet: Sind Kinderstadtpläne ein geeignetes Werkzeug zur Kinderbeteiligung im Mobilitätsmanagement an Schulen?
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative und quantitative Forschungsmethode. Sie beinhaltet eine Literaturrecherche, eine Analyse von Beispielen (z.B. die Kampagne „FahrRad in Aachen“) und eine empirische Datenerhebung, um die Sichtweisen von Kindern, Eltern und Experten zu erfassen und zu vergleichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Begriffserklärungen (Mobilität, Mobilitätsmanagement, Partizipation), Mobilitätsmanagement an Schulen, Mobilitätserziehung in der Praxis, Die Rolle der Kinderbeteiligung, Kinderleben in der Stadt, Stadtpläne von Kindern für Kinder, Kinderstadtpläne als geeignetes Werkzeug und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie Mobilität, Mobilitätsmanagement und Partizipation, um eine gemeinsame terminologische Basis für die Analyse zu schaffen. Diese Definitionen sind essentiell für das Verständnis der Ergebnisse.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der empirischen Datenerhebung, die die Sichtweisen von Kindern, Eltern und Experten zu Kinderstadtplänen als Partizipationsinstrument widerspiegeln. Diese Ergebnisse werden analysiert und interpretiert, um die Eignung von Kinderstadtplänen zu evaluieren.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage. Es bewertet die Eignung von Kinderstadtplänen als Werkzeug der Kinderbeteiligung im Mobilitätsmanagement an Schulen und diskutiert die Implikationen der Ergebnisse für die Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mobilitätsmanagement, Schulen, Kinderbeteiligung, Kinderstadtpläne, Partizipation, Verkehrserziehung, Schulwegsicherheit, Mental Maps, empirische Forschung, Stadtplanung.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit folgt einem strukturierten Aufbau mit Einleitung, theoretischem Teil, methodischem Teil, Ergebnispräsentation, Diskussion und Schlussfolgerung. Der theoretische Teil definiert wichtige Begriffe und beleuchtet den Kontext. Der methodische Teil beschreibt die Vorgehensweise der Datenerhebung und -analyse. Der empirische Teil präsentiert und interpretiert die Ergebnisse. Die Diskussion setzt die Ergebnisse in den Kontext und das Fazit zieht Schlussfolgerungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Mobilitätsmanagement an Schulen, Kinderbeteiligung und Partizipation in der Stadtplanung beschäftigen, insbesondere für Pädagogen, Stadtplaner, Verkehrsexperten und Entscheidungsträger in der Kommunalverwaltung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Mobilitätsmanagement an Schulen , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177799