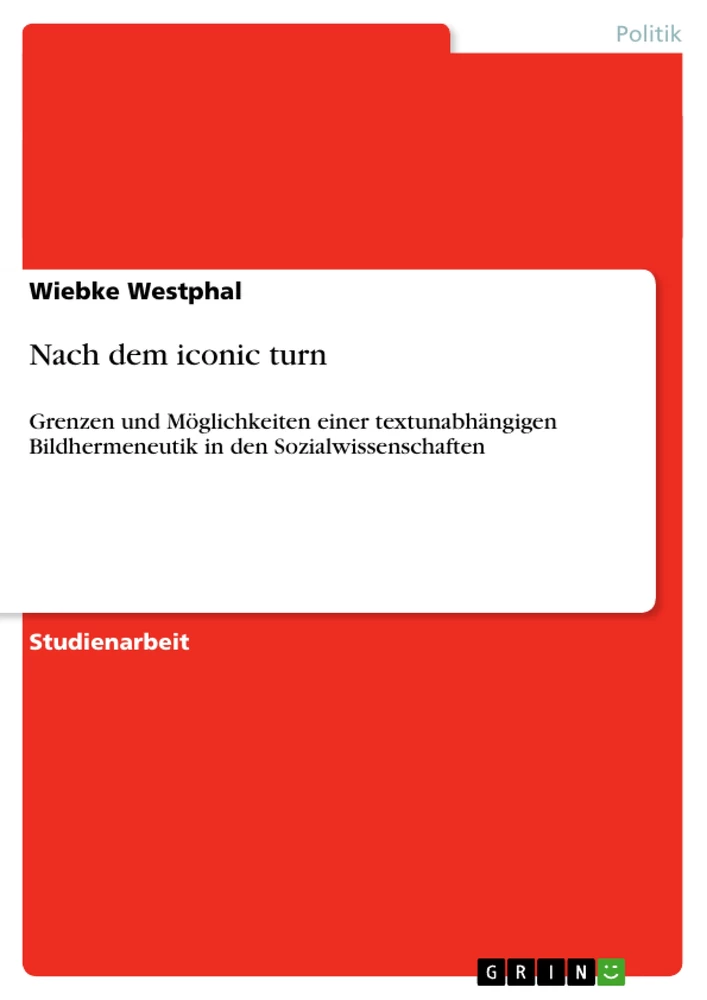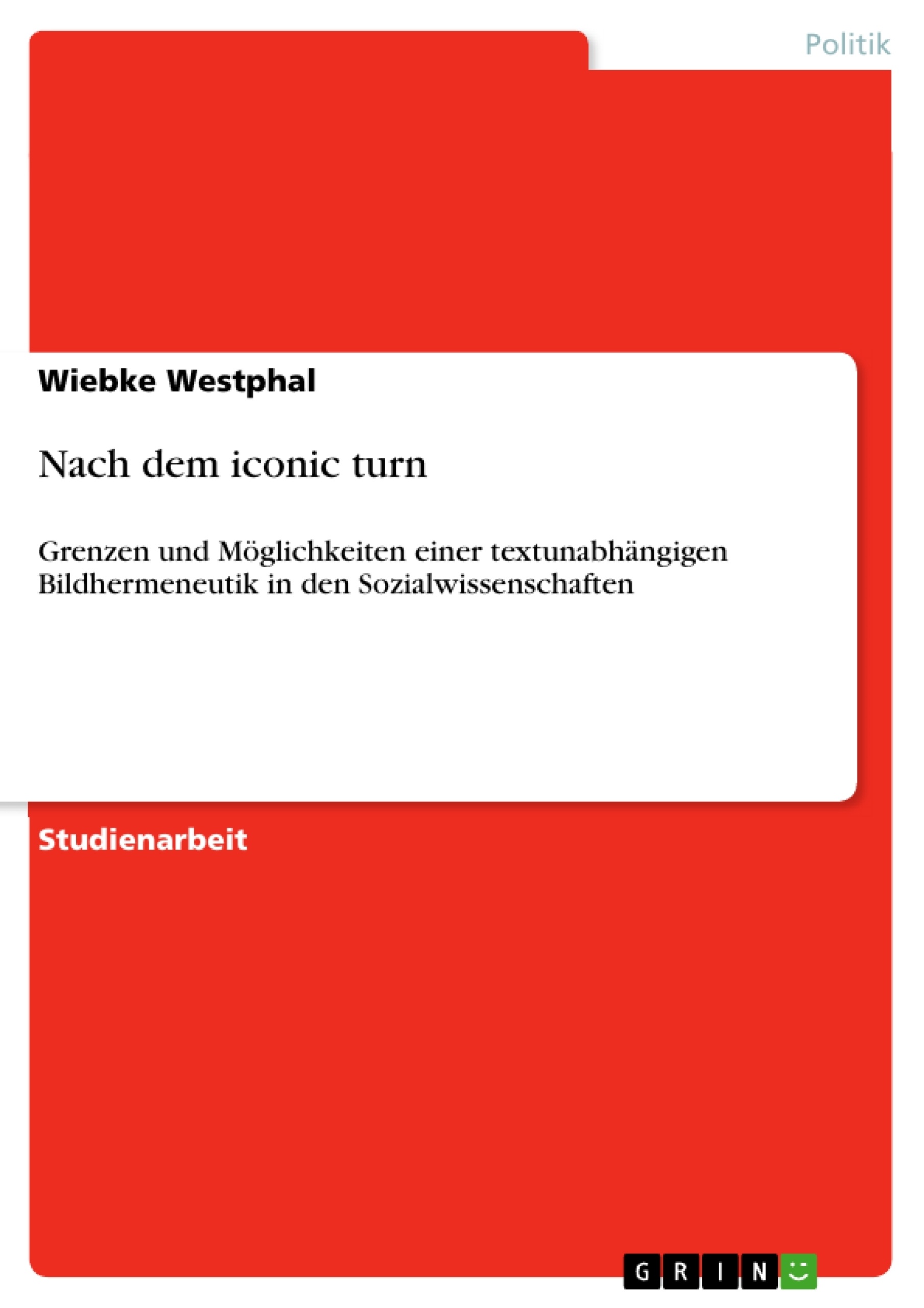Kaum jemand war jemals als Soldat in Vietnam oder im Irak, dennoch verfügen wir von diesen Kriegen über eine mehr oder minder genaue Vorstellung. Kaum jemand ist auch Konrad Adenauer oder Gerhard Schröder jemals persönlich begegnet, dennoch haben wir „ein Bild von ihnen“. Bilder dienen in der heutigen Mediengesellschaft als konkrete Bezugspunkte unserer Erinnerung und sind nicht austauschbar. Bilder können dies leisten, da sie „eine eigene Sprache sprechen“, eine eingängige Bildsprache, mittels derer sie etwas auszudrücken in der Lage sind, das die Grenzen verbaler Kommunikation sprengt. Es sind somit nicht Texte, sondern Bilder, die die Wende zum 21. Jahrhundert markieren und sich in unsere Köpfe eingebrannt haben. Oder um es mit den Worten des Philosophen Walter Benjamin zu sagen: „Geschichte zerfällt in Bilder, nicht in Geschichten“.
Aber wie groß sind die Unterschiede zwischen Bildern und Geschichten eigentlich? Was können die einen leisten, was die anderen nicht zu leisten im Stande sind – und umgekehrt? Wie weit ist überhaupt eine visuelle Sprache mit einer verbalen Sprache vergleichbar? Wie kann ein Verständnis von Wortsprache zur Erhellung von Bildsprache beitragen? Und wie können sich diese beiden Systeme ergänzen?
Die vorliegende Arbeit hat aus einem bestimmten Grund ein Interesse an der Beantwortung dieser Fragen: Wenn in der heutigen Gesellschaft das Bild die Sprache als Leitmedium abgelöst hat, wenn eine kulturelle Verschiebung vom Text zum Bild stattgefunden hat – welche Auswirkungen hat dies, welche Auswirkungen muss dies vielleicht sogar haben, auf sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden, die von jeher einem Prinzip der Schriftlichkeit unterworfen waren? Wenn sozialwissenschaftliches Interesse die Erforschung und Interpretation sozialer Wirklichkeit ist, kann die soziale Wirklichkeit der Allgegenwärtigkeit des Bildes dann einfach außen vor gelassen werden? Und wie kann eine verstehende Sozialwissenschaft aussehen, die die Macht der Bilder anerkennt?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Ansprüche einer verstehenden Sozialwissenschaft
- 3. Verschiedene Varianten der hermeneutischen Interpretation
- 3.1. Hermeneutik als Textwissenschaft
- 3.2. Hermeneutik nichtsprachlichen Ausdrucks
- 4. Die neue Macht der Bilder: der iconic turn
- 4.1. Zur Wichtigkeit einer kritischen Bildkompetenz
- 5. Was ist ein Bild?
- 5.1. Die Besonderheit des Fotos
- 5.2. Bilder in den Massenmedien
- 6. Bildhermeneutik als Methode textunabhängiger Bildanalyse
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten einer Bildhermeneutik als Methode textunabhängiger Bildanalyse im Kontext des "iconic turn". Sie befasst sich mit der Frage, wie sozialwissenschaftliche Methoden angesichts der zunehmenden Bedeutung von Bildern angepasst werden müssen. Die Arbeit analysiert die Grenzen und Möglichkeiten einer verstehenden Sozialwissenschaft, die die Macht der Bilder anerkennt.
- Die Entwicklung und Anwendung der Hermeneutik in den Sozialwissenschaften
- Der "iconic turn" und die Verschiebung vom Text zum Bild als Leitmedium
- Die Bedeutung kritischer Bildkompetenz in der heutigen Mediengesellschaft
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten einer Bildhermeneutik
- Die Anwendung hermeneutischer Prinzipien auf nichtsprachliche Ausdrucksformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Möglichkeiten einer Bildhermeneutik als Methode textunabhängiger Bildanalyse. Sie verdeutlicht die wachsende Bedeutung von Bildern in der heutigen Gesellschaft und deren Einfluss auf sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden. Der Einleitungsteil skizziert die Struktur der Arbeit und die behandelten Aspekte, wie die Übertragung des Verstehens in die Sozialwissenschaft und die Herausforderungen, die sich durch den "iconic turn" ergeben.
2. Allgemeine Ansprüche einer verstehenden Sozialwissenschaft: Dieses Kapitel untersucht den Prozess des menschlichen Verstehens als alltägliche Praxis und seine Übertragung in die Sozialwissenschaft. Es beleuchtet den Anspruch der Sozialwissenschaft, Interpretationen menschlichen Handelns validierbar und transparent zu machen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Hermeneutik als Methode zur Nachvollziehbarkeit von Verstehensprozessen dient, insbesondere angesichts der wachsenden Bedeutung von Bildern als „Protokolle sozialen Handelns“.
3. Verschiedene Varianten der hermeneutischen Interpretation: Dieses Kapitel vergleicht zwei Ansätze der hermeneutischen Interpretation: die klassische Textwissenschaft und die Interpretation nichtsprachlicher Ausdrucksformen wie Bilder. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Methodologien und legt den Grundstein für die spätere Diskussion über eine Bildhermeneutik. Der Abschnitt identifiziert die Debatte um die Sprach- und Bildabhängigkeit von Erkenntnisgewinnung.
4. Die neue Macht der Bilder: der iconic turn: Dieses Kapitel beschreibt den "iconic turn" als eine kulturelle Verschiebung vom Text zum Bild. Es betont die zunehmende Bedeutung von Bildern in der heutigen Gesellschaft und die Notwendigkeit einer kritischen Bildkompetenz. Die Bedeutung von Bildern für das Verständnis von Geschichte und sozialen Prozessen wird erörtert, wobei der Mangel an entsprechender Kompetenz im Umgang mit Bildern hervorgehoben wird.
5. Was ist ein Bild?: Das Kapitel befasst sich mit der Definition und Natur von Bildern, insbesondere im Kontext von Fotografien und ihrer Verwendung in Massenmedien. Es untersucht die Eigenheiten von Bildern als Ausdrucksmittel, ihre Funktion als Bezugspunkte unserer Erinnerung und die oft verschwommenen Grenzen zwischen Abbild und Realität. Das Kapitel analysiert die besondere Rolle von Bildern in der öffentlichen Kommunikation und den Herausforderungen für die Interpretation dieser Medien.
6. Bildhermeneutik als Methode textunabhängiger Bildanalyse: Dieses Kapitel präsentiert einen Ansatz für eine Bildhermeneutik als Methode der textunabhängigen Bildanalyse. Es baut auf den vorherigen Kapiteln auf und integriert die zuvor diskutierten Aspekte der Hermeneutik, des "iconic turn" und der Natur von Bildern. Das Kapitel wird vermutlich eine konkrete Methodik für die Bildinterpretation beschreiben und begründen.
Schlüsselwörter
Hermeneutik, Bildhermeneutik, Iconic Turn, Bildanalyse, Sozialwissenschaft, Interpretationsmethoden, visuelle Kommunikation, Text vs. Bild, Bildkompetenz, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bildhermeneutik als Methode textunabhängiger Bildanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten einer Bildhermeneutik als Methode zur textunabhängigen Bildanalyse im Kontext des „iconic turn“. Sie befasst sich mit der Anpassung sozialwissenschaftlicher Methoden angesichts der zunehmenden Bedeutung von Bildern und analysiert die Grenzen und Möglichkeiten einer verstehenden Sozialwissenschaft, die die Macht der Bilder anerkennt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Anwendung der Hermeneutik in den Sozialwissenschaften, den „iconic turn“ und die Verschiebung vom Text zum Bild, die Bedeutung kritischer Bildkompetenz, die Herausforderungen und Möglichkeiten einer Bildhermeneutik sowie die Anwendung hermeneutischer Prinzipien auf nichtsprachliche Ausdrucksformen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Allgemeine Ansprüche einer verstehenden Sozialwissenschaft, Verschiedene Varianten der hermeneutischen Interpretation (inkl. Hermeneutik als Textwissenschaft und Hermeneutik nichtsprachlichen Ausdrucks), Die neue Macht der Bilder: der iconic turn (inkl. Zur Wichtigkeit einer kritischen Bildkompetenz), Was ist ein Bild? (inkl. Die Besonderheit des Fotos und Bilder in den Massenmedien), Bildhermeneutik als Methode textunabhängiger Bildanalyse und Fazit.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie kann eine Bildhermeneutik als Methode textunabhängiger Bildanalyse entwickelt und angewendet werden?
Welche Methoden werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert hermeneutische Interpretationsmethoden, sowohl im Kontext der klassischen Textwissenschaft als auch im Hinblick auf die Analyse nichtsprachlicher Ausdrucksformen wie Bilder. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung einer konkreten Methodik für die Bildinterpretation.
Was ist der „iconic turn“?
Der „iconic turn“ beschreibt eine kulturelle Verschiebung vom Text zum Bild als dominierendes Kommunikations- und Wissensmedium. Die Arbeit betont die zunehmende Bedeutung von Bildern in der heutigen Gesellschaft und die Notwendigkeit einer kritischen Bildkompetenz.
Welche Bedeutung hat die Bildkompetenz?
Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer kritischen Bildkompetenz in der heutigen Mediengesellschaft, um die Macht der Bilder und ihren Einfluss auf das Verständnis von Geschichte und sozialen Prozessen zu erfassen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Hermeneutik, Bildhermeneutik, Iconic Turn, Bildanalyse, Sozialwissenschaft, Interpretationsmethoden, visuelle Kommunikation, Text vs. Bild, Bildkompetenz, qualitative Forschung.
Wie wird die Hermeneutik in der Arbeit eingesetzt?
Die Arbeit nutzt die Hermeneutik als methodischen Ansatz, um Bildinterpretationen zu verstehen und zu analysieren. Sie untersucht, wie hermeneutische Prinzipien auf nichtsprachliche Ausdrucksformen angewendet werden können und wie der Prozess des Verstehens in der Sozialwissenschaft validierbar und transparent gemacht werden kann.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sozialwissenschaftler, Bildwissenschaftler, Medienwissenschaftler und alle, die sich mit der Interpretation von Bildern und ihrer Bedeutung in der Gesellschaft auseinandersetzen.
- Quote paper
- Wiebke Westphal (Author), 2010, Nach dem iconic turn, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177303