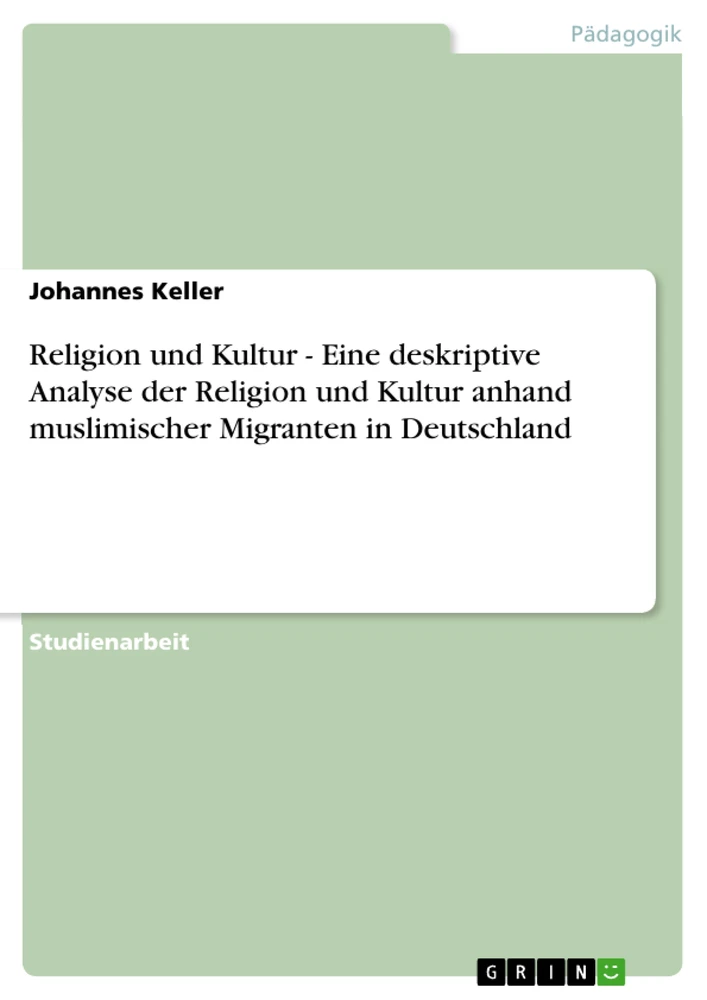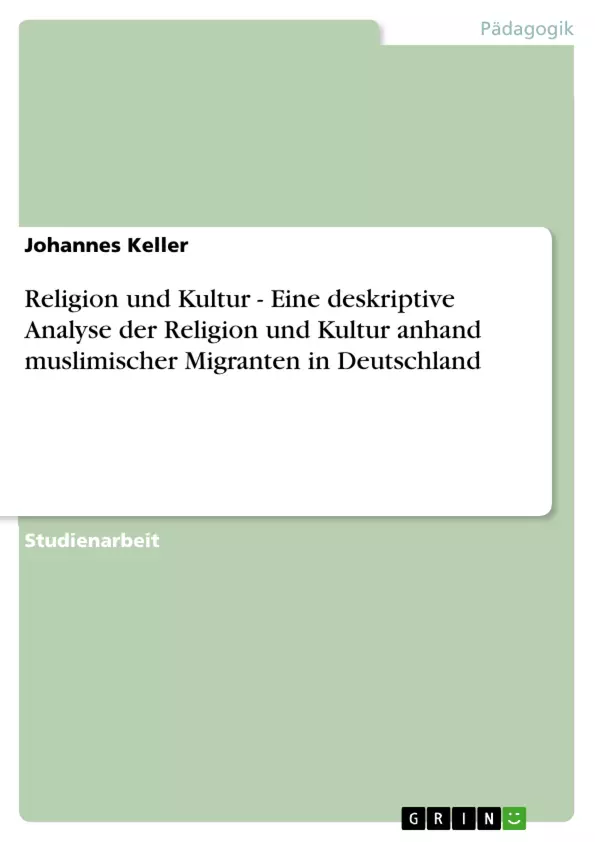„Eine Definition dessen, was Religion ´ist´, kann unmöglich an der Spitze, sondern könnte allenfalls am Schluss einer Erörterung wie der nachfolgenden stehen“ (Weber, M. 1969, S. 245).
Wie das Zitat von Max Weber zeigt, tut auch er sich schwer, den Begriff der Religion in einer einfachen Art und Weise zu definieren. Der Begriff der Religion, der hier im Zentrum der Arbeit steht, soll deshalb behutsam angegangen und schrittweise behandelt werden. Zudem steht der Religionsbegriff in dieser Arbeit in einem über Webers Ansätze hinausgehenden bzw. anderen Kontext. Es liegt mir fern, die Religion deshalb vollständig zu definieren. Viel eher kommt es mir darauf an, Religion aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, weil Religion für mein Empfinden und in Anbetracht der geführten öffentlichen Debatten meist vernachlässigt oder weniger konstruktiv diskutiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung und Fragestellung
- 1.2 Aufbau und Struktur der Arbeit
- 2. Begriffsbestimmung und Definition
- 2.1 Was ist Kultur?
- 2.2 Was ist Religion?
- 2.3 Der Islam und seine religiöse Wirkung
- 3. Die Wirkung der Religion auf die Kultur
- 3.1 Erkenntnisse aus Webers Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus
- 3.2 Die Parallelen zwischen Religion und Migration aus Sicht der interkulturellen Pädagogik
- 4. Die Bedeutung der Religion für muslimische Migranten in Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Religion auf die Kultur, insbesondere im Kontext muslimischer Migranten in Deutschland. Dabei wird untersucht, welche Bedeutung religiös geprägte Werte und Normen für diese Migrantengruppe haben und ob diese in Deutschland eine eigene, religiös geprägte Kultur entwickeln.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Kultur und Religion
- Die Wirkung der Religion auf die Kultur, insbesondere im Kontext der interkulturellen Pädagogik
- Die Rolle der Religion für muslimische Migranten in Deutschland
- Die Bedeutung von religiösen Werten und Normen für die Integration muslimischer Migranten in Deutschland
- Die Frage, ob Religion ein Rückzugsgebiet für Migranten darstellt und ob sie die Integration erschwert oder unterstützt.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel Zwei beschäftigt sich mit der Definition der Begriffe Kultur und Religion. Dabei wird die Pluralität unserer Gesellschaft und die Entwicklung des Kulturbegriffs beleuchtet. Zudem wird der Islam als eine der wichtigsten muslimischen Glaubensrichtungen vorgestellt und dessen Wirkung auf seine Anhänger analysiert.
Kapitel Drei untersucht den Zusammenhang zwischen Kultur und Religion. Der Fokus liegt dabei auf der Wirkung der Religion und den daraus resultierenden Effekten für die Kultur. Hierbei werden die Erkenntnisse aus Max Webers "Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" sowie die Sichtweise der interkulturellen Pädagogik auf Religion und Gemeinschaft herangezogen.
Kapitel Vier analysiert die Bedeutung der Religion für muslimische Migranten in Deutschland. Anhand der Ergebnisse der Studie "Muslimisches Leben in Deutschland" werden die Lebenswelten dieser Migrantengruppe beleuchtet und deren Erfahrungen im Kontext der Religion und Kultur in Deutschland beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Religion, Kultur, Integration, muslimische Migranten, interkulturelle Pädagogik, Werte und Normen, Islam, "Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", Max Weber, "Muslimisches Leben in Deutschland" und die Bedeutung von Religion für die Integration in Deutschland.
- Quote paper
- Johannes Keller (Author), 2011, Religion und Kultur - Eine deskriptive Analyse der Religion und Kultur anhand muslimischer Migranten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177013