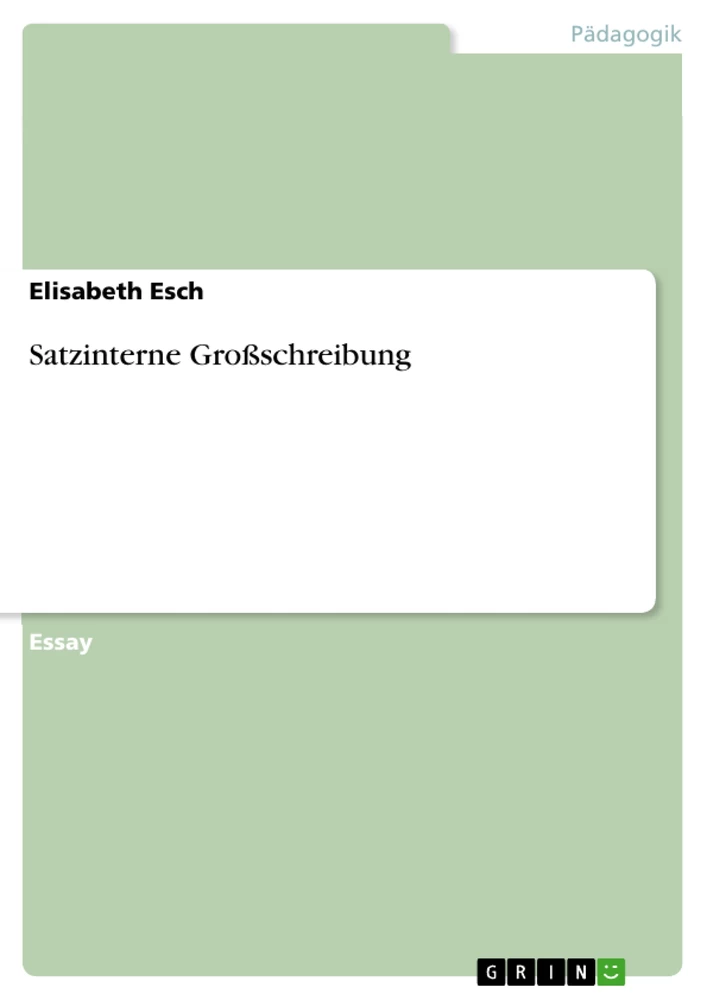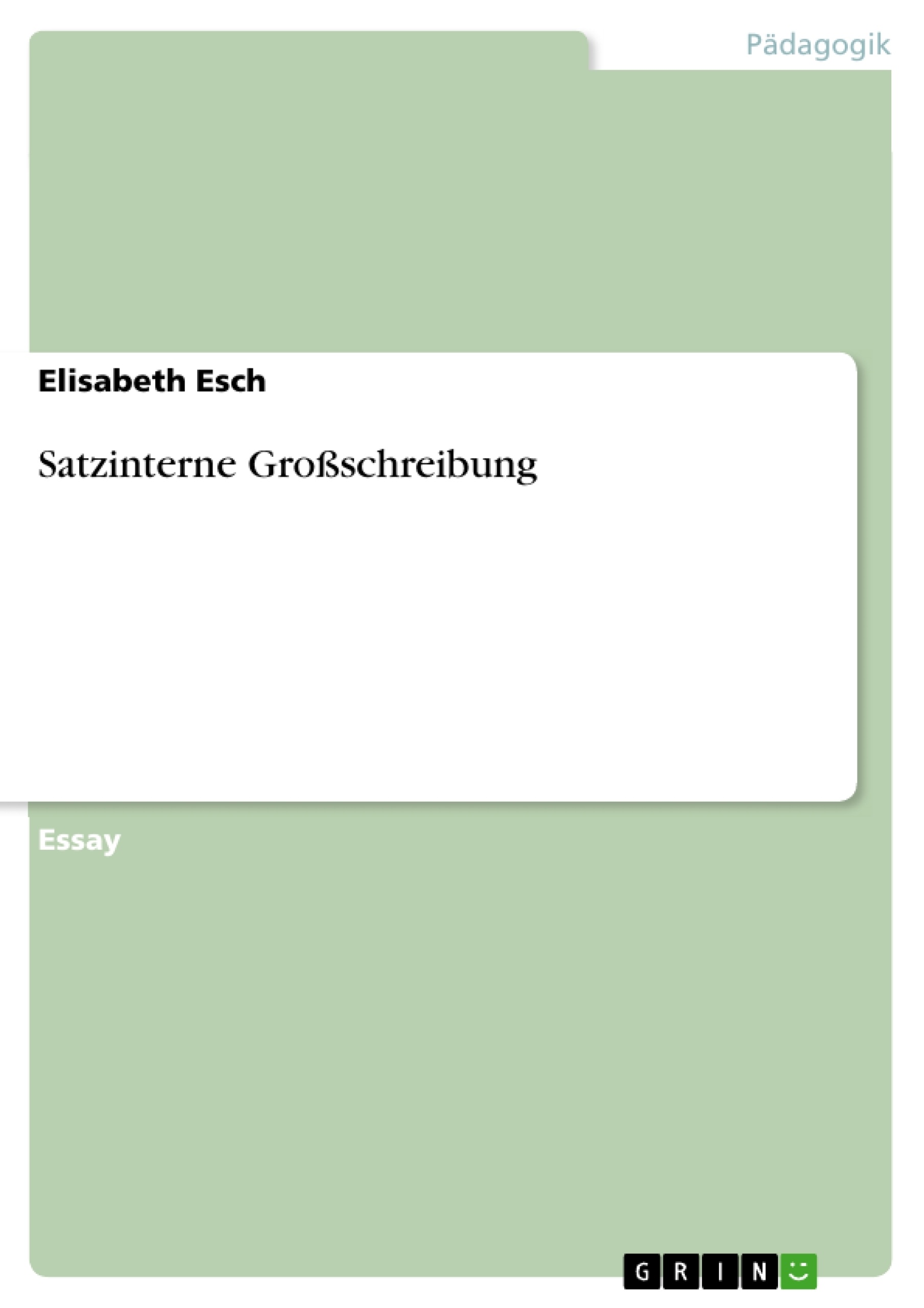Das deutsche Schriftsystem grenzt sich unter anderem mit einer bestimmten
Besonderheit von vielen anderen Sprachen ab. Es verfügt über eine satzinterne
Großschreibung, bei der in diversen Fällen der initiale Buchstabe großgeschrieben
wird. Dies „gilt als schwer zu [er]lernen und unsystematisch.“ (Primus, 2010: 30)
Im gegenwärtigen System herrschen zwei Annahmen, die sich mit diesem
Problem auseinandersetzen. Zum einen wird das lexikalische Wortartenprinzip
vertreten, welches grundsätzlich besagt, dass alle Substantive initial
großgeschrieben werden. Zum anderen greift das syntaktische Prinzip, welches
allgemein bestimmt, dass jeder Kopf einer Nominalphrase großgeschrieben wird.
Im Folgenden werde ich auf diese zwei Regelungen eingehen und sie kritisch
beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Das lexikalische Wortartenprinzip
- Kritische Auseinandersetzung
- Das syntaktische Prinzip
- Kritische Auseinandersetzung
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der satzinternen Großschreibung in der deutschen Sprache und analysiert die beiden gängigen Regeln, das lexikalische Wortartenprinzip und das syntaktische Prinzip. Der Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung dieser Regeln und ihrer praktischen Anwendung.
- Das lexikalische Wortartenprinzip und seine Anwendung
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem lexikalischen Wortartenprinzip
- Das syntaktische Prinzip und seine Anwendung
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem syntaktischen Prinzip
- Fazit: Stärken und Schwächen der beiden Prinzipien
Zusammenfassung der Kapitel
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit: Die Einleitung stellt die satzinterne Großschreibung in der deutschen Sprache als ein komplexes Thema vor, das durch zwei unterschiedliche Regeln, das lexikalische Wortartenprinzip und das syntaktische Prinzip, versucht wird zu regulieren. Die Arbeit hat zum Ziel, diese beiden Regeln kritisch zu analysieren und zu beleuchten.
- Das lexikalische Wortartenprinzip: Dieses Kapitel behandelt die Duden-Rechtschreibung und ihre Festlegung auf das lexikalische Wortartenkonzept. Es erläutert die Grundregel der Großschreibung für Substantive, Eigennamen und Satzanfänge sowie die verschiedenen Ausnahmen und Sonderfälle. Die "Fünf-Wortarten-Lehre" nach Hans Glinz und das Konzept der Lexemklassen werden vorgestellt.
- Kritische Auseinandersetzung: Dieses Kapitel stellt die Vor- und Nachteile des lexikalischen Wortartenprinzips heraus und diskutiert, ob die Fokussierung auf die lexikalisch-morphologische Seite ausreichend ist, um eine adäquate Anwendung der Wörter in konkreten syntaktischen Umgebungen zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Satzinterne Großschreibung, lexikalische Wortartenprinzip, syntaktisches Prinzip, Duden Rechtschreibung, Lexemklassen, Substantive, Eigennamen, Groß- und Kleinschreibung, deutsche Sprache, Wortarten, kritische Analyse.
- Quote paper
- Elisabeth Esch (Author), 2011, Satzinterne Großschreibung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/176766