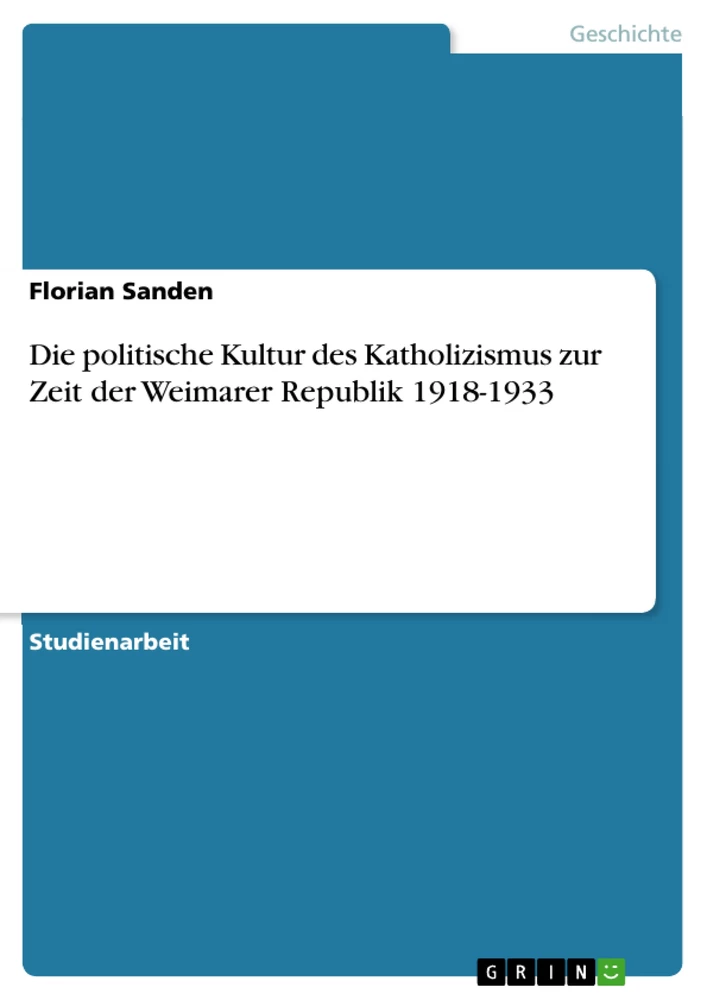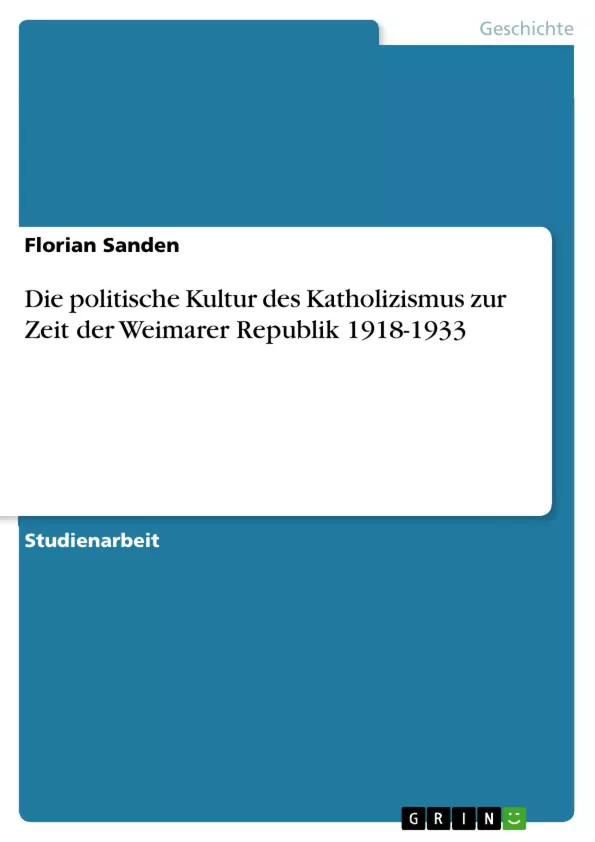Als eines der wesentlichen Defizite der Weimarer Republik und einer der zentralen Gründe für ihr Scheitern gilt oft der Umstand, dass sie eine Republik ohne Republikaner war. Die äußerste Rechte verlangte die Rückkehr zur Monarchie oder die Umwandlung des Staates in eine autoritäre Diktatur. Die äußerste Linke des Parteienspektrums hätte sich 1918 eine viel tief greifendere Revolution, mit anschließender Errichtung einer Diktatur des Proletariats in Form einer Räterepublik gewünscht. Die zahlreichen krisenhaften Ereignisse führten zu einem Erstarken der radikalen, auf die Überwindung des Systems ausgerichteten Parteien, weil Millionen von Wechselwählern den republikanischen Parteien rasch den Rücken kehrten.
Das Volk zeigte im Laufe der 20er Jahre, dass unerschütterliche Treue zur Republik und ihren Institutionen nicht zu seinen Stärken gehörte. Bereits im Juni 1919, anderthalb Jahre nach der Revolution, trat der Widerwille gegen die neue republikanische Staatsform unübersehbar zutage, als die Parteien der Weimarer Koalition bei den Reichstagswahlen keine Mehrheit erhielten. Die Ablehnung der republikanischen Staatsform wurde erneut 1925, bei der Wahl des ehemaligen Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten, deutlich. Der ehemalige Feldherr war 1919 für die Dolchstoßlegende eingetreten, hatte 1920 dem Anführer des Kapp-Lüttwitz-Putsches Wolfgang Kapp nach dem Beginn des Staatsstreiches ein Glückwunsch Telegramm geschickt. Nichtsdestotrotz hielt eine hinreichende Anzahl der Wähler den „Trabant der Hohenzollern“ für geeignet, das höchste Amt im Staate zu bekleiden.
Welche tief greifenden Einstellungen und Mentalitäten können im Hinblick auf Republik und Demokratie innerhalb des katholischen Volksteils, der in mancherlei Hinsicht eine Sonderstellung in der Bevölkerung einnahm, festgestellt werden? Welche Strömungen der politischen Kultur prägten die Zentrumspartei, die seit dem Kulturkampf als parlamentarischer Arm des Katholizismus galt? Wie standen Partei und Milieu zu den anderen im Großen und Ganzen republikanischen Parteien SPD und DDP und deren Sozialmilieus? Welche Kontinuitäten und Umbrüche können im Hinblick auf die politische Kultur des Katholizismus, definiert als langfristig wirkende Einstellungen gegenüber Staat und Republik auf der einen und politischem Ver-bündeten/Gegnern auf der anderen Seite, in der Weimarer Republik festgestellt werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbedingungen: Kulturkampf und Milieuabschottung. Determinanten der politischen Kultur des Katholizismus
- Keine Macht den Räten: Der Katholizismus und die Novemberrevolution bis zur Etablierung der Republik
- Auf dem Boden der vollendeten Tatsachen. Die deutschen Katholiken zwischen Reaktion, Verfassungstreue und echtem Republikanismus
- Christuskreuz oder Hakenkreuz? Politische Kultur im Angesicht des Nationalsozialismus
- Fazit: Die politischen Kultur des Katholizismus zwischen Wandel und Kontinuität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die politische Kultur des Katholizismus in der Weimarer Republik (1918-1933). Sie analysiert die Einstellungen und Mentalitäten des katholischen Volksteils gegenüber Republik und Demokratie, untersucht die Entwicklung der Zentrumspartei als parlamentarischen Arm des Katholizismus und die Interaktion des katholischen Milieus mit anderen republikanischen Parteien und ihren Sozialmilieus.
- Determinanten der politischen Kultur des Katholizismus vor dem Hintergrund des Kulturkampfes
- Die Rolle des Katholizismus in der Novemberrevolution und der Etablierung der Republik
- Die politische Kultur der Zentrumspartei und des katholischen Milieus im Kontext der Weimarer Republik
- Die Reaktion des Katholizismus auf den Aufstieg des Nationalsozialismus
- Kontinuitäten und Umbrüche der politischen Kultur des Katholizismus in der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Problem der politischen Kultur in der Weimarer Republik dar und führt die Forschungsfrage ein: Wie sah die politische Kultur des katholischen Volksteils im Kontext der Weimarer Republik aus?
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den historischen und kulturellen Determinanten der politischen Kultur des Katholizismus. Dabei wird der Kulturkampf des 19. Jahrhunderts als prägender Faktor für die Entwicklung der katholischen Kultur und Politik in Deutschland beleuchtet.
- Das dritte Kapitel untersucht die Rolle des Katholizismus in der Novemberrevolution und der Etablierung der Republik. Es wird analysiert, wie die Katholiken auf den Sturz der Monarchie reagierten und welche Positionen sie gegenüber der neu entstandenen Republik einnahmen.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der politischen Kultur des Katholizismus in der Weimarer Republik. Es werden die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Zentrumspartei und ihre Beziehungen zu anderen republikanischen Parteien untersucht.
- Das fünfte Kapitel analysiert die politische Kultur des Katholizismus im Angesicht des Nationalsozialismus. Es wird untersucht, wie die Katholiken auf den Aufstieg der NSDAP reagierten und welche Positionen sie gegenüber dem Nationalsozialismus einnahmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der politischen Kultur des Katholizismus in der Weimarer Republik, unter Einbezug von Themen wie Kulturkampf, Zentrumspartei, Novemberrevolution, Republik, Demokratie, Nationalsozialismus, und Kontinuitäten und Umbrüchen.
- Quote paper
- Florian Sanden (Author), 2009, Die politische Kultur des Katholizismus zur Zeit der Weimarer Republik 1918-1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/176729