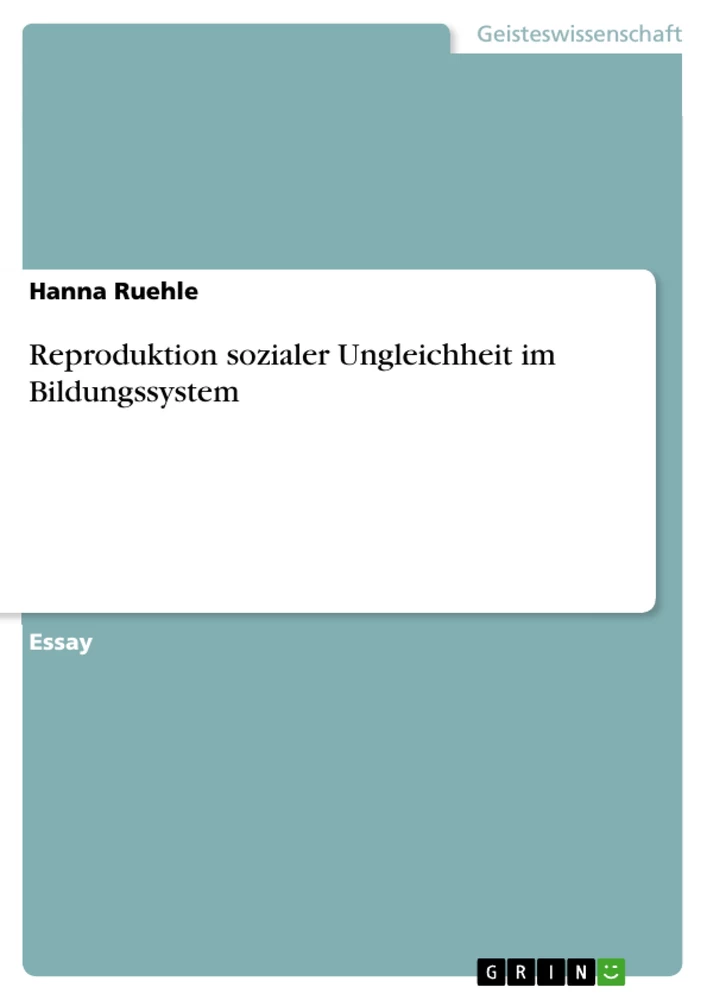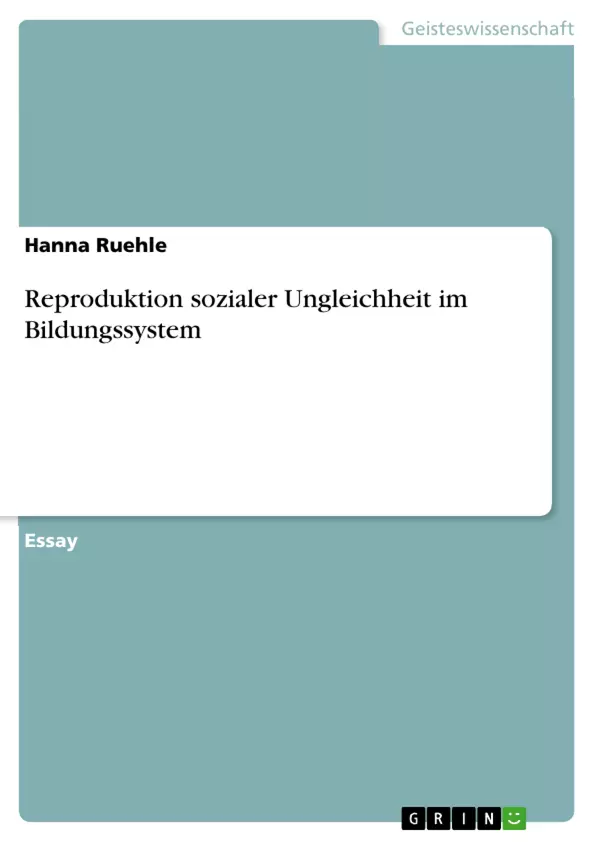Ein enger Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem erzielten Schulerfolg ist nicht mehr zu leugnen, so wiesen auch verschiedene Studien, so beispielsweise PISA, in den letzten Jahren immer wieder nach, dass das Bildungssystem in die Reproduktion, also die ständige Wiederherstellung sozialer Ungleichheit, involviert ist (vgl. Gill 2008, S.40). Zwar führte die Bildungsreform der 1960-er dazu, dass mehr Menschen an der Bildung teilhaben können, jedoch geht damit keine reell existierende Chancengleichheit aller Schüler, unabhängig ihrer Herkunft, einher: So müssen die „Leistungen von Kindern bildungsschwacher Familien […] um 50% höher liegen, um eine Empfehlung für das Gymnasium zu erhalten, als die Leistungen von Kindern bildungsstarker Familien“ (Otto/Schrödter 2008, S.56). Hierzulande entscheidet der Lehrer (mit den Eltern gemeinsam) über den schulischen Weg des Kindes nach der Grundschulzeit. Diese Tatsache führt neben den schulischen Leistungen der Lernenden dazu, dass Schüler aus sozial benachteiligten Familien erheblich schlechtere Chancen haben, ein Gymnasium zu besuchen als beispielsweise Beamtenkinder: „Lehrer reagieren (unterbewusst) oft positiver auf den Habitus von Kindern aus Mittel- und Oberschicht, und zwar unabhängig von deren Begabungen […]. In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass Kinder von Eltern mit niedrigerem Bildungsstand sehr viel bessere Leistungen aufweisen müssen, um die Übergangsempfehlung zum Gymnasium zu erhalten, als Kinder von Eltern mit gehobenen Bildungstiteln“ (Gill 2008, S.50).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. Sie beleuchtet die engen Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und analysiert die Mechanismen, die diese Ungleichheit perpetuieren.
- Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Einfluss von Familienkonstellationen auf den Bildungsverlauf
- Kritik am dreigliedrigen Schulsystem und dessen Rolle bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Mögliche Ansätze zur Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungssystem
- Theorien von Bourdieu, Boudon und Esser zur Erklärung von Bildungsungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem dar und führt in die Problematik ein.
2. Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem
Dieses Kapitel beleuchtet die engen Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Es präsentiert empirische Studien, die den Einfluss des familiären Hintergrunds auf den schulischen Werdegang belegen. Das Kapitel analysiert die Rolle von Elternhaus, Bildungskapital und gesellschaftlichen Strukturen im Hinblick auf die Benachteiligung sozial schwächerer Milieus. Des Weiteren werden die Ursachen und Auswirkungen der sozialen Segregation im Bildungssystem aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Reproduktion, Bildungserfolg, soziale Herkunft, Familienkapital, kulturelles Kapital, ökonomisches Kapital, dreigliedriges Schulsystem, Selektion, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, soziale Segregation, Stigmatisierung, Rational-Choice-Theorie.
- Quote paper
- Hanna Ruehle (Author), 2010, Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/176167