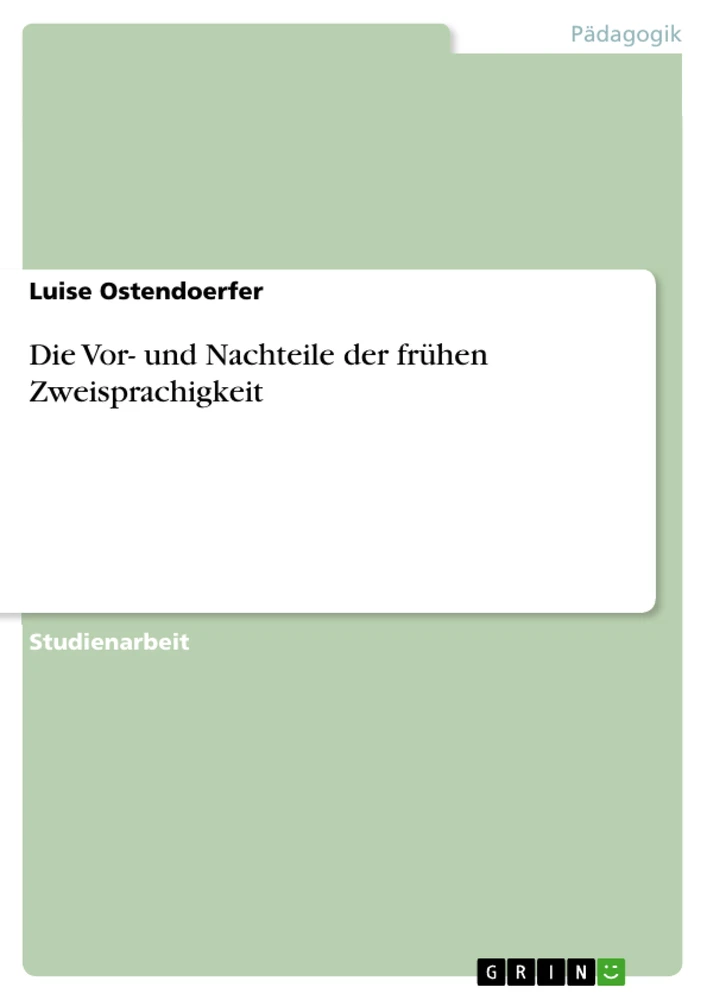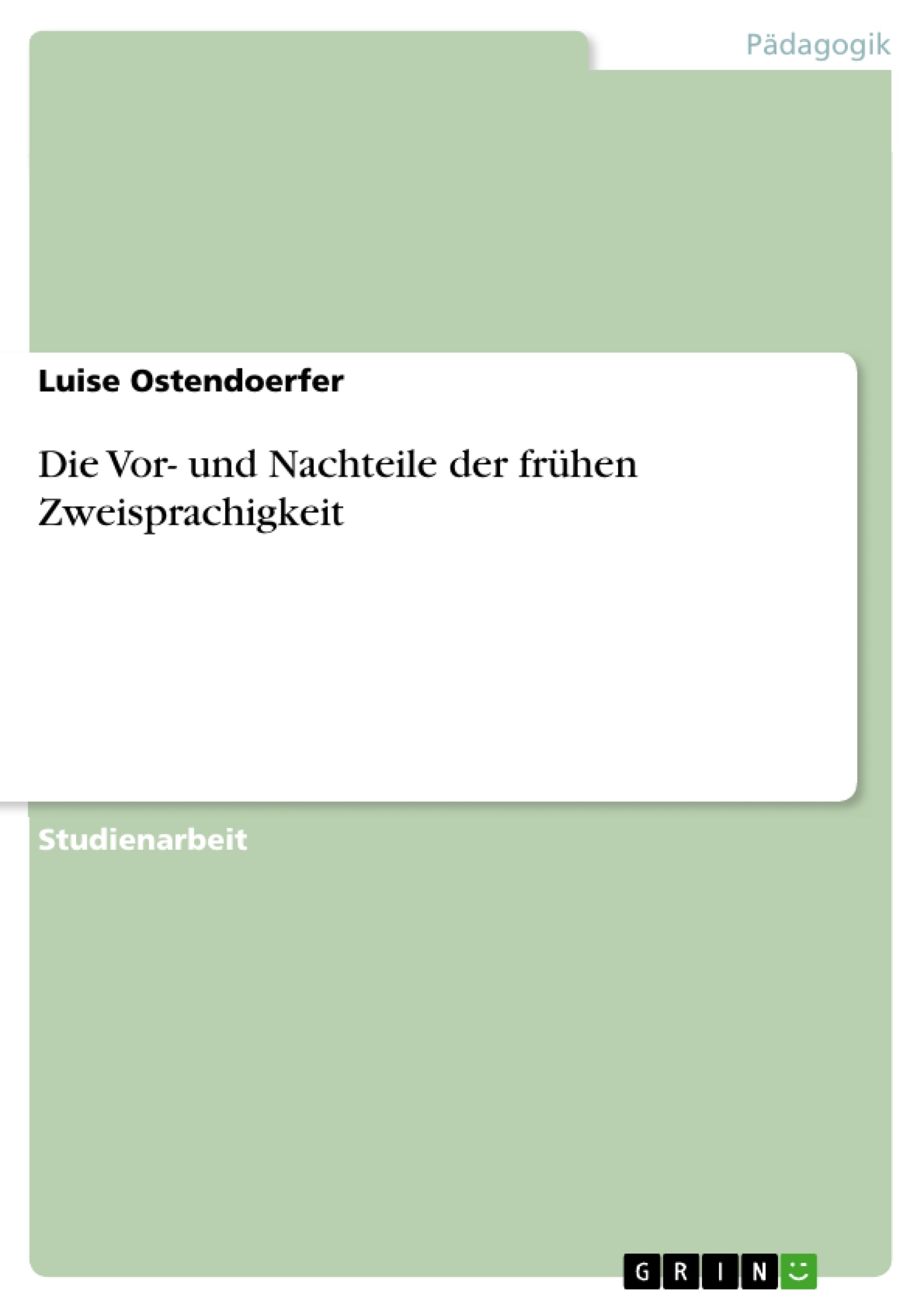Dieses Referat bezieht sich auf das Seminar „Mehrsprachigkeit und Fremdsprachenunterricht“, in dem wir uns mit Begriffen und Konzepten rund um die Mehrsprachigkeit, psycholinguistischen Theorien zur Sprachverarbeitung und zweisprachiger Erziehung beschäftigt haben.
In meinem mündlich vorgetragenen Referat handelte es sich um die Zweisprachigkeit in den Sprachen Deutsch und Vietnamesisch. Anhand einer Praxisphase, durchgeführten Interviews und expliziten Beobachtungen war es meine Absicht einige Vor- und Nachteile von Zweisprachigkeit zu entdecken. Da meines Erachtens aber nur diejenigen eine Aussage darüber machen können, welche die Zweisprachigkeit beherrschen, waren die persönlichen Interviews wertvoller für mich als jegliche Behauptungen von Wissenschaftlern. Ähnlich wie in meinem mündlichen Referat, welches ich im Seminar vorstellte, beschäftige ich mich in der folgenden Arbeit mit den Vor- und Nachteilen von Zweisprachigkeit aus subjektiver und objektiver Sicht. Dabei lasse ich meine Interviewergebnisse nochmals mit einfließen und stelle Bezüge zur Literatur her. Dazu ist zu sagen, dass meine Interviewpartner ausschließlich in einsprachigen Familien aufgewachsen sind, dennoch im frühen Kindesalter mit der Zweitsprache Deutsch in Berührung kamen. Es handelt sich um Kinder mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und sich folglich im Kindergarten- oder Schulalter mit der deutschen Sprache beschäftigten.
Ist diese Aneignung von Sprache noch als bilingualer Erstsprachenerwerb oder schon als Zweitsprachenerwerb zu definieren? Gibt es einen Unterschied zwischen Zweitsprachenerwerb im frühsten Kindesalter und Zweitsprachenerwerb im Jugend- bis Erwachsenenalter? Wann ist überhaupt von Zweitsprache und wann von Fremdsprache zu sprechen? All diese Fragen werde ich versuchen im Laufe dieser Arbeit zu klären.
[...]
Zwar werde ich hauptsächlich auf die Vor- und Nachteile von Zweisprachigkeit eingehen, die im Vorschul- und Schulalter erworben wurde, dennoch werden sich Parallelen in der natürlich erworbenen und der künstlich erworbenen Zweisprachigkeit finden. Auch die Frage ob die Zweitsprache Deutsch, erst erlernt im Alter von 3-4 Jahren, auf natürlichem oder künstlichem Wege erworben wird, ist noch unklar. Welche Faktoren spielen hierbei eine Rolle?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sprache als Identitätsbildung
- Was ist Zweisprachigkeit?
- Praxiseinheit
- Vorteile des frühzeitigen Erwerbs einer zweiten Sprache
- Wachsende Zwei-/Mehrsprachigkeit und die Vorteile
- Individuelle Zweisprachigkeit
- Nachteile der Zweisprachigkeit?!
- Wann wird von Zweitsprache, wann von Fremdsprache gesprochen?
- Bilingualer Erstsprachenerwerb vs. Früher Zweitsprachenerwerb
- Empirische Untersuchungsergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat analysiert die Vorteile und Nachteile der Zweisprachigkeit, insbesondere im Kontext des Erwerbs der deutschen Sprache durch Kinder mit Migrationshintergrund. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen der Zweisprachigkeit im schulischen Umfeld und beleuchtet die Bedeutung der Sprache für die Identitätsbildung.
- Die Bedeutung von Sprache für die Identitätsbildung
- Definition und Abgrenzung von Zweisprachigkeit
- Praxisbeispiele aus der Arbeit mit Migrantenkindern
- Vorteile des frühzeitigen Erwerbs einer zweiten Sprache
- Herausforderungen und Nachteile der Zweisprachigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt den Kontext des Seminars „Mehrsprachigkeit und Fremdsprachenunterricht“ und die Relevanz der Zweisprachigkeit in der heutigen Gesellschaft dar. Die Autorin erläutert ihre persönlichen Beweggründe für die Beschäftigung mit diesem Thema und skizziert den Ansatz ihrer Untersuchung.
- Die Sprache als Identitätsbildung: Dieses Kapitel beleuchtet die enge Verbindung zwischen Sprache und Identität und stellt die Frage nach den Auswirkungen von Zwei- oder Mehrsprachigkeit auf die menschliche Entwicklung.
- Was ist Zweisprachigkeit?: Der Text diskutiert verschiedene Definitionen von Zweisprachigkeit und setzt sich mit der Frage auseinander, welche Sprachkenntnisse notwendig sind, um als zweisprachig zu gelten. Die Autorin bezieht sich dabei auf verschiedene wissenschaftliche Ansätze und eigene Beobachtungen aus ihrer Praxisphase.
- Praxiseinheit: Dieses Kapitel beschreibt die Erfahrungen der Autorin während ihrer Arbeit mit Migrantenkindern im Arbeitskreis ausländischer Kinder (AKAK) in Hameln. Sie schildert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Arbeit mit zweisprachigen Kindern ergeben.
- Vorteile des frühzeitigen Erwerbs einer zweiten Sprache: Der Text beleuchtet die positiven Effekte des frühen Zweitsprachenerwerbs auf verschiedene kognitive Fähigkeiten und die Sprachentwicklung von Kindern.
- Wachsende Zwei-/Mehrsprachigkeit und die Vorteile: Dieses Kapitel setzt sich mit dem wachsenden Anteil zweisprachiger Menschen in der heutigen Gesellschaft auseinander und analysiert die Vorteile von Mehrsprachigkeit für Individuen und die Gesellschaft.
- Individuelle Zweisprachigkeit: Der Text betrachtet die verschiedenen Formen der Zweisprachigkeit und setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich die Art und Weise des Spracherwerbs auf die individuellen Fähigkeiten und die sprachliche Entwicklung auswirken.
- Nachteile der Zweisprachigkeit?!: Dieses Kapitel thematisiert mögliche Nachteile der Zweisprachigkeit und geht auf Kritikpunkte und Bedenken ein, die im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit geäußert werden.
- Wann wird von Zweitsprache, wann von Fremdsprache gesprochen?: Der Text diskutiert die Unterschiede zwischen Zweit- und Fremdsprachen und stellt die Frage nach der Abgrenzung zwischen beiden Begriffen.
- Bilingualer Erstsprachenerwerb vs. Früher Zweitsprachenerwerb: Dieses Kapitel setzt sich mit den Unterschieden zwischen dem bilingualen Erstsprachenerwerb und dem frühen Zweitsprachenerwerb auseinander und analysiert die Besonderheiten beider Lernprozesse.
- Empirische Untersuchungsergebnisse: Der Text stellt ausgewählte empirische Forschungsergebnisse zur Zweisprachigkeit vor und beleuchtet die wissenschaftliche Grundlage für die Diskussion über die Vor- und Nachteile von Mehrsprachigkeit.
Schlüsselwörter
Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, Identitätsbildung, Sprache, Migranten, Sprachentwicklung, Spracherwerb, bilingualer Erstsprachenerwerb, früher Zweitsprachenerwerb, Vor- und Nachteile, empirische Forschung, Praxisphase.
- Quote paper
- Luise Ostendoerfer (Author), 2009, Die Vor- und Nachteile der frühen Zweisprachigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/175933