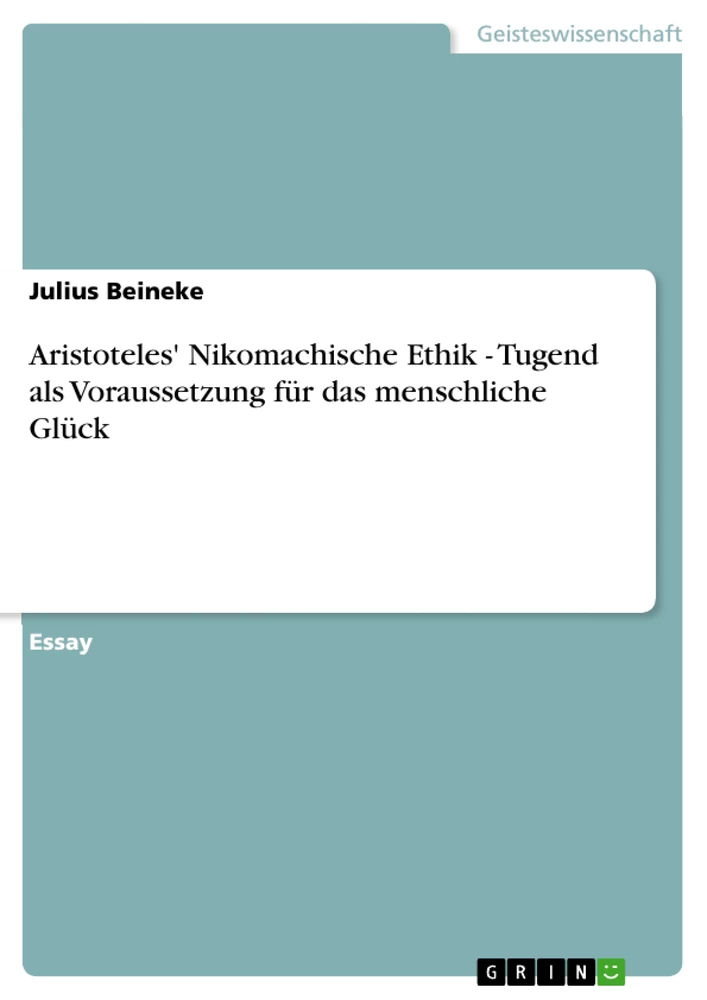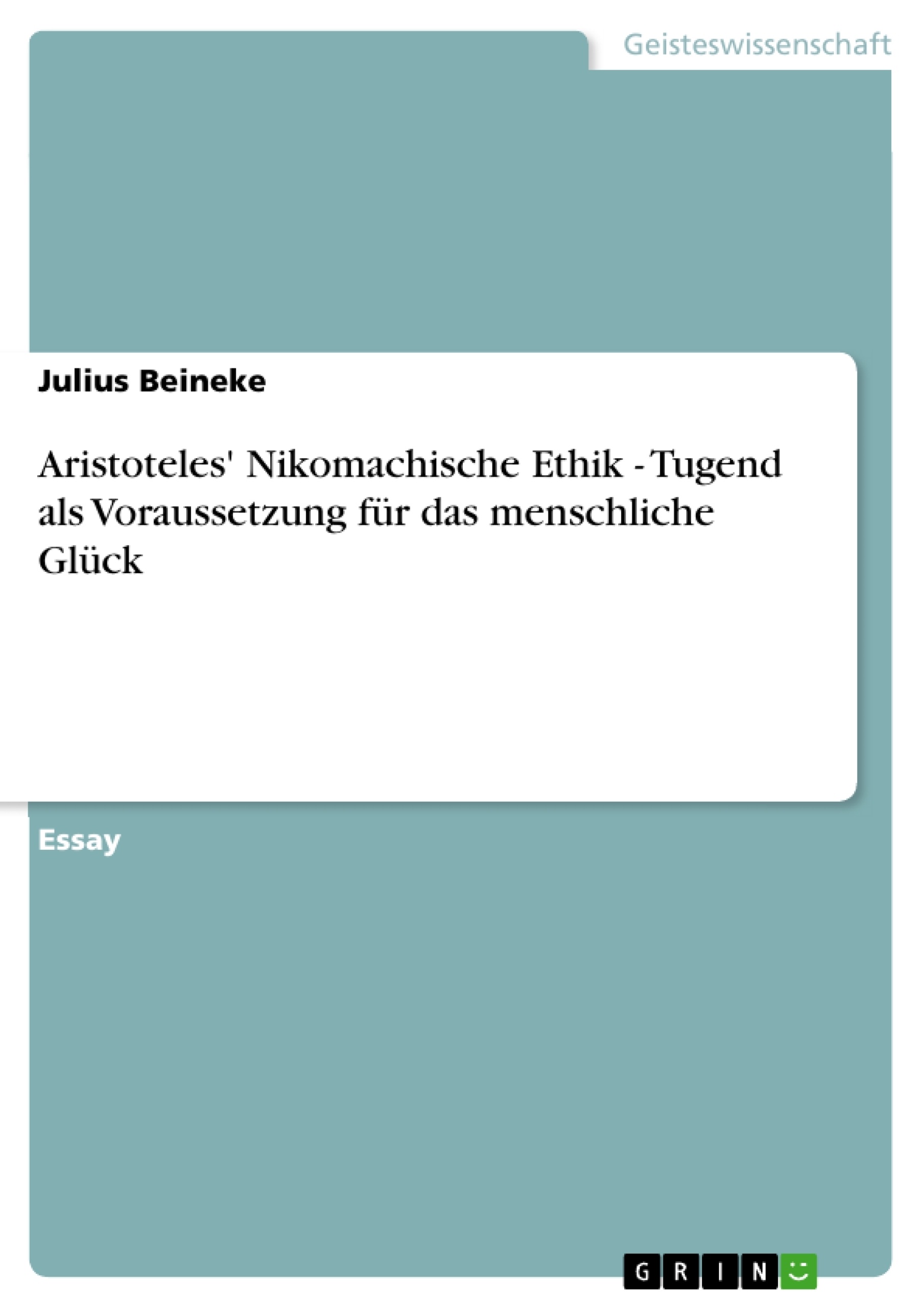Kurze Auseinandersetzung mit Aristoteles' Nikomachischer Ethik. Behandelt und erläutert wird Aristoteles' Modell einer "Tugendethik" die als Anleitung und, bei "Befolgung", als Weg zu einem glücklichen Leben dienen kann und soll.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1 Einleitung
- II. Das Glück als höchstes menschliches Gut
- a. Definition
- b. Voraussetzungen für das menschliche Glück
- III. Die charakterliche Tugend
- a. Gutheit des Denkens - Gutheit des Charakters
- b. Die Tugend als Mitte
- IV. Schlussfolgerung: Die Tugend als Voraussetzung für das menschliche Glück
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Aristoteles' Nikomachische Ethik beschäftigt sich mit der Definition des menschlichen Glücks und der Bedeutung der Tugend für dessen Erreichung. Das Werk analysiert das Glück als höchstes menschliches Gut und untersucht dessen Voraussetzungen, wobei die Tugend als entscheidender Faktor für ein glückliches Leben hervorgehoben wird. Die Verbindung von Glück und Tugend steht im Zentrum der Ausführungen.
- Das Glück als höchstes menschliches Gut
- Die Definition der Tugend
- Die Rolle der Tugend für die Glückseligkeit
- Die Bedeutung des tugendhaften Lebens
- Die Beziehung zwischen inneren und äußeren Faktoren für das menschliche Glück
Zusammenfassung der Kapitel
In der Einleitung stellt Aristoteles die Frage nach dem höchsten menschlichen Gut und der Funktion des Menschen. Das Glück wird als das Ziel des menschlichen Lebens identifiziert, dessen Erreichung durch ein tugendhaftes Leben und „passende“ äußere Umstände ermöglicht wird.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Definition des Glücks als höchstes Gut. Aristoteles argumentiert, dass das Glück das abschließende Ziel allen Strebens darstellt und als selbstgenügsam betrachtet werden kann, da es allein das Leben lebenswert machen würde.
Im dritten Kapitel wird die Bedeutung des tugendhaften Lebens für die Erreichung der Glückseligkeit hervorgehoben. Aristoteles beschreibt die Tugend als Mittel zwischen zwei Extremen und betont die Notwendigkeit eines Lebens, das von guter und angemessener Handlung geprägt ist.
Schlüsselwörter
Die Nikomachische Ethik befasst sich mit den zentralen Begriffen Glück, Tugend, Vernunft, Gutheit, menschliches Handeln und Lebensführung. Aristoteles untersucht die Funktion des Menschen und die Bedingungen für ein erfülltes Leben. Die Analyse der Tugend als Voraussetzung für das menschliche Glück bildet den Kern des Werkes. Die Verbindung von inneren und äußeren Faktoren für das Glück wird ebenfalls untersucht.
- Quote paper
- Julius Beineke (Author), 2011, Aristoteles' Nikomachische Ethik - Tugend als Voraussetzung für das menschliche Glück, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/174945