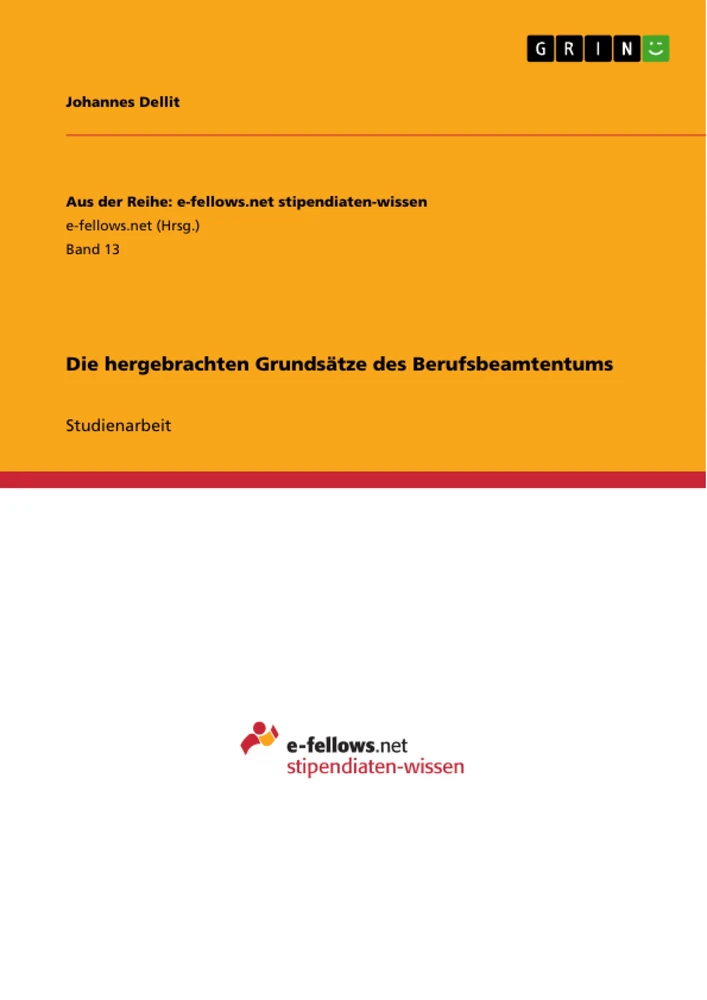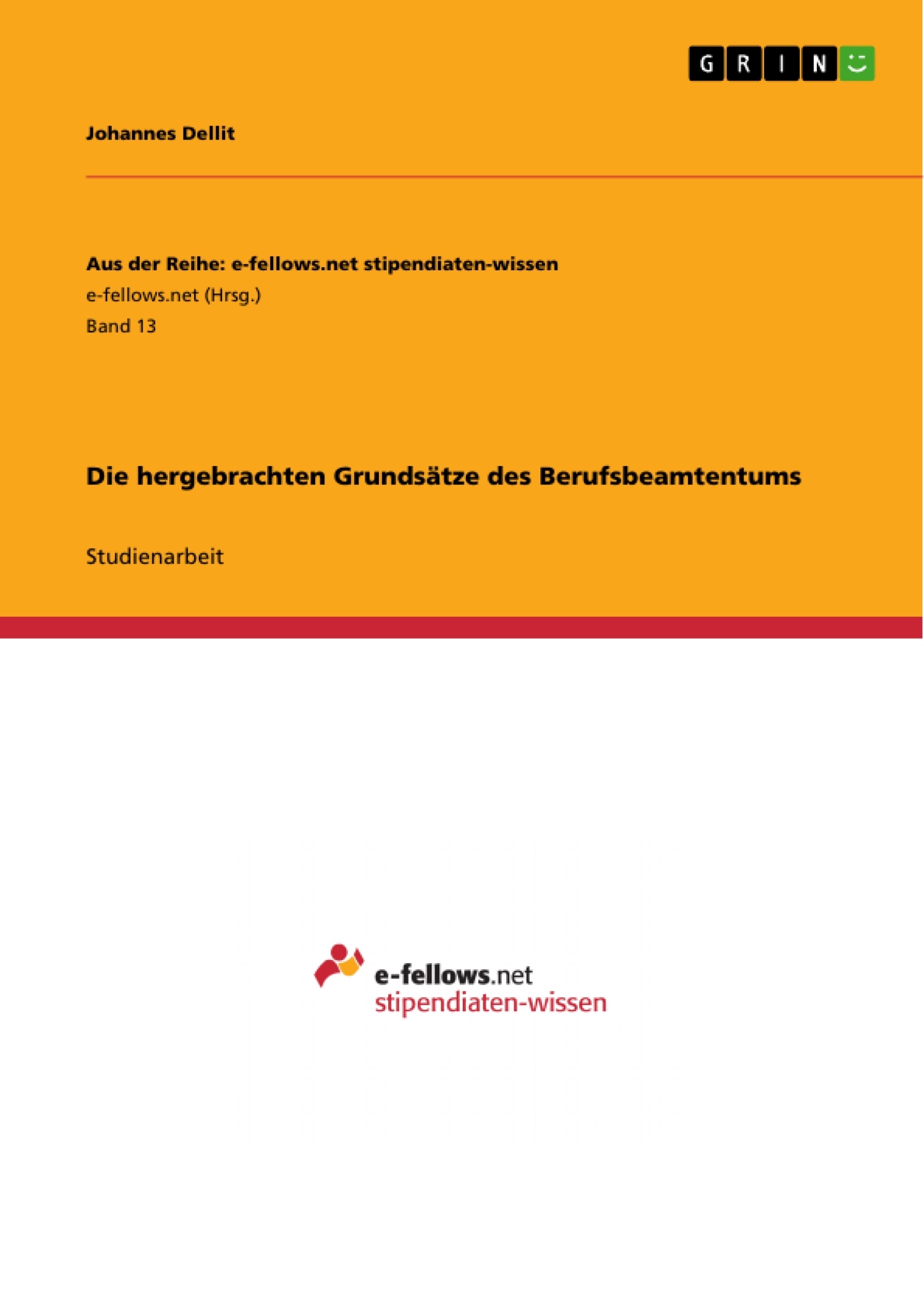In der vorliegenden Ausarbeitung werden die im Rahmen des Art. 33 V GG formulierten „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ zu untersuchen sein.
Begonnen werden soll dabei mit einem historischen Kurzüberblick, der die Frage anreißen soll, weshalb das GG überhaupt an das „hergebrachte Berufsbeamtentum“ anknüpft und der im Folgenden die hier interessierende Verfassungsänderung von 2006 in Bezug auf die Änderung des Wortlauts von Art. 33 V GG darstellt. Dies beides erscheint notwendig, um begreifen zu können, welchen konkreten Inhalt der Vorschrift heute beigemessen werden kann.
Daran sich anschließen wird sich die Frage nach dem tatsächlichen Regelungsgehalt von Art. 33 V GG.
In der weiteren Abfolge sollen die wichtigsten Ausprägungen der „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ erläutert werden. Dieser letzte Punkt soll, nicht zuletzt wegen einer reichen Kasuistik und damit praktisch zwingend einhergehenden kritischen Auseinandersetzungen im Schrifttum, den Schwerpunkt der Arbeit bilden.
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Ausarbeitung
- Einleitung
- A. Kurzüberblick
- Geschichtlicher Kontext
- Änderung des Wortlauts von Art. 33 V GG im Jahre 2006
- B. Regelungsinhalt
- Systematische Einordnung
- Inhalt
- C. Die wichtigsten Ausprägungen der „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“
- Das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis
- Die Anstellung auf Lebenszeit
- Das Leistungsprinzip
- Das Laufbahnprinzip
- Der Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung
- Das Alimentationsprinzip
- Die Fürsorgepflicht des Dienstherren
- Die Verpflichtung des Beamten zur vollen Hingabe an den Beruf
- D. Als Fazit - Thesen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“, wie sie in Artikel 33 V GG verankert sind. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext dieser Grundsätze, analysiert ihren Regelungsgehalt und erläutert ihre wichtigsten Ausprägungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Verfassungsänderung von 2006 und deren Auswirkungen auf die Interpretation von Art. 33 V GG.
- Historischer Kontext der „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“
- Analyse des Regelungsinhalts von Art. 33 V GG
- Erläuterung der wichtigsten Ausprägungen der „hergebrachten Grundsätze“
- Auswirkungen der Verfassungsänderung von 2006
- Zusammenhang zwischen den Grundsätzen und dem Europarecht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Aufgabenstellung der Arbeit: die Untersuchung der „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ im Kontext von Art. 33 V GG. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, beginnend mit einem historischen Überblick, gefolgt von der Analyse des Regelungsgehalts und schließlich der Erläuterung der wichtigsten Ausprägungen der Grundsätze. Die Einleitung betont die Notwendigkeit des Verständnisses des historischen Kontextes für die korrekte Interpretation der heutigen Rechtslage.
A. Kurzüberblick: Dieser Abschnitt bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Berufsbeamtentums, beginnend mit dem preußischen Modell des 17. und 18. Jahrhunderts, geprägt von der Vorstellung des Beamten als Teil eines Ganzen, gekennzeichnet durch Gewissenhaftigkeit, Pflichttreue und Sparsamkeit. Der Übergang vom „Fürstendiener“ zum „Staatsdiener“, die Etablierung der Lebenszeitanstellung und des Alimentationsprinzips werden als wichtige Schritte dargestellt. Der Abschnitt schließt mit der Darstellung der Änderung des Wortlauts von Art. 33 V GG im Jahre 2006, die einen Fortentwicklungsauftrag beinhaltet, ohne den tatsächlichen Regelungsgehalt zu verändern.
B. Regelungsinhalt: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem tatsächlichen Regelungsgehalt von Art. 33 V GG. Er analysiert die systematische Einordnung des Artikels im Grundgesetz und untersucht den konkreten Inhalt der Vorschrift. Hier wird der Fokus auf das Verständnis des rechtlichen Rahmens gelegt, innerhalb dessen die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ zu interpretieren sind.
C. Die wichtigsten Ausprägungen der „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“: Dieser zentrale Abschnitt der Arbeit erläutert detailliert die wichtigsten Ausprägungen der „hergebrachten Grundsätze“. Er behandelt das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis, die Anstellung auf Lebenszeit, das Leistungsprinzip, das Laufbahnprinzip, den Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung, das Alimentationsprinzip, die Fürsorgepflicht des Dienstherren und die Verpflichtung des Beamten zur vollen Hingabe an den Beruf. Dieser Abschnitt analysiert die einzelnen Grundsätze im Detail, unter Berücksichtigung der relevanten Rechtsprechung und Literatur.
Schlüsselwörter
Berufsbeamtentum, Art. 33 V GG, Grundgesetz, Hergebrachte Grundsätze, Lebenszeitanstellung, Alimentationsprinzip, Leistungsprinzip, Laufbahnprinzip, Öffentlicher Dienst, Verfassungsänderung 2006, Europarecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: "Hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“, wie sie in Artikel 33 des Grundgesetzes (GG) verankert sind. Sie beleuchtet den historischen Kontext, analysiert den Regelungsgehalt und erläutert die wichtigsten Ausprägungen dieser Grundsätze. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verfassungsänderung von 2006 und deren Auswirkungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen historischen Überblick über die Entwicklung des Berufsbeamtentums, eine detaillierte Analyse des Artikels 33 V GG, die Erläuterung wichtiger Grundsätze wie das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, die Lebenszeitanstellung, das Leistungsprinzip und das Alimentationsprinzip. Der Einfluss der Verfassungsänderung von 2006 und der Zusammenhang mit dem Europarecht werden ebenfalls behandelt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Kurzüberblick (mit geschichtlichem Kontext und der Änderung von Art. 33 V GG im Jahr 2006), die Analyse des Regelungsinhalts von Art. 33 V GG, eine detaillierte Erläuterung der wichtigsten Ausprägungen der „hergebrachten Grundsätze“, und abschließende Thesen. Ein Literaturverzeichnis rundet die Arbeit ab.
Welche sind die wichtigsten „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“?
Zu den wichtigsten Grundsätzen gehören das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis, die Anstellung auf Lebenszeit, das Leistungsprinzip, das Laufbahnprinzip, der Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung, das Alimentationsprinzip, die Fürsorgepflicht des Dienstherren und die Verpflichtung des Beamten zur vollen Hingabe an den Beruf.
Welche Rolle spielt die Verfassungsänderung von 2006?
Die Verfassungsänderung von 2006 wird in der Arbeit hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Interpretation von Artikel 33 V GG untersucht. Es wird dargestellt, ob und wie sich der Wortlaut geändert hat und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berufsbeamtentum, Art. 33 V GG, Grundgesetz, Hergebrachte Grundsätze, Lebenszeitanstellung, Alimentationsprinzip, Leistungsprinzip, Laufbahnprinzip, Öffentlicher Dienst, Verfassungsänderung 2006, Europarecht.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst ein Deckblatt, das Inhaltsverzeichnis selbst, die Ausarbeitung (mit Einleitung, Kurzüberblick, Regelungsinhalt, den wichtigsten Ausprägungen der Grundsätze und einem Fazit), und ein Literaturverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ zu vermitteln, indem sie den historischen Kontext, den Regelungsgehalt und die wichtigsten Ausprägungen dieser Grundsätze analysiert und die Auswirkungen der Verfassungsänderung von 2006 beleuchtet.
- Arbeit zitieren
- Johannes Dellit (Autor:in), 2011, Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/173993