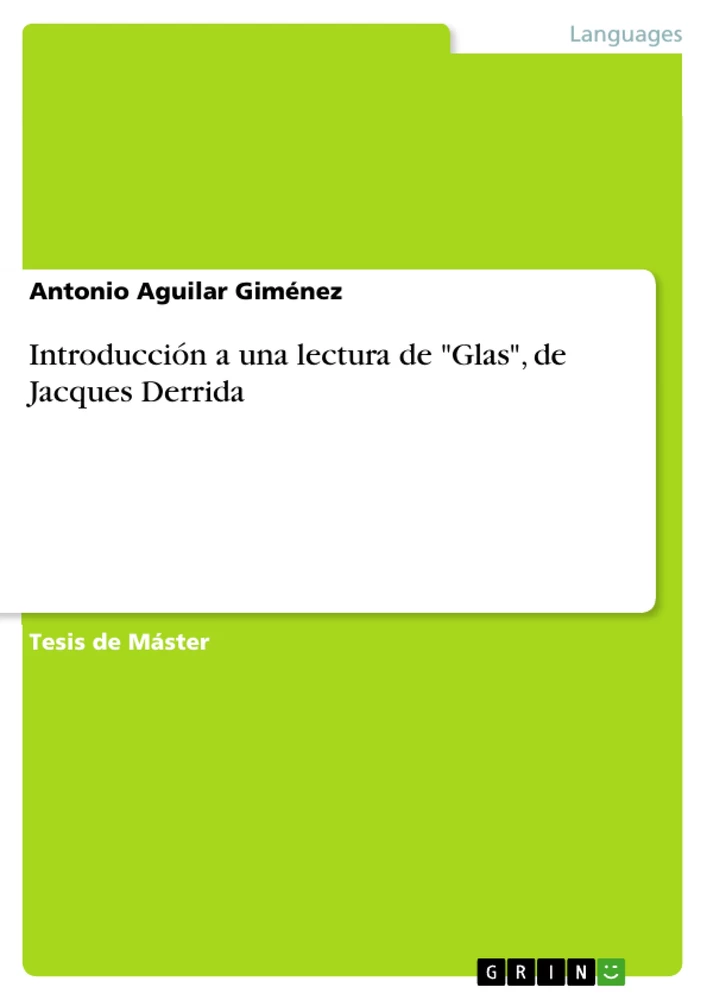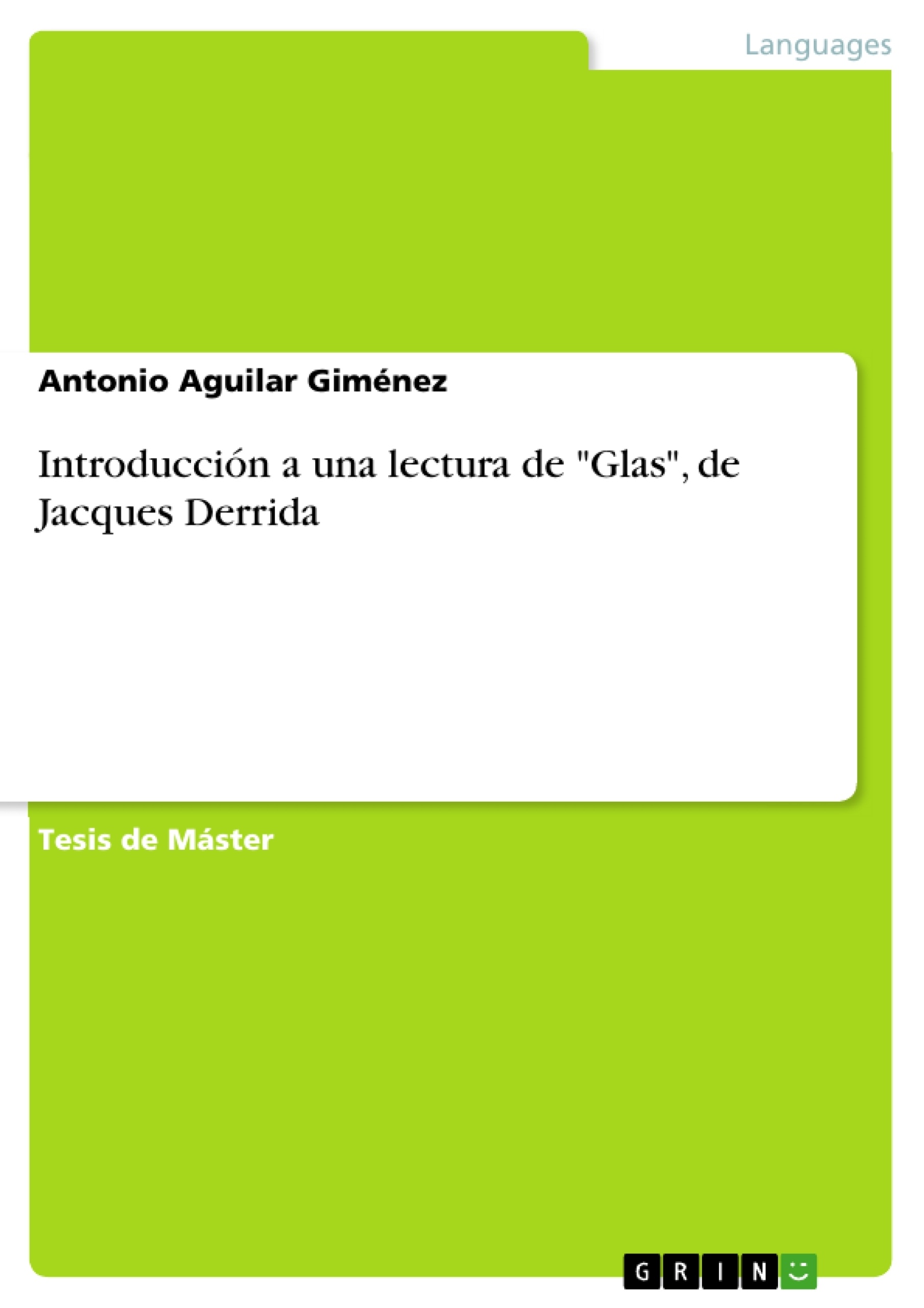Los estudios teóricos estructuralistas dentro de los ámbitos literario-lingüísticos, pronto se ampliaron por los de una nueva hornada de críticos que completaron, abriendo, las pretensiones de sistematización organizativa que habían buscado los primeros. Evidenciaron que los límites mismos que se imponían a los estudios eran límites poco estables, que las relaciones entre disciplinas debían convertirse en necesarias. Síntoma mismo de este principio de debilitamiento de los inventarios sistemáticos del proyecto estructuralista, es el hecho de que no haya unanimidad acerca de qué autores incluir en cada nómina, e incluso qué obras de un mismo autor colocar en cada clasificación. Antologías como la de Harari han pretendido identificar y poner de relieve los principales pensadores del post-estructuralismo; otros estudios, como el realizado por J. Hillis Miller en "Stevens' Rock as Cure" propuso organizar cada movimiento dividiéndolos en “críticos teóricos” y “críticos intuitivos”. La distinción no es del todo clara, como recuerda Culler . Por ejemplo, autores como Barthes hacen problemática la discusión desde el momento en que hay que decidir qué obras de este crítico son consideradas post-estructuralistas o no, y si hay que considerarlo a él mismo como un estructuralista arrepentido. Philip Lewis (The post-estructuralism Condition ) señala que la obra de los primeros estructuralistas va asumiendo conciencia crítica hacia su propio proyecto. Desde sus orígenes, en el interior de la empresa estructuralista se problematizan algunos puntos de partida del sistema que se pretende organizar, y desde allí, se construye el propio edificio teórico; los post-estructuralistas continuarán sus escritos reconsiderando algunos principios ya estudiados. El trabajo post-estructuralista es un trabajo de continuación, y al mismo tiempo de desautorización; un lugar de posturas reformuladoras del trabajo realizado en la tapa precedente.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- Kapitel 1. Über die Dekonstruktion
- 1.1. Die différance
- 1.2. Quasi-Konzepte
- 1.3. Dekonstruktive Praxis
- Kapitel 2. Glas und das Buch
- 2.1. Das Buch und die Tradition
- 2.2. Maurice Blanchot und das Buch
- 2.2.1. Die Zeit des Buches. Die Zeit des Werkes
- 2.2.2. Literatur und Philosophie als Raum
- 2.3. Der Autor und die Signatur des Buches
- 2.4. Das lineare Buch
- 2.5. Drei Annäherungen von Jacques Derrida an die Frage des Buches
- 2.5.1. Das Buch und die Totalität
- 2.5.1.1. Das Zentrum
- 2.5.1.2. Metaphern des Textes als Totalität
- 2.5.1.3. Die "Archieschrift" und der Raum der "Spur"
- 2.5.2. Das platonische Buch
- 2.5.2.1. Die Malerei und die Schrift
- 2.5.2.2. Mimesis und Zeichen
- 2.5.1. Das Buch und die Totalität
- Kapitel 3. Die Doppelband und Glas
- 3.1. Die Grenze in der Doppelband
- 3.2. Der Raum der Grenze
- 3.2.1. Bataille und die Grenztexte
- 3.3. Philippe Sollers. Die Erfahrung der Grenzen
- 3.4. Hegel und die Grenze
- 3.5. Der Rahmen der Theorie
- 3.6. Die doppelte Spalte
- 3.6.1. Die Spalte und die Repräsentation
- 3.6.2. Deleuze und die zwei Reihen
- 3.6.3. Unentscheidbares
- Kapitel 4. Glas: Arbeit und Theorie
- 4.1. Paul de Man Theorie und Arbeit
- 4.2. Die Theorie als Spiel
- 4.3. Spekulativ Theorie
- 4.4. Spekulativ Theorie und Rhetorik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch befasst sich mit der Dekonstruktion und ihrer Anwendung auf das Werk "Glas" von Jacques Derrida. Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen theoretischen Konzepte der Dekonstruktion zu erläutern und zu zeigen, wie sie sich in der Analyse eines literarischen Textes manifestieren.
- Dekonstruktion als Methode der Textanalyse
- Die Rolle des Buches und der Schrift in der Dekonstruktion
- Die Grenzen und der Raum der Sprache
- Die Beziehung zwischen Theorie und Praxis in der Dekonstruktion
- Die Rezeption von "Glas" und seine Bedeutung für die Literaturwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die grundlegenden Konzepte der Dekonstruktion eingeführt, wie beispielsweise die "différance" und die "quasi-Konzepte". Die Arbeit zeigt, wie die Dekonstruktion klassische metaphysische Konzepte in Frage stellt und eine neue Lesart von Texten ermöglicht. Das zweite Kapitel widmet sich der Analyse von "Glas" als Text und als Buch. Derrida untersucht dabei die Bedeutung des Buches als Medium der Schrift, die Rolle des Autors und die verschiedenen Formen, in denen sich die Sprache als "archieschrift" manifestiert. Das dritte Kapitel beleuchtet die "Doppelband" als Metapher für die Grenzen und den Raum der Sprache. Derrida analysiert die Grenzen der Sprache und zeigt, wie diese durch die Dekonstruktion aufgebrochen werden. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Beziehung zwischen Theorie und Praxis in der Dekonstruktion. Derrida zeigt, wie die Dekonstruktion als theoretisches Konzept gleichzeitig auch eine Praxis der Lesung und Interpretation ist.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Buches sind: Dekonstruktion, "différance", "quasi-Konzepte", Glas, Buch, Schrift, Sprache, Grenze, Theorie, Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Jacques Derridas "Glas"?
"Glas" ist ein dekonstruktives Werk, das in zwei parallelen Spalten Texte von Hegel und Genet gegenüberstellt, um die Grenzen von Philosophie, Literatur und Sprache zu hinterfragen.
Was bedeutet der Begriff "différance" bei Derrida?
Es ist ein zentrales Konzept der Dekonstruktion, das sowohl das "Aufschieben" von Bedeutung als auch das "Sich-Unterscheiden" beschreibt und zeigt, dass Sprache nie eine feste Präsenz hat.
Warum verwendet Derrida in "Glas" zwei Spalten?
Die Doppelspalte bricht die lineare Lesart des traditionellen Buches auf und zwingt den Leser, die Wechselwirkungen und unentscheidbaren Grenzen zwischen den Texten wahrzunehmen.
Wie kritisiert Derrida den Begriff des "Buches"?
Derrida sieht im "Buch" eine Form der Totalität, die versucht, Wissen abzuschließen. Er setzt dem die "Schrift" oder "Spur" entgegen, die immer offen und grenzüberschreitend bleibt.
Welche Rolle spielt Hegel in Derridas Analyse?
Hegel repräsentiert die Spitze der abendländischen Metaphysik und Systematik. Derrida dekonstruiert Hegels Begriffe von Familie und Staat, indem er sie mit Genets literarischer Transgression konfrontiert.
- Quote paper
- Antonio Aguilar Giménez (Author), 1998, Introducción a una lectura de "Glas", de Jacques Derrida, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/173680