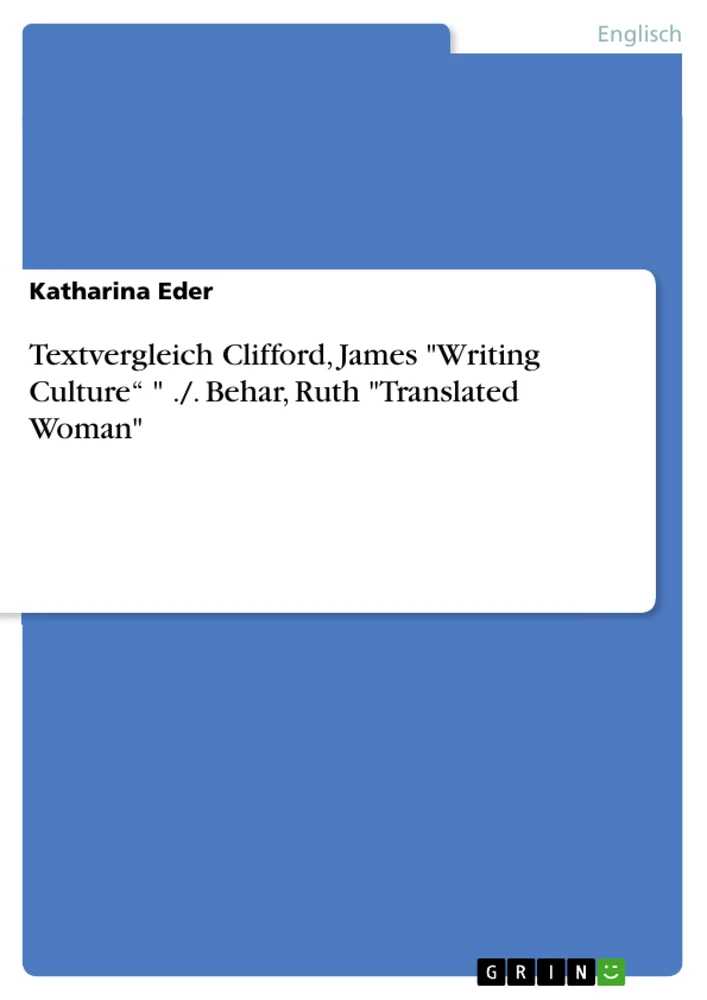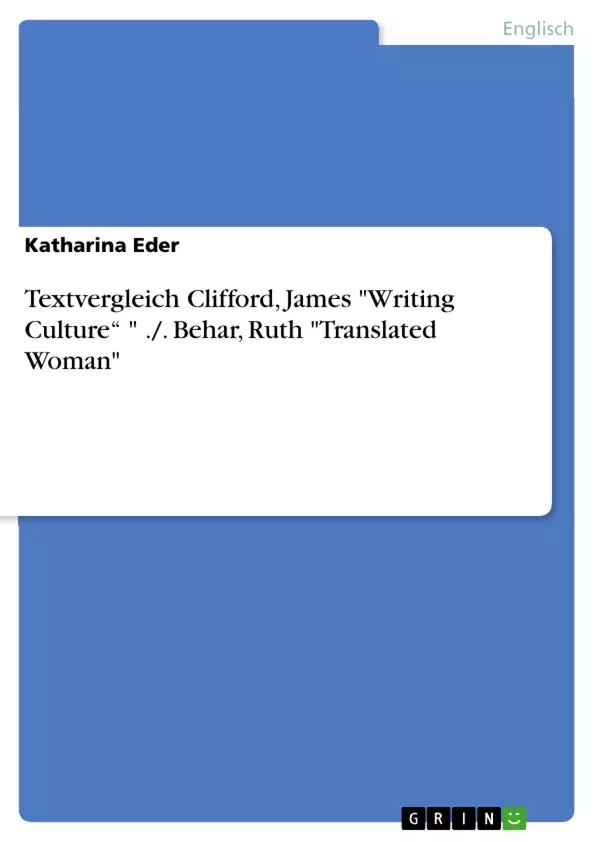Clifford´s Werk „Writing Culture“ basiert auf dem Hintergrund, dass literarische Zugänge und deren Reflexion in den letzten Jahren in den Human-und Sozialwissenschaften zunehmend „beliebter“, und die Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst zunehmend geringer wird. Ethnographie ist zwischen mächtigen Bedeutungssystemen eingebettet und paradoxerweise selbst Teil der Prozesse die sie beschreibt. Die Hauptaussage von Clifford besteht in der vorerst scheinbar paradoxen Aussage, dass ethnographische Wahrheiten Fiktionen sind, die sich als inhärent partiell und unvollständig erweisen. Interessant dabei ist die Tatsache, dass „Wahrheit als Fiktion“ für Clifford nicht negativ behaftet ist, wie vorerst vermutet werden könnte. Vielmehr sieht er in einer Darstellung von Ethnographie als „partielle Wahrheit“ eine Art Liberation der Dargestellten aus einer Abbildung als abgeschottete, statische und in sich geschlossene „Objekte“.
Inhaltsverzeichnis
- Clifford's Werk „Writing Culture“
- Ethnographie als Fiktion und partielle Wahrheit
- Einflussfaktoren ethnographischen Schreibens
- Die Krise der Anthropologie
- Herausforderungen der Poesie von Ethnographie
- Macht und Ethnographie
- Teilnehmende Beobachtung und selbstreflexive Schreibweise
- Gender-Problematik in der Produktion von Ethnographien
- Ruth Behar und ihr Werk „Translated Woman“
- „The talking serpent“: Entstehungsprozess und Thematik
- Multiplen Rollen des Ethnographen und Reduktion von Realität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Ansätze von James Clifford und Ruth Behar zum Thema ethnographisches Schreiben. Ziel ist es, die zentralen Argumente beider Autoren zu analysieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Ethnographie als Fiktion und partieller Wahrheit, den Herausforderungen der Poesie von Ethnographie sowie der Rolle von Macht und Gender in ethnographischen Praktiken.
- Ethnographie als Fiktion und partielle Wahrheit
- Machtverhältnisse und ihre Auswirkung auf ethnographisches Schreiben
- Gender und kulturelle Repräsentationen
- Selbstreflexivität und die Rolle des Ethnographen
- Die Herausforderungen des Schreibprozesses in der Ethnographie
Zusammenfassung der Kapitel
Clifford's Werk „Writing Culture“: Der Text analysiert Clifford's Werk „Writing Culture“, das den zunehmenden Einfluss literarischer Zugänge in den Human- und Sozialwissenschaften thematisiert. Clifford argumentiert, dass ethnographische Wahrheiten als partielle und unvollständige Fiktionen zu verstehen sind – eine Sichtweise, die er nicht als negativ, sondern als befreiend für die Dargestellten betrachtet. Er identifiziert Kontextualität, Rhetorik, Institutionen, Gattung, Politik und Geschichte als Einflussfaktoren ethnographischen Schreibens, die von Macht und Geschichte geprägt sind und die der Ethnograph nicht vollständig kontrollieren kann. Die Arbeit betont den interdisziplinären und variablen Charakter des Feldes.
Ethnographie als Fiktion und partielle Wahrheit: Dieser Abschnitt vertieft Clifords These der Ethnographie als partielle Wahrheit und Fiktion. Die vermeintliche Paradoxie wird aufgelöst, indem "Fiktion" nicht als Gegenteil von Wahrheit, sondern als "wahre Fiktion" interpretiert wird, die zwar konstruiert ist, aber dennoch Gültigkeit beansprucht. Die Diskussion kreist um die Abkehr von einer umfassenden Wahrheit hin zu einer Anerkennung von partiellen Wahrheiten und die damit verbundenen Herausforderungen im Kontext der Anthropologie. Die Ängste vor kulturellem Relativismus werden thematisiert.
Macht und Ethnographie: Hier wird Clifords Argumentation fortgeführt, indem er die Rolle von Macht in ethnographischen Praktiken beleuchtet. Die Ambivalenz der Machtverhältnisse in ethnographischen Prozessen wird diskutiert und gezeigt, wie ethnographische Praktiken stets von wechselnden Machtunterschieden geprägt sind. Es wird auf den Verlust der automatischen Autorität der Anthropologie über "die Völker ohne Geschichte" hingewiesen. Die hermeneutische Philosophie wird herangezogen, um die willkürlichen Intentionen kultureller Aufzeichnungen zu betonen und die Selbstkonstruktion der Interpreten im Prozess des „Studierens“ zu unterstreichen. Beispiele aus der Literatur, u.a. Said’s „textualisierte Konstruktion des Orients“, werden zur Veranschaulichung verwendet.
Teilnehmende Beobachtung und selbstreflexive Schreibweise: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der teilnehmenden Beobachtung, insbesondere mit dem Wandel in der Balance zwischen Subjektivität und Objektivität. Der Bruch in den 1960er Jahren, die entstehende selbstreflexive Schreibweise und das Konzept der „Vielstimmigkeit“, die die Stimmen der bisher „Unerhörten“ stärker einbezieht, werden ausführlich dargestellt. Die Diskussion verweist auf die Arbeiten von Malinowski und Lienhardt.
Ruth Behar und ihr Werk „Translated Woman“: Dieser Abschnitt stellt Ruth Behar und ihr Werk "Translated Woman" vor. Behar's anthropologischer Ansatz wird als humanistisches Streben, die Poesie des menschlichen Lebens auszudrücken, charakterisiert. Die Bedeutung literarischer Beiträge in der Anthropologie wird betont, und Behars Engagement für ein kreatives ethnographisches Schreiben wird hervorgehoben. Der Bezug zu Clifords "Writing Culture" und die gemeinsamen Themen werden hergestellt.
„The talking serpent“: Entstehungsprozess und Thematik: Hier wird Behars Einleitung zu ihrem Buch "Translated Woman" und der Entstehungsprozess, ihre Beziehung zu Esperanza, detailliert beschrieben. Die Darstellung beleuchtet Machtstrukturen, Identitätsfragen und Emotionen. Der textuelle Aspekt ethnographischer Details und die Problematik fixierter Genres werden diskutiert. Mythische Symboliken werden in einen zeitgenössischen Kontext gesetzt.
Multiplen Rollen des Ethnographen und Reduktion von Realität: Dieser Abschnitt behandelt die multiplen Rollen des Ethnographen und die unvermeidliche Reduktion von Realität beim ethnographischen Schreiben. Behar beschreibt ihre eigenen Rollen (Priesterin, Interviewerin etc.) und die notwendigen Kürzungen im Prozess der Texterstellung. Sie verdeutlicht, dass ethnographisches Schreiben ohne Reduktion nicht möglich ist und zieht Parallelen zu Clifords Konzept der "partiellen Wahrheit". Der implizite "Verrat" beim Niederschreiben des Lebens eines anderen Menschen wird thematisiert, sowie die Kritik am westlichen Feminismus aus der Perspektive von Frauen of Color.
Schlüsselwörter
Ethnographie, Fiktion, partielle Wahrheit, Macht, Gender, kulturelle Repräsentationen, teilnehmende Beobachtung, Selbstreflexivität, Schreibprozesse, multikulturelle Anthropologie, feministische Anthropologie, Relativismus, "Writing Culture", "Translated Woman".
Häufig gestellte Fragen zu „Ethnographisches Schreiben: Clifford und Behar im Vergleich“
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und vergleicht die Ansätze von James Clifford (in „Writing Culture“) und Ruth Behar (in „Translated Woman“) zum Thema ethnographisches Schreiben. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Ethnographie als Fiktion und partieller Wahrheit, den Herausforderungen der Poesie von Ethnographie sowie der Rolle von Macht und Gender in ethnographischen Praktiken.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter: Ethnographie als Fiktion und partielle Wahrheit, die Einflüsse von Macht und Gender auf ethnographisches Schreiben, teilnehmende Beobachtung und selbstreflexive Schreibweise, die multiplen Rollen des Ethnographen, die Reduktion von Realität im Schreibprozess, und die Kritik am westlichen Feminismus aus der Perspektive von Frauen of Color. Sie untersucht auch die Herausforderungen des Schreibprozesses und die Bedeutung literarischer Beiträge in der Anthropologie.
Welche Autoren und Werke stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die zentrale Analyse dreht sich um James Cliffords „Writing Culture“ und Ruth Behars „Translated Woman“. Die Arbeit untersucht die jeweiligen Argumentationen der Autoren und vergleicht ihre Ansätze zum ethnographischen Schreiben.
Wie wird Ethnographie in dieser Arbeit betrachtet?
Ethnographie wird nicht als objektive Darstellung der Realität, sondern als Konstruktion, als „partielle Wahrheit“ und „wahre Fiktion“ betrachtet. Die Arbeit betont den Einfluss von Machtstrukturen, Gender und den persönlichen Erfahrungen des Ethnographen auf den Schreibprozess und die resultierende Darstellung.
Welche Rolle spielt Macht im ethnographischen Schreiben?
Die Arbeit betont die allgegenwärtige Rolle von Macht in ethnographischen Praktiken. Sie analysiert die Machtverhältnisse zwischen dem Ethnographen und den untersuchten Gruppen und wie diese Machtstrukturen die Darstellung beeinflussen. Der Verlust der automatischen Autorität der Anthropologie und die Selbstkonstruktion der Interpreten werden hervorgehoben.
Welche Bedeutung hat Gender im Kontext dieser Arbeit?
Gender spielt eine wichtige Rolle, insbesondere im Vergleich der Ansätze von Clifford und Behar. Die Arbeit untersucht, wie Gender die kulturelle Repräsentation und die ethnographischen Praktiken beeinflusst. Die Perspektive von Frauen of Color und die Kritik am westlichen Feminismus werden ebenfalls thematisiert.
Was ist die Bedeutung von teilnehmender Beobachtung und selbstreflexiver Schreibweise?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der teilnehmenden Beobachtung und den Wandel in der Balance zwischen Subjektivität und Objektivität. Die selbstreflexive Schreibweise, die die eigenen Erfahrungen und Perspektiven des Ethnographen miteinbezieht, wird als wichtiger Bestandteil des ethnographischen Schreibprozesses hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ethnographie, Fiktion, partielle Wahrheit, Macht, Gender, kulturelle Repräsentationen, teilnehmende Beobachtung, Selbstreflexivität, Schreibprozesse, multikulturelle Anthropologie, feministische Anthropologie, Relativismus, „Writing Culture“, „Translated Woman“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel zu den zentralen Aspekten von Cliffords und Behars Werk, sowie eine Liste von Schlüsselwörtern.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich wissenschaftlich mit Ethnographie, Anthropologie, und dem Schreiben von ethnographischen Texten auseinandersetzen. Sie ist für akademische Zwecke gedacht.
- Quote paper
- Katharina Eder (Author), 2008, Textvergleich Clifford, James "Writing Culture“ " ./. Behar, Ruth "Translated Woman", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/172597