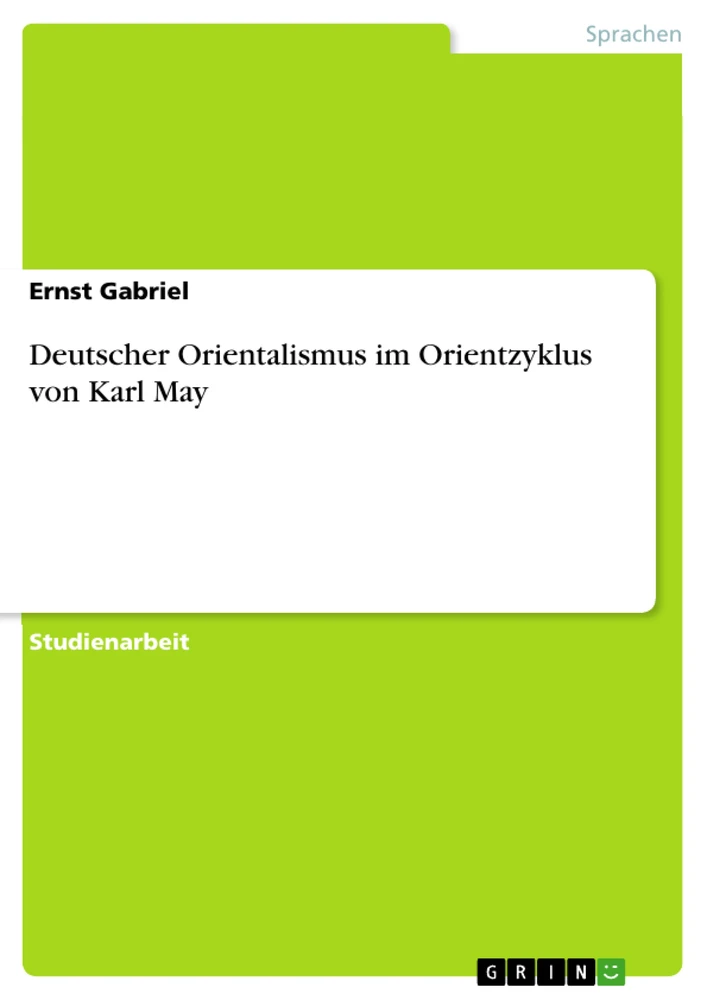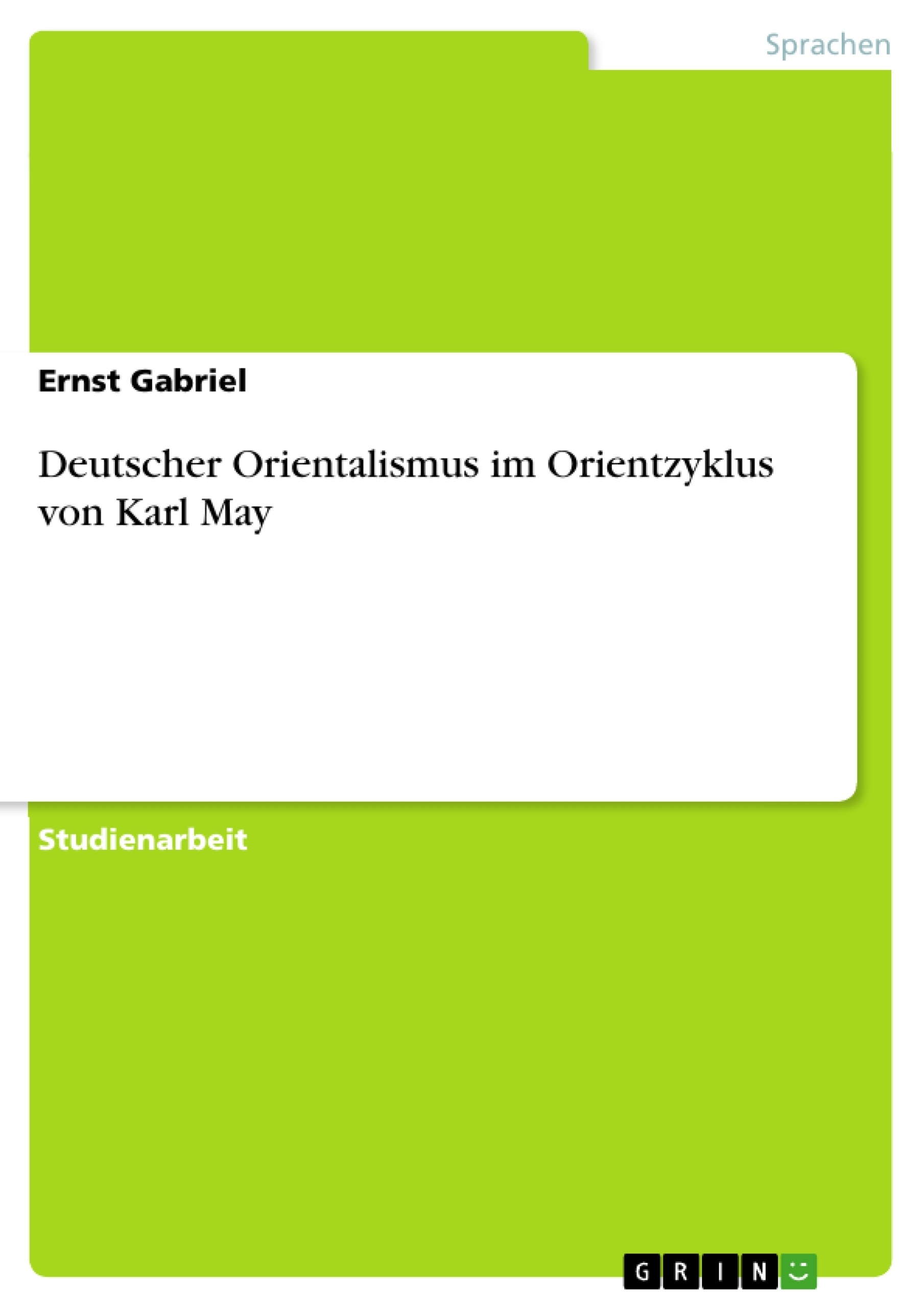Edward W. Said veröffentlichte seine Studie „Orientalism“ im Jahre 1978. Innerhalb der Postcolonial Studies gehört sie zum absoluten Kanon, teilweise gilt sie sogar als deren „Auftaktpublikation“ beziehungsweise „Gründungsdokument“. „Orientalism“ erfuhr eine breite und umfassende Rezeption innerhalb der Kultur-, Literatur-, aber auch Politik- und Sozialwissenschaften, die sich sowohl positiver/wohlwollender, konstruktiv-kritischer als auch ablehnender Art gestaltete. Vieler Kritik zum Trotz zeichnet sich die Publikation durch eine andauernde Beständigkeit aus. So soll auch diese Arbeit ein kritisches Weiterdenken von Teilen der „Orientalism“-Studie darstellen und sich in die Tradition des „Post-Orientalismus“ einreihen. Der Fokus ist hierbei auf de deutschen „Orientalismus“ und dessen latente Negierung durch Said gelegt. Am Beispiel von Karl Mays „Orientzyklus“ soll überprüft werden, ob es einen deutschen „Orientalismus“ nach dem „Orientalismus“-Konzept von Said gab/gibt. Ziel dieser Arbeit ist es dabei vor allem, im Gegensatz zu vielen anderen Kritiker_innen, nicht Saids Prämissen zu dekonstruieren, sonder vielmehr kritisch mit diesen zu arbeiten. Nina Bermans Studie „Orientalismus, Kolonialismus und Moderne.“ soll hierbei als Hauptreferenz für die Analyse des „Orientszyklus“ dienen und somit in gewisser Weise auf Saids Thesen angewendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Immer wieder Said – Einführung
- Theorie in „Orientalism“
- Methodik
- Definition des saidschen „Orientalismus“
- Historische Verortung
- Theoretisches Fazit und Ausblick
- Can Said speak German? - deutscher Orientalismus
- Saids ambivalente These(n) zur Nichtexistenz
- Prämissen
- Berman neue Einführung
- Hegemonialer Diskurs - Karl Mays „Orientzyklus“
- Fünf Phasen der Interpendenz – Historische Einordnung
- Kara Ben Nemsi – personifizierter Orientalismus
- Intellektuell-akademischer „Orientalismus“ - der Orientalist
- Politisch-historischer „Orientalismus“ - der Spion und Peitsche
- Moralisch-allgemeiner „Orientalismus“ - die Nation
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es im Sinne von Edward Saids „Orientalismus“-Konzept einen deutschen „Orientalismus“ gibt. Sie analysiert den „Orientzyklus“ von Karl May im Hinblick auf die von Said beschriebenen Machtstrukturen und Denkweisen des „Orientalismus“. Ziel ist es, Saids Prämissen nicht nur zu dekonstruieren, sondern auch kritisch mit ihnen zu arbeiten und die Studie von Nina Berman „Orientalismus, Kolonialismus und Moderne“ als Referenz für die Analyse heranzuziehen.
- Die Rezeption von Saids „Orientalismus“ und dessen Einfluss auf die Postcolonial Studies
- Die Anwendung des „Orientalismus“-Konzepts auf den deutschen Kontext
- Die Analyse des „Orientzyklus“ von Karl May als Beispiel für einen deutschen „Orientalismus“
- Die Kritik an Saids Prämissen und die Einordnung des „Orientzyklus“ in das Konzept der „Hegemonialen Diskurse“
- Die Bedeutung von „Hybridität“ im Kontext des „Orientalismus“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in Saids „Orientalismus“, wobei die Methodik, Definition und historische Einordnung des Diskurses kritisch beleuchtet werden. Es werden die theoretischen Grundlagen der Studie skizziert und die Bedeutung von Foucault und Gramsci für Saids Konzept des „Orientalismus“ hervorgehoben.
Anschließend wird die Frage gestellt, ob Saids These von der Nichtexistenz eines deutschen „Orientalismus“ zutrifft. Der „Orientzyklus“ von Karl May wird als Beispiel für eine mögliche Manifestation des „Orientalismus“ in Deutschland herangezogen. Die Studie von Nina Berman dient dabei als Referenz für die Analyse.
Es wird geprüft, ob Karl Mays „Orientzyklus“ in die von Said beschriebenen „Hegemonialen Diskurse“ eingeordnet werden kann. Die Arbeit untersucht, wie May den „Orient“ darstellt und welche Stereotypen und Vorurteile in seinen Werken zum Ausdruck kommen. Es wird die These vertreten, dass Karl Mays Werke einen deutschen „Orientalismus“ reflektieren, der sich durch eine spezifische Form der Macht und Kontrolle über den „Orient“ auszeichnet.
Die Arbeit befasst sich auch mit der Bedeutung von „Hybridität“ im Kontext des „Orientalismus“. Es wird gezeigt, wie die Grenzen zwischen dem „Okzident“ und dem „Orient“ in Karl Mays Werken verwischt werden und wie der „Orient“ in den deutschen Kontext integriert wird.
Schlüsselwörter
Orientalismus, Postkoloniale Theorie, Karl May, „Orientzyklus“, Hegemonialer Diskurs, Hybridität, deutsche Kultur, Stereotype, Vorurteile, Macht, Kontrolle.
- Arbeit zitieren
- Ernst Gabriel (Autor:in), 2011, Deutscher Orientalismus im Orientzyklus von Karl May, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170877