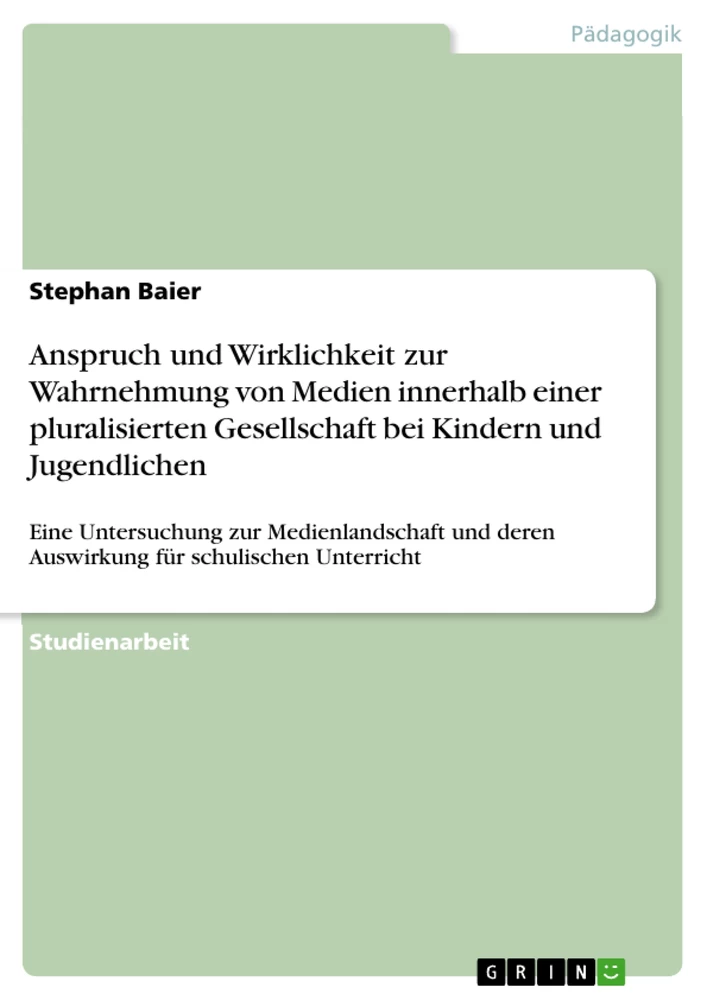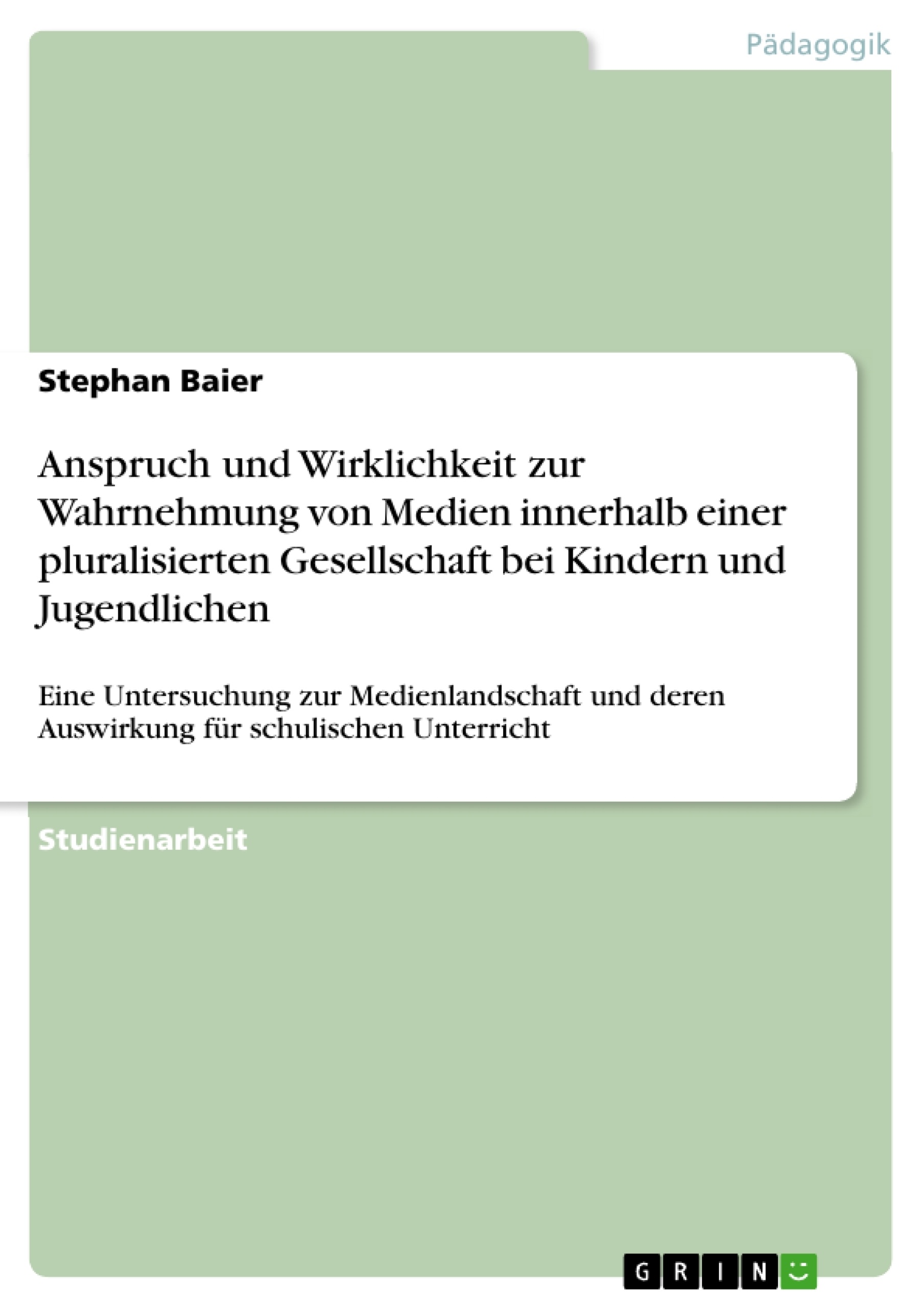Die Vielfalt der Medienlandschaften in heutiger Zeit wächst stetig und gewinnt dabei zunehmend an Einfluss und Möglichkeiten ihre Adressaten auf verschiedenen Kommunikationswegen zu erreichen. Dass der Zuwachs aber neben Chancen auch Probleme bereitet, zeigt vor allem der enorme Zuwachs im Bereich der Massenmedien, der die expandierenden Medienlandschaften immer vielschichtiger und undurchdringbarer werden lässt. Doch vor allem im Umgang mit Jugendlichen, die diese Vielfalt wohl kaum hinterfragen, da sich das multioptionale Angebot für sie als selbstverständlich darstellt – es vor allem die aktuellen Medien schon „immer“ gab, ist es dabei umso wichtiger zu wissen, wie Medien auf uns wirken, welche Möglichkeiten Medien eröffnen, aber auch wie ich mit Medien richtig umgehen muss. Diese Herausforderung bedarf einer akuten Aufmerksamkeit für Neues, ohne dabei den Blick auf das Bewährte zu verlieren. Medieneinsatz ist somit also ebenso Spagat wie Möglichkeitsspielraum innerhalb definierter Grenzen. Kompetenzgewinn, Aha-Effekte, Staunen und situative Lernerfolge können jedoch nur gelingen, wenn sich Pädagogen mit Medien auseinandersetzen und schließlich Lernende an die Materie des kritischen Umgangs heranführen. Neben Medienkompetenz, kritischer Auseinandersetzung, der Bereitschaft zu hinterfragen, spielt aber besonders das Interesse des Einzelnen eine große Rolle. Besonders das Bedürfnis nach Aktua-lität und Zeitgeist soll hier genannt sein. Doch um diese Forderungen auch zu erfüllen ist es von entscheidender Bedeutung, dass Pädagogen und Lehrer selbst mit Medien umgehen können und die Brisanz des Aktuellen kennen. Schließlich geht es ja nicht darum, Medien einzusetzen weil sie Medien sind, sondern um in einer informationsorientieren Sozialisationsstruktur der Aufgaben zu werden, die Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, was die Gesellschaft später einmal von ihnen abverlangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Medienhistorie
- Medien als Spiegel der Wirklichkeit
- Die Multiperspektivität der Medien
- Situative Funktionen
- Soziale Funktionen
- Biographische und Ich-bezogene Funktionen
- Einfluss der Medien im Alter der Jugendlichen
- Problemanalyse
- Freizeitaktivitäten Jugendlicher im Alter von 12 bis 19
- Entwicklung einer medial-geprägten Schullandschaft
- Förderung von Kompetenzen für den Umgang mit Medien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Anspruch und die Wirklichkeit der Medienwahrnehmung bei Kindern und Jugendlichen in einer pluralisierten Gesellschaft. Dabei wird der Fokus auf die Auswirkungen der Medienlandschaft auf den schulischen Unterricht gelegt.
- Die Entwicklung der Medienlandschaft und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Die Rolle von Medien im Leben von Kindern und Jugendlichen
- Die Bedeutung von Medienkompetenz im schulischen Unterricht
- Die Herausforderungen und Chancen der Mediennutzung im Bildungsbereich
- Die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung von Medien in einer pluralisierten Gesellschaft. Das Kapitel "Die Medienhistorie" zeichnet die Entwicklung von Medien von der Frühzeit bis zur Gegenwart nach. Im Kapitel "Medien als Spiegel der Wirklichkeit" wird die Rolle von Medien bei der Gestaltung unserer Wahrnehmung und der Konstruktion von Wirklichkeit untersucht. Das Kapitel "Die Multiperspektivität der Medien" betrachtet die verschiedenen Funktionen von Medien aus unterschiedlichen Perspektiven. Das Kapitel "Einfluss der Medien im Alter der Jugendlichen" analysiert die Bedeutung von Medien im Leben von Jugendlichen. Das Kapitel "Problemanalyse" beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Chancen der Mediennutzung im Bildungsbereich und untersucht die Entwicklung einer medial-geprägten Schullandschaft.
Schlüsselwörter
Medienlandschaft, Medienkompetenz, Medienpädagogik, Jugend, Schule, Bildung, Pluralisierung, Informationsgesellschaft, Kommunikation, Digitalisierung, Social Media, Internet, Fernsehen, Film, Rundfunk.
- Arbeit zitieren
- Stephan Baier (Autor:in), 2008, Anspruch und Wirklichkeit zur Wahrnehmung von Medien innerhalb einer pluralisierten Gesellschaft bei Kindern und Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170874