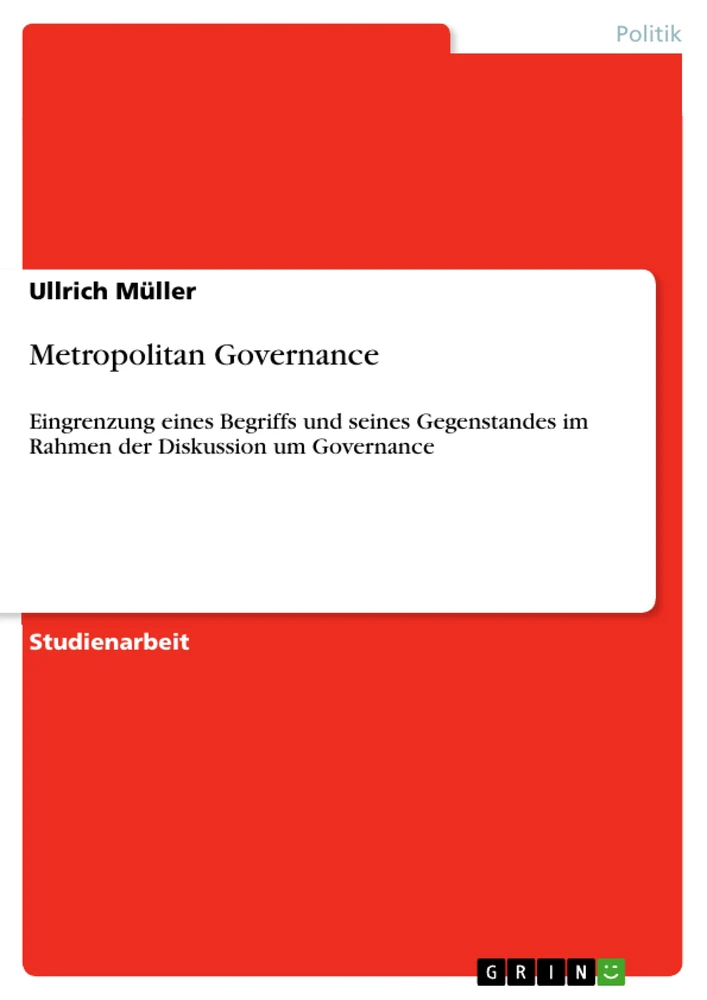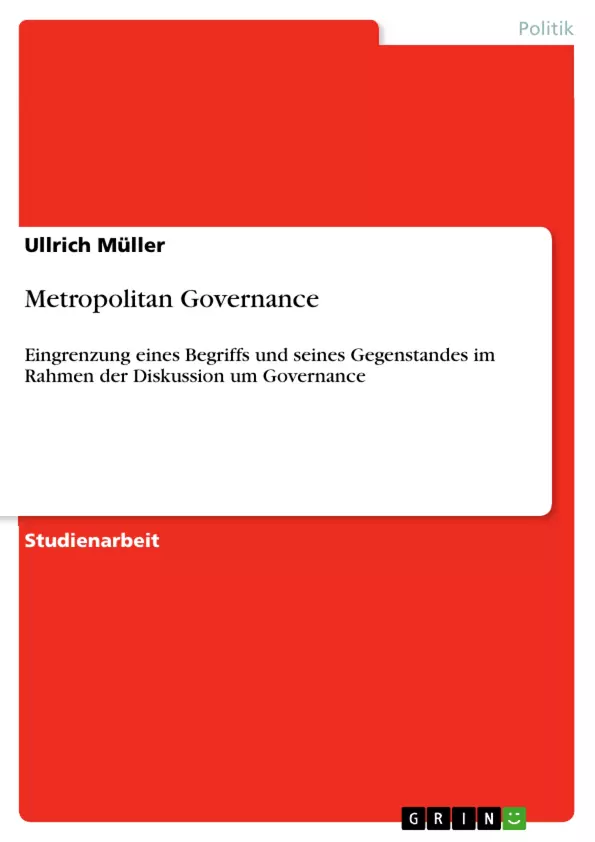In der griechischen Antike bezeichnete der Begriff der Metropole die Mutterstadt von verschiedenen Kolonien, die sich als deren kulturelles und politisches Zentrum verstand.
Im heutigen Sprachgebrauch ist der Begriff der Metropole nicht klar definiert und kann vielfältig eingesetzt werden. Im Allgemeinen stellt eine Metropole in einer oder mehrerer Hinsichten den Mittelpunkt einer Region dar, wobei genaue Ein- bzw. Abgrenzungen hierbei schwierig sind. So stellt etwa Frankfurt am Main innerhalb Deutschlands aber auch Europas eine Banken- und Finanzmetropole dar. Berlin hingegen begründet seinen Metropolenstatus vor allem mit der politischen und kulturellen Stellung, kann aber z.B. in ökonomischer Hinsicht sicher nicht mit der Hafenmetropole Hamburg mithalten. Ein wichtiger Indikator einer Metropole ist sicherlich ihre Einwohnerzahl, bestimmend sind jedoch andere Faktoren. Die Ursachen der Metropolstellung verschiedener Städte sind so unterschiedlich wie diese selbst und lassen sich nur schwer auf einen Nenner bringen. Während es etwa Frankfurt am Main in seiner Kernstadt nicht einmal auf eine Millionen Einwohner bringt, ist die Bevölkerungsdichte der Umgebung der mehrfachen Millionenstadt Berlin im Vergleich zu der Frankfurts wesentlich geringer. Es reicht somit nicht aus von der Metropole an sich zu sprechen. Statt dessen mag es zum Teil sinnvoller sein mit der Begriff der Metropolitanregion zu operieren. Wenn dem so ist, so stellt sich, im Rahmen der Governance-Diskussion, die Frage, wie das Konzept der Metropolitan Governance von Urban Governance-Ansätzen und vom Regional Governance abzugrenzen ist und ob der Begriff an sich immer sinnvoll gewählt ist. Wird nämlich eine vergleichende Perspektive eingenommen, so zeigt sich auf den ersten Blick, daß in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Konfigurationen auch verschiedene Konzeptualisierungen und Formen von Metropolitan Governance vorliegen müßten. So ist anzunehmen, daß Metropolitan Governance für eine Stadt wie London, deren übergeordneter Nationalstaat im Prinzip keine zwischengeordnete regionale Ebene kennt, eine andere Rolle spielen muß als etwa für Berlin, daß sich ganz pragmatisch aus seiner Metropolstellung heraus, mit einem anderen regionalen Akteur, nämlich Brandenburg, koordinieren muß.
Die Frage ist, inwieweit Metropolitan Governance von anderen Formen abzugrenzen ist und wie verschiedene Formen innerhalb von verschieden Konfigurationen aussehen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Governance auf verschiedenen Ebenen – Versuch einer Eingrenzung
- Annäherungen an ein Konzept
- Regional Governance
- Local Governance
- Urban Governance
- Zwischenresümee
- Metropolitan Governance anhand dreier Fallstudien
- London
- Berlin
- Frankfurt am Main
- Fazit
- Ressourcen und Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Konzeption und Anwendung des Begriffs der Metropolitan Governance im Kontext der Governance-Diskussion. Die Zielsetzung ist es, die Abgrenzung der Metropolitan Governance von anderen Formen wie Urban, Local und Regional Governance zu untersuchen und anhand von Fallbeispielen die verschiedenen Formen innerhalb verschiedener Konfigurationen zu beleuchten. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob und inwiefern Metropolitan Governance Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Formen aufweist.
- Eingrenzung des Begriffs Metropolitan Governance
- Abgrenzung von Urban, Local und Regional Governance
- Analyse von Fallstudien (London, Berlin, Frankfurt am Main)
- Diskussion der Vor- und Nachteile von Metropolitan Governance
- Einordnung in die allgemeine Governance-Diskussion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung definiert den Begriff der Metropole und stellt die Notwendigkeit der Abgrenzung des Konzepts der Metropolitan Governance von anderen Formen wie Urban, Local und Regional Governance in den Vordergrund.
Governance auf verschiedenen Ebenen – Versuch einer Eingrenzung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Governance-Begriffs. Es werden unterschiedliche Ansätze und Perspektiven auf Governance vorgestellt und die verschiedenen Elemente von Governance-Arrangements analysiert.
Regional Governance
Hier wird die Bedeutung von Regional Governance in der Governance-Diskussion thematisiert, wobei die Besonderheiten der Regional Governance in verschiedenen Ländern und Kontexten herausgestellt werden.
Schlüsselwörter
Metropolitan Governance, Urban Governance, Local Governance, Regional Governance, Governance-Debatte, Steuerungsdebatte, Staat, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, Mischformen, Fallstudien, London, Berlin, Frankfurt am Main.
- Quote paper
- Ullrich Müller (Author), 2007, Metropolitan Governance, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170645