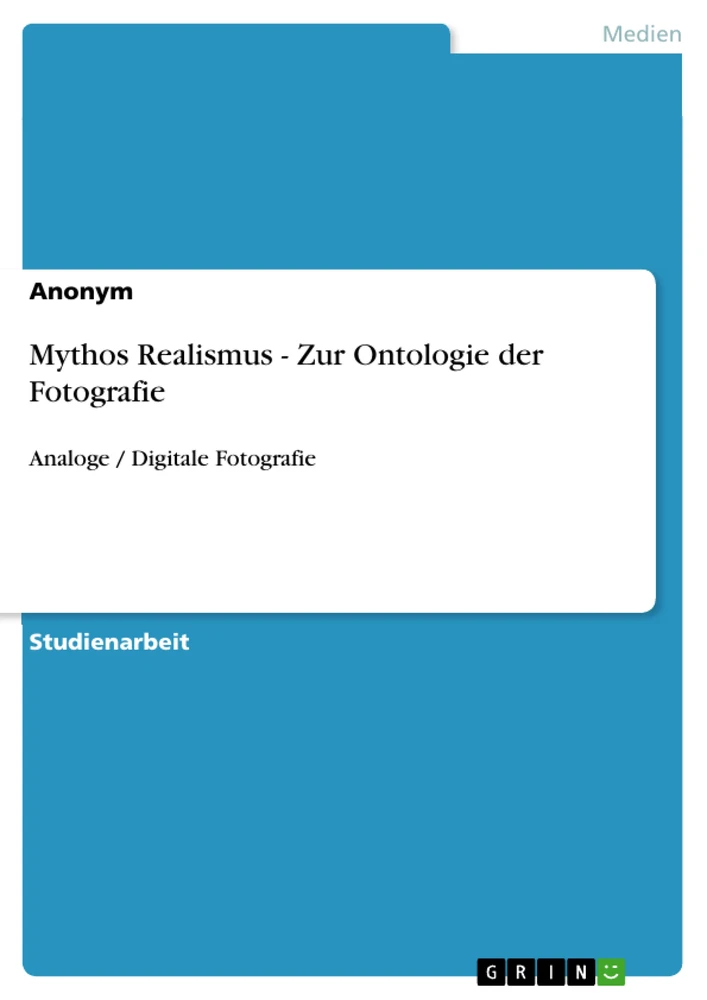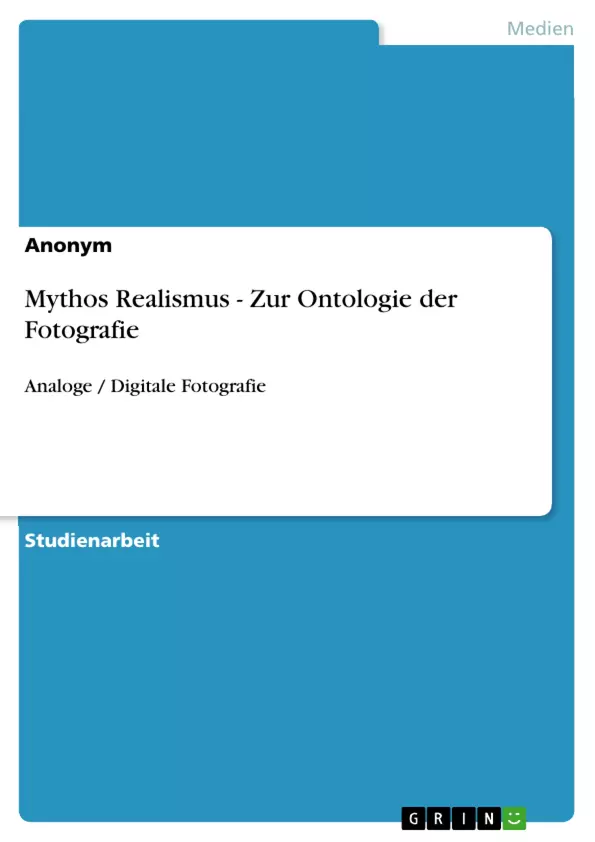Schaut man sich einschlägige Titel kulturwissenschaftlichen Arbeiten zur analogen und digitalen Fotografie an, so erweckt dies den Eindruck als unterscheide sich das Wesen der digitalen Fotografie so fundamental von dem der analogen, als sei letztere tot. Herta Wolf sieht das „Ende des fotografischen Zeitalters“ gekommen, Rötzer beschreibt die digitale Fotografie als „Fotografie nach der Fotografie“, und für W. J. Mitchel ist die Fotografie seit 1989 tot bzw. verdrängt. Weiterhin findet nicht nur Lunenfeld das digitale Foto doch sehr „dubitativ“. Doch wie kommen die Autoren auf eine solche Annahme?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung Die digitale Fotografie – Eine Fotografie nach der Fotografie?
- Theoretische Ansätze zur Ontologie der Fotografie
- Der semiotische Ansatz: Im Moment der Bildproduktion
- Die Vertiefung des Referenten
- Fotografie als soziale Praxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der digitalen Fotografie und untersucht die Frage, ob sich die digitale Fotografie grundlegend von der analogen Fotografie unterscheidet. Dabei wird der Fokus auf die Ontologie der Fotografie gelegt, die sich mit der Frage nach der "Seinsweise" des fotografischen Bildes befasst.
- Die Bedeutung der Ontologie der Fotografie in der digitalen Ära
- Die Rolle des Referenten in der Fotografie
- Die Konstruktion von Realität durch die Fotografie
- Die Authentizität digitaler Bilder
- Die Differenzierung der verschiedenen fotografischen Akte in der digitalen Fotografie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die digitale Fotografie – Eine Fotografie nach der Fotografie? Dieses Kapitel beleuchtet die Debatte um die digitale Fotografie und ihre Unterschiede zur analogen Fotografie. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Digitalisierung eine "Fotografie nach der Fotografie" darstellt.
- Theoretische Ansätze zur Ontologie der Fotografie: Dieses Kapitel stellt verschiedene theoretische Ansätze vor, die sich mit der Ontologie der Fotografie auseinandersetzen, insbesondere den semiotischen Ansatz, der den Realitätsbezug und die Verbindung zum Referenten betont.
- Der semiotische Ansatz: Im Moment der Bildproduktion: Dieses Kapitel fokussiert sich auf den semiotischen Ansatz und untersucht die Bedeutung des "Referenten" in der Fotografie. Es werden die theoretischen Überlegungen von Roland Barthes zum "Bezugsobjekt" der Fotografie beleuchtet.
Schlüsselwörter
Digitale Fotografie, Ontologie der Fotografie, Referent, semiotischer Ansatz, Realitätsbezug, Bildproduktion, Bildbearbeitung, Authentizität, Konstruktion von Realität, Fotografie als soziale Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Unterscheidet sich die digitale Fotografie fundamental von der analogen?
Die Arbeit untersucht genau diese Debatte. Während einige Autoren das „Ende des fotografischen Zeitalters“ sehen, analysiert der Text, ob das Wesen (die Ontologie) der Fotografie trotz technischem Wandel gleich bleibt.
Was bedeutet "Ontologie der Fotografie"?
Die Ontologie der Fotografie befasst sich mit der Frage nach der Seinsweise des fotografischen Bildes und seinem Bezug zur Realität.
Welche Rolle spielt der "Referent" in der Fotografie?
Der Referent ist das reale Objekt, das fotografiert wurde. Roland Barthes betont, dass die Fotografie untrennbar mit diesem Bezugsobjekt verbunden ist („Es-ist-so-gewesen“).
Ist ein digitales Foto weniger authentisch?
Durch die Möglichkeiten der Bildbearbeitung wird das digitale Foto oft als „dubitativ“ (zweifelhaft) angesehen, was die Konstruktion von Realität in den Vordergrund rückt.
Was ist der semiotische Ansatz in der Fotografie?
Dieser Ansatz betrachtet das Foto als Zeichen, das auf einen realen Moment der Bildproduktion verweist und die Verbindung zwischen Abbild und Referent untersucht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Mythos Realismus - Zur Ontologie der Fotografie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170247