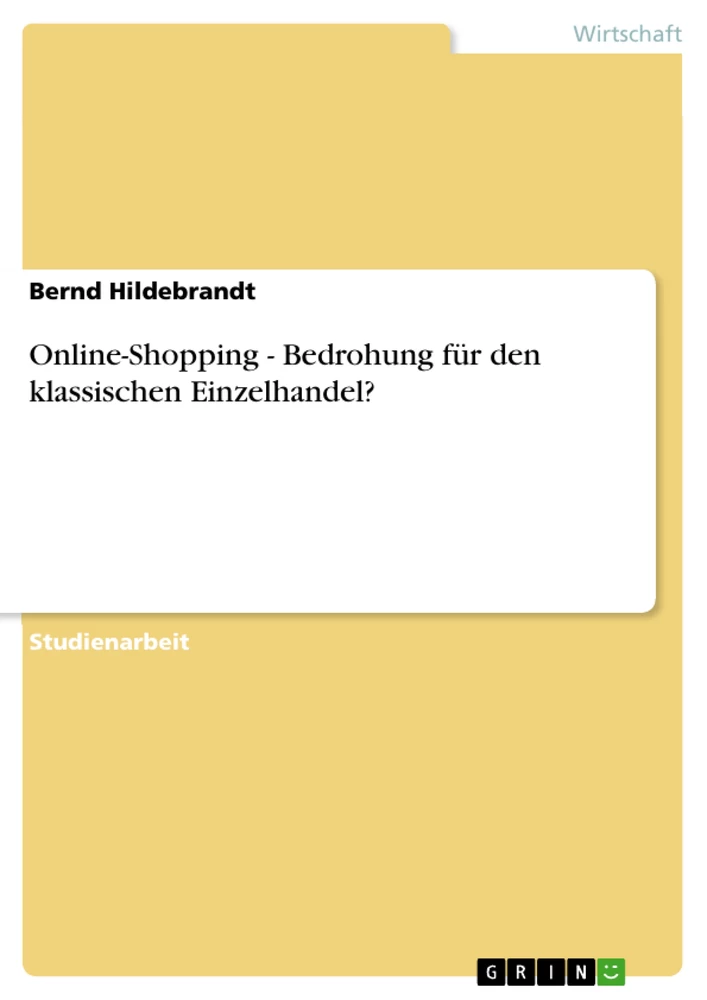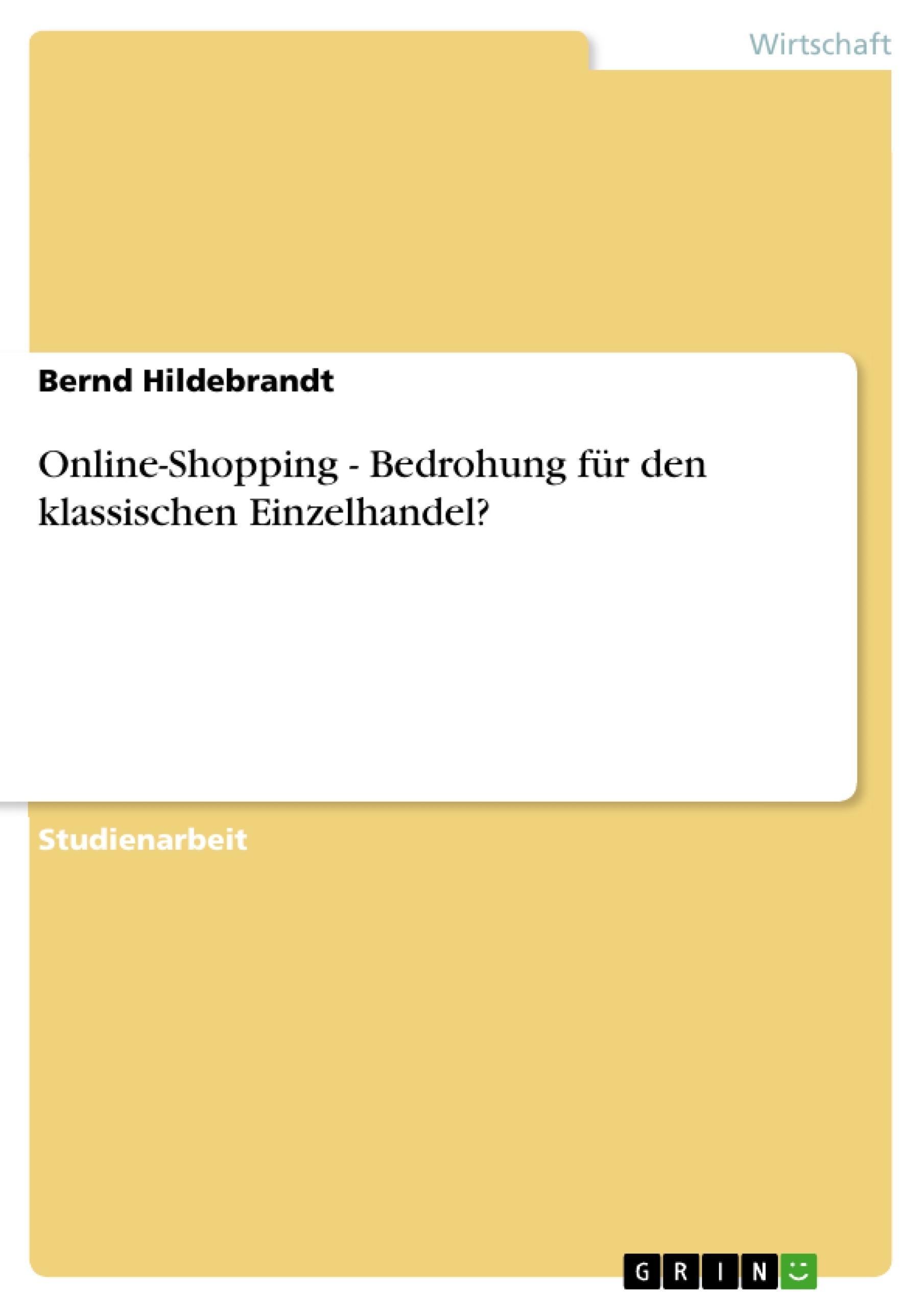Unsere Gesellschaft ist einem schnellen und stetigen Wandel ausgesetzt. Eine der gravierendsten Ursachen dafür ist der immer rasanter werdende technologische Fortschritt, der ständige Veränderungen hervorruft und immer mehr Prozesse und Abläufe revolutioniert. Eine solche Revolution hat das Internet mit sich gebracht und ist an dem zunehmenden Handel mit täglich neu erscheinenden Produkten und Dienstleistungen auf elektronischen Märkten abzulesen. Viele Menschen in modernen Gesellschaften sind heutzutage mit dem Internet vertraut, und nutzen dortige Handelsplattformen als virtuellen Marktplatz. Der Oberbegriff Electronic-Business umfasst alle Formen der digitalen Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen Unternehmen und deren Kunden über globale öffentlich und private Netze. Diese breite Definition des Begriffs E-Business schließt vielfältige Facetten und Anwendungsbereiche zur individuellen Nutzung und Gestaltung dieser Konzepte für das eigene Unternehmen mit ein. Der Begriff Electronic-Commerce steht als Oberbegriff für den Handel im Internet. In der deutschen Handelsgesellschaft ist die Nutzung unterschiedlicher Absatzkanäle kein neues Phänomen. Schon lange (als Pionier der Mehrkanal-Absatzstrategie gilt Neckermann im Jahr 1950) ermöglichen Unternehmen parallel neben dem Einkauf in stationären Ladengeschäften auch die Bestellung über Kataloge. Allerdings wird erst durch die Internet-Einbindung in den Handel von Multi-Channel-Systemen gesprochen, vorher sprach man von traditionellen Mehrkanalsystemen. Im Vertriebskanal Internet hat sich mittlerweile ein ausdifferenziertes Angebot an Waren und Dienstleistungen etabliert. Vielfach werden Konsumgüter wie bspw. Bücher, CDs/DVDs und Elektrogeräte virtuell angeboten. Dinge des täglichen Bedarfs, wie bspw. Lebensmittel, werden weiterhin überwiegend im klassischen Handel konsumiert. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass der Internet-Boom ungebrochen weitergeht und auf absehbare Zeit anhalten wird. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Einzelhandelsumsätze im Internet bis 2015 mindestens verdoppeln werden.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich vor allem mit dem Geschäftsbereich Business-to-Customer, da er den klassischen unternehmerischen Handel mit dem Endverbraucher wiedergibt, und schließt mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einsatzgebiete des Electronic-Commerce
- 2.1. Erscheinungsformen des Electronic-Commerce
- 2.1.2. Business-to-Business (B2B)
- 2.1.3. Business-to-Customer (B2C)
- 2.1.4. Customer-to-Customer (C2C)
- 2.1.5. Business-/Customer-to-Administration (B2A, C2A)
- 2.2. Anwendungsformen und Entwicklung des Electronic-Commerce
- 2.2.1. Online-Shop
- 2.2.2. Electronic Shopping-Mall
- 2.2.3. Online Auktion
- 2.1. Erscheinungsformen des Electronic-Commerce
- 3. Der klassische Handel, Offline - Online
- 4. Beeinflussung des klassischen Handels durch Online-Shopping
- 4.1. Risiken für den klassischen Handel
- 4.2. Chancen für den klassischen Handel
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beleuchtet die Auswirkungen des Online-Shoppings auf den klassischen Einzelhandel. Sie untersucht die verschiedenen Einsatzgebiete des Electronic-Commerce, insbesondere den Bereich Business-to-Customer (B2C), und analysiert die Chancen und Risiken, die sich für den traditionellen Handel durch den Online-Handel ergeben.
- Entwicklung und Bedeutung des Electronic-Commerce
- Unterschiede zwischen Online- und Offline-Handel
- Einflussfaktoren des Online-Shoppings auf den klassischen Handel
- Chancen und Risiken des Online-Handels für den traditionellen Einzelhandel
- Zukünftige Entwicklungen im Bereich des Online- und Offline-Handels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Online-Shopping und dessen Bedeutung für den klassischen Einzelhandel ein. Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen Einsatzgebiete des Electronic-Commerce und beschreibt die unterschiedlichen Erscheinungsformen wie Business-to-Business (B2B), Business-to-Customer (B2C), Customer-to-Customer (C2C) und Business-/Customer-to-Administration (B2A, C2A). Es werden außerdem Anwendungsformen wie Online-Shops, Electronic Shopping-Malls und Online-Auktionen vorgestellt. Kapitel 3 analysiert den klassischen Handel und dessen Einbindung in die Online-Welt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Online-Shoppings auf den klassischen Handel, indem es die Risiken und Chancen für den traditionellen Einzelhandel beleuchtet. Die Zusammenfassung und das Fazit fassen die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Online-Handels.
Schlüsselwörter
Electronic-Commerce, Online-Shopping, klassischer Handel, Business-to-Customer (B2C), Chancen, Risiken, Multi-Channel-Systeme, E-Business, Internet-Boom, Einzelhandelsumsätze, Wertschöpfungsketten.
- Quote paper
- Bernd Hildebrandt (Author), 2011, Online-Shopping - Bedrohung für den klassischen Einzelhandel?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170226