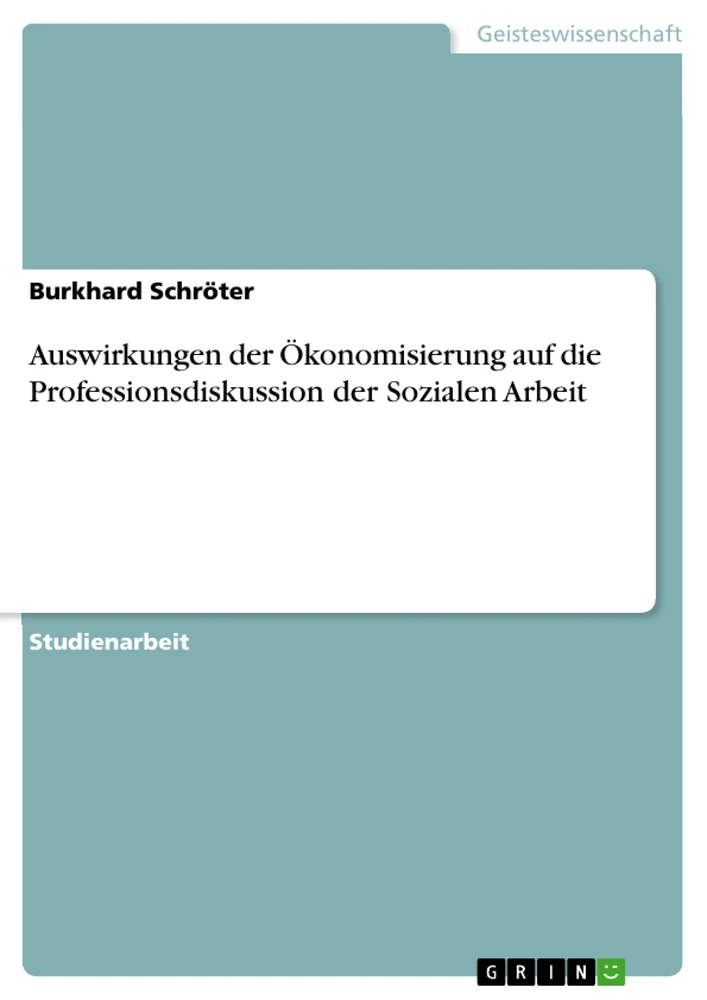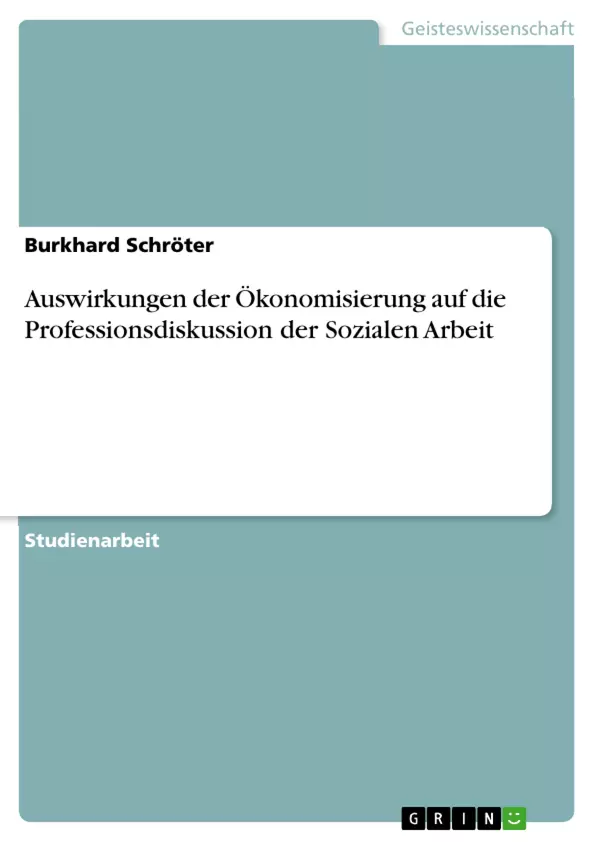Die anhaltende Tendenz zu mehr Markt, Wettbewerb und überprüfbaren Leistungen auch im Non-Profit-Sektor hat in den letzten Jahren eine heftige Diskussion über die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit ausgelöst. Die Soziale Arbeit steht heute mehr als je zuvor unter Legitimations- u. Rechtfertigungsdruck bezüglich der Wirksamkeit u. Wirtschaftlichkeit ihrer Handlungsweise.
Die letzten Jahre waren durch einen demografischen Wandel, einem Umbau des Sozialstaates und die damit zusammenhängende Ökonomisierung der Sozialen Arbeit gekennzeichnet. Dies führte zu gravierenden Veränderungen. Die Anerkennung der Profession der Sozialen Arbeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei läuft sie Gefahr, als Dienstleister im Auftrag des Staates einen Markt zu bedienen, der durch eine Reihe selbst verschuldeter politischer Entscheidungen erst von ihm geschaffen wurde. Kritiker werfen den Managementsystemen vor, zu einer Deprofessionalisierung und Entindividualisierung sozialer Dienstleistungserbringung beizutragen. Befürworter betonen dagegen, dass nur mit solchen Systemen ein effizienter und effektiver Mitteleinsatz sicherzustellen und nachzuweisen ist.
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, inwieweit die Soziale Arbeit bei der Manifestation ihrer Profession als Fachwissenschaft erfolgreich war. Wie stark greift die zunehmende Ökonomisierung in diesen Ablauf ein? Besteht eine Ambiguität oder determiniert sich beides?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Professionalisierung
- Professionalisierungsbedürfnis
- Profession
- Das strukturtheoretische Modell
- Das systemtheoretische Modell
- Der interaktionstheoretische Ansatz
- Die Suche nach einem professionellen Status – kurzer historischer Abriss
- Rückschritt Deprofessionalisierung
- Die aktuelle Professionsdiskussion
- Ökonomisierung der Sozialen Arbeit
- Begriffbestimmung Ökonomisierung
- Auswirkung der Ökonomisierung auf die aktuelle Professionsdiskussion
- Chancen und Risiken der Ökonomisierung für die Zukunft der Sozialen Arbeit
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Professionsdiskussion der Sozialen Arbeit. Sie analysiert, inwieweit die Soziale Arbeit bei der Manifestation ihrer Profession als Fachwissenschaft erfolgreich war und wie stark die zunehmende Ökonomisierung in diesen Prozess eingreift.
- Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit
- Die Ökonomisierung des Sozialstaates und ihre Auswirkungen auf die Soziale Arbeit
- Die Folgen der Ökonomisierung für die Professionsdiskussion
- Chancen und Risiken der Ökonomisierung für die Zukunft der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung einer wissenschaftlichen Fundierung und Professionalisierung der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die wachsende Diskussion über die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit, die durch den Legitimations- und Rechtfertigungsdruck bezüglich der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer Handlungsweise ausgelöst wurde. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor.
- Begriffsklärung: Dieses Kapitel liefert Definitionen und Erläuterungen der zentralen Begriffe "Professionalisierung", "Professionalisierungsbedürfnis" und "Profession". Es werden verschiedene Modelle der Professionstheorie vorgestellt, die den Blick auf die Soziale Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven eröffnen.
- Die Suche nach einem professionellen Status – kurzer historischer Abriss: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Rückblick auf die historische Entwicklung der Diskussion um die Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Es zeichnet die Entwicklung von einer vorwissenschaftlichen Praxis hin zu einem wissenschaftlich fundierten Professionalisierungskonzept nach, das auf kritischer Reflexion und gesellschaftlicher Analyse basiert.
- Rückschritt Deprofessionalisierung: Dieses Kapitel thematisiert den Bruch der Reformperiode und die damit einhergehende Deprofessionalisierungsdebatte in der Sozialen Arbeit. Es analysiert die Folgen von Konturlosigkeit und fehlender Identität für die Positionierung der Sozialen Arbeit in der interprofessionellen Zusammenarbeit.
- Die aktuelle Professionsdiskussion: Dieses Kapitel setzt sich mit den Herausforderungen für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit auseinander. Es thematisiert die Abhängigkeit von anderen wissenschaftlichen Disziplinen, die Einbindung in Organisationsstrukturen und bürokratische Vorgaben sowie die Frage, ob Soziale Arbeit uneingeschränkt als Profession bezeichnet werden kann.
- Ökonomisierung der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel behandelt die Ökonomisierung des deutschen Sozialstaates und ihre Auswirkungen auf die Soziale Arbeit. Es analysiert die verschiedenen Interpretationen des Begriffs "Ökonomisierung" und erläutert, wie diese Prozesse die Handlungsfelder der Sozialen Arbeit beeinflussen.
- Begriffbestimmung Ökonomisierung: Dieses Unterkapitel definiert den Begriff "Ökonomisierung" und stellt unterschiedliche Perspektiven aus der Debatte der Sozialen Arbeit vor. Es zeigt die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten des Begriffs und seine Bedeutung für die Sozialverwaltung auf.
- Auswirkung der Ökonomisierung auf die aktuelle Professionsdiskussion: Dieses Unterkapitel analysiert die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die aktuelle Professionsdiskussion der Sozialen Arbeit. Es untersucht, wie das doppelte Mandat der Sozialen Arbeit im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und Klientenbedürfnissen durch die Ökonomisierungsprozesse beeinflusst wird.
- Chancen und Risiken der Ökonomisierung für die Zukunft der Sozialen Arbeit: Dieses Unterkapitel beleuchtet die Chancen und Risiken, die die Ökonomisierung für die Zukunft der Sozialen Arbeit bereithält. Es diskutiert die Einführung von Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungsverfahren, die Auswirkungen auf die Definition von Aufgaben und Zielgruppen sowie die Herausforderungen durch eine standardisierte Steuerung der Sozialverwaltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Professionalisierung, Ökonomisierung, Sozialer Arbeit und Sozialstaat. Weitere wichtige Begriffe sind: Deprofessionalisierung, Professionstheorie, Verwissenschaftlichung, Handlungskompetenz, Qualitätsmanagement, Kundenorientierung und Managementkonzepte. Die Analyse bezieht sich auf die spezifischen Herausforderungen, die sich durch die Ökonomisierung für die Soziale Arbeit ergeben.
- Quote paper
- Burkhard Schröter (Author), 2011, Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Professionsdiskussion der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/169785