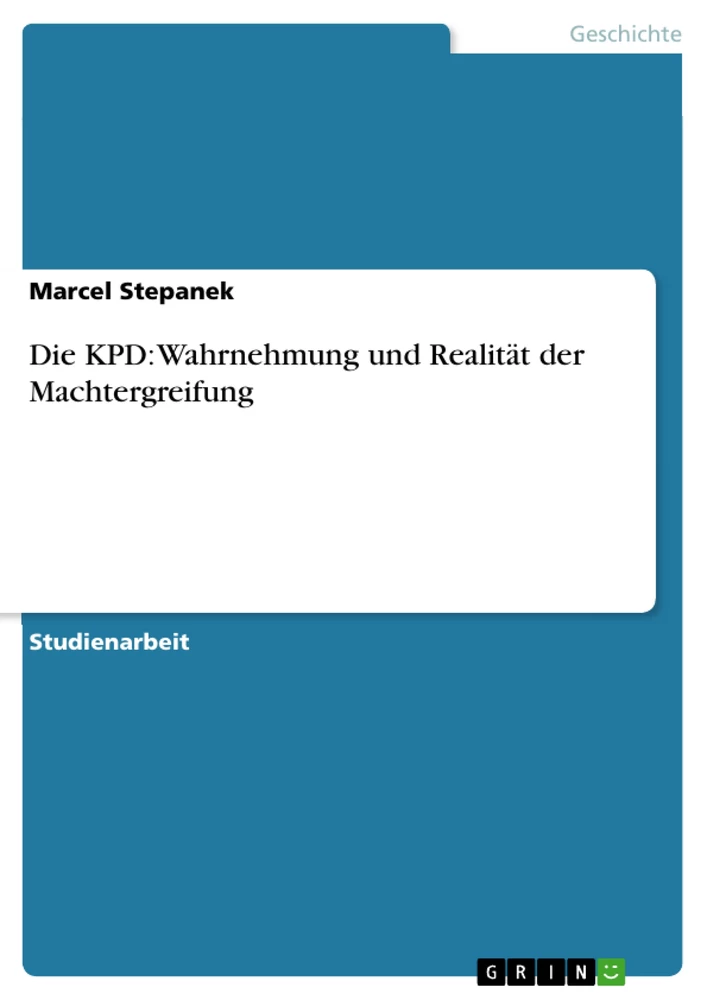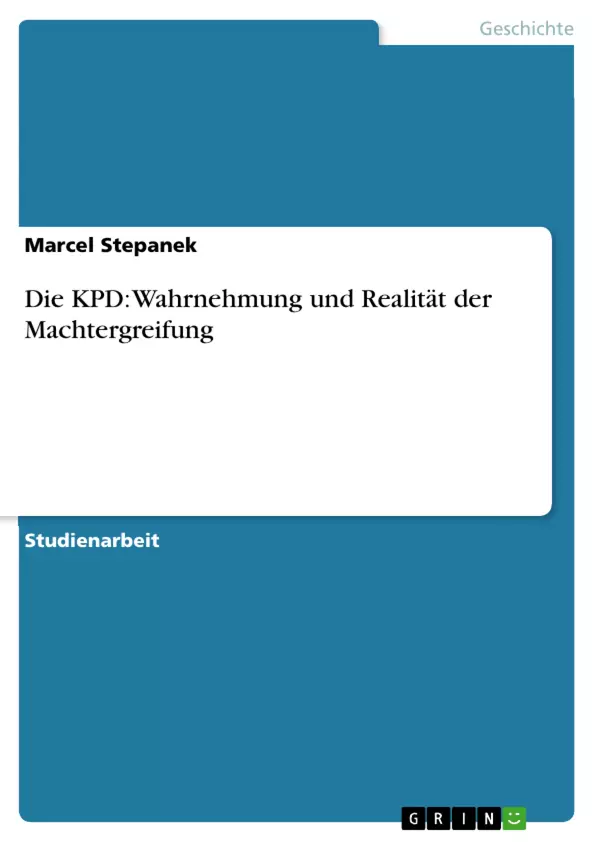Die Auseinandersetzung zwischen der KPD und der NSDAP war eine der wichtigsten und prägendsten Konfliktlinien der Weimarer Republik. Aber auch die starke Front systemoppositioneller Kräfte, die die NSDAP und die KPD errichtet hatten, sowie die tiefe Feindschaft zwischen den beiden linken Arbeiterparteien zählen zu den entscheidenden Konflikten, die die Weimarer Republik durch systemfeindliche Parlamentsmehrheiten, politische Kämpfe und nicht endende Gewalt maßgeblich schwächten.
Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten am 30.01.1933 war die KPD die erste Partei, die die Härte der neuen Machthaber zu spüren bekam. Innerhalb des ersten Monats der NS-Regierung wurde die KPD in ihren legalen Strukturen ohne nennenswerten Widerstand verboten und aufgerieben. Dies erstaunt zunächst bei einer Partei, die sich in der Weimarer Republik völlig dem Kampf gegen den Faschismus verschrieben hatte.
Um erklären zu können, wie die KPD die „Machtergreifung“ wahrgenommen und auf sie reagiert hatte, ist es notwendig, sich nicht nur mit der „Faschismustheorie“ zu beschäftigen, sondern auch mit dem Verhältnis zwischen KPD und SPD sowie dem zwischen KPD und NSDAP in den letzten zwei Jahren der Weimarer Republik. Dadurch lässt sich zeigen, dass die Wahrnehmung der KPD-Funktionäre und ihr politisches Verhalten geradezu von einer sehr stabilen Kontinuität und Pfadabhängigkeit geprägt waren, die bis weit in das dritte Reich reichte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Faschismustheorie
- Die Realität des Kampfes zwischen KPD und NSDAP am Vorabend der „Machtergreifung“
- Wer ist der Feind?
- Der Kampf gegen die NSDAP
- Mitgliederfluktuationen zwischen KPD und NSDAP
- Die Wahrnehmung und Realität der „Machtergreifung“
- Die Situation der KPD im Januar 1933
- Die Wahrnehmung und propagandistische Reaktion auf die „Machtergreifung“
- Die Realität der kommunistischen Reaktion auf die „Machtergreifung“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahrnehmung und die Reaktion der KPD auf die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933. Sie analysiert die Rolle der „Faschismustheorie“ in der KPD-Ideologie und beleuchtet das Verhältnis zwischen KPD und SPD sowie KPD und NSDAP in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Ziel ist es, die Gründe für die politische Isolation und die eingeschränkte Reaktionsfähigkeit der KPD gegenüber dem Aufstieg des Nationalsozialismus zu ergründen.
- Die Rolle der „Faschismustheorie“ in der KPD-Ideologie
- Das Verhältnis zwischen KPD und SPD in den letzten Jahren der Weimarer Republik
- Der Kampf zwischen KPD und NSDAP am Vorabend der „Machtergreifung“
- Die Wahrnehmung und die Reaktion der KPD auf die „Machtergreifung“
- Die Gründe für die politische Isolation und die eingeschränkte Reaktionsfähigkeit der KPD
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie hat die KPD die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten wahrgenommen und darauf reagiert? Sie erläutert die Bedeutung des Themas im Kontext der Weimarer Republik und der Geschichte der KPD.
Die Faschismustheorie
Dieses Kapitel untersucht die „Faschismustheorie“ im Rahmen der kommunistischen Ideologie. Es analysiert die Einordnung des Faschismus in das marxistische Konzept des Historischen Materialismus und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die politische Praxis der KPD.
Die Realität des Kampfes zwischen KPD und NSDAP am Vorabend der „Machtergreifung“
Dieses Kapitel beleuchtet den Kampf zwischen KPD und NSDAP in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Es analysiert das Verhältnis zwischen KPD und SPD, den Kampf der KPD gegen die NSDAP und die Mitgliederfluktuationen zwischen beiden Parteien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die KPD, die „Machtergreifung“, die „Faschismustheorie“, die Sozialdemokratie, die NSDAP, die Weimarer Republik, den Kampf gegen den Faschismus, die politische Isolation und die Reaktionsfähigkeit der KPD.
Häufig gestellte Fragen
Wie nahm die KPD die „Machtergreifung“ 1933 wahr?
Die Wahrnehmung war durch eine starke Kontinuität der Faschismustheorie geprägt, was zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Härte der Nationalsozialisten führte.
Was besagt die „Faschismustheorie“ der KPD?
Sie ordnete den Faschismus als Werkzeug des sterbenden Kapitalismus ein und sah die Sozialdemokratie (SPD) oft als den gefährlicheren „Sozialfaschismus“ an.
Warum gab es keinen nennenswerten Widerstand der KPD im Januar 1933?
Die politische Isolation durch die Feindschaft zur SPD und die Pfadabhängigkeit der Funktionäre schwächten die Reaktionsfähigkeit der Partei massiv.
Wie war das Verhältnis zwischen KPD und NSDAP vor 1933?
Es herrschte ein gewaltsamer Kampf auf der Straße, aber es gab auch erstaunliche Mitgliederfluktuationen zwischen den beiden systemoppositionellen Kräften.
Wann wurde die KPD von den Nationalsozialisten verboten?
Bereits innerhalb des ersten Monats nach dem 30.01.1933 wurden die legalen Strukturen der KPD zerschlagen und die Partei in den Untergrund gedrängt.
- Quote paper
- Marcel Stepanek (Author), 2009, Die KPD: Wahrnehmung und Realität der Machtergreifung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/169740