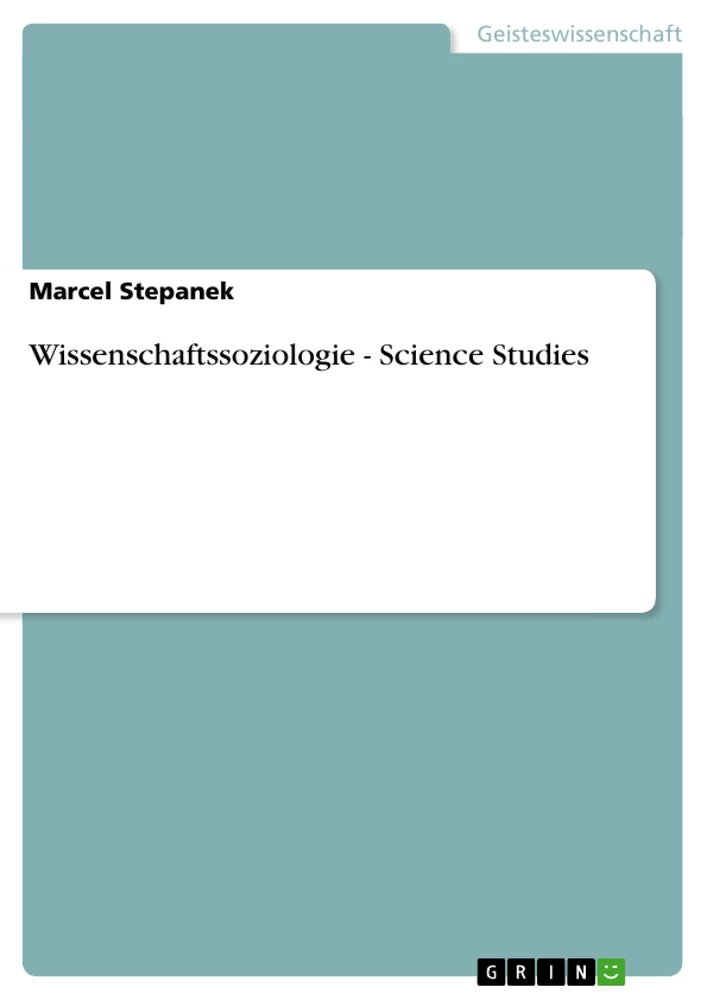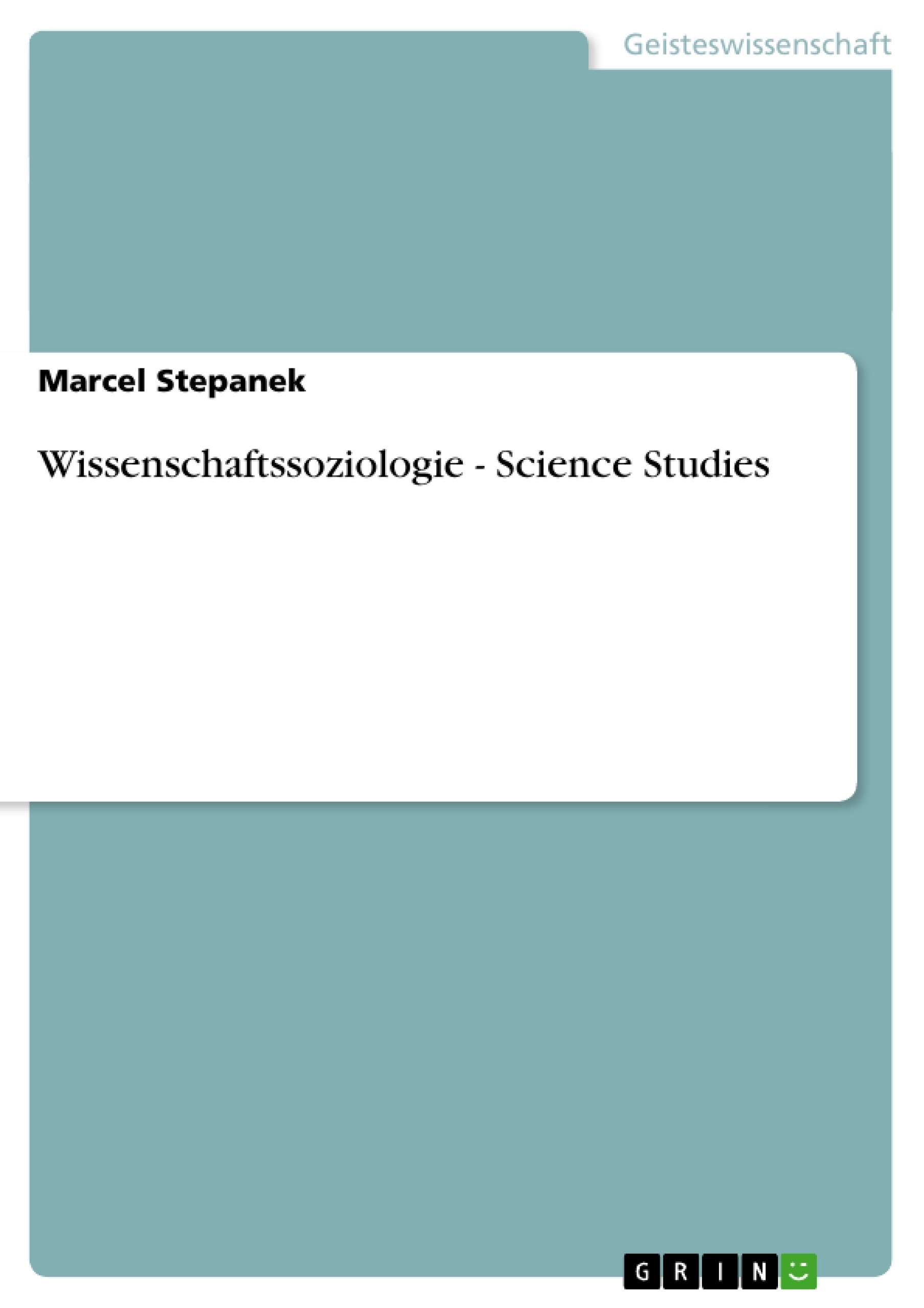Die Wissenschaftssoziologie ist noch ein recht junges Themenfeld innerhalb der Soziologie. Sie erforscht die gegenseitige Beeinflussung zwischen Wissenschaft und der sie umgebenden Gesellschaft. Grundlegend ist das Axiom, dass Wissenschaft immer in einem sozialen Rahmen stattfindet und daher von sozialen Faktoren geprägt ist. Umgekehrt wirkt die Wissenschaft natürlich auch immer in die sie umgebende Gesellschaft hinein und verändert diese durch hinzugewonnene Erkenntnisse.
Dabei sind die Funktionsweisen der gegenseitigen Beeinflussung sowohl für die Wissenschaft als auch für die Gesellschaft von großer Bedeutung. Innerhalb der Wissenschaft musste insbesondere die Naturwissenschaft erkennen, dass die Soziologie ihr jegliche „Objektivität“ absprach und dem Ausgang wissenschaftlicher Diskurse Willkür unterstellte.
Die Gesellschaft bekam hingegen vorgeführt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, je nach Dringlichkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz, das tägliche Leben und Denken des Einzelnen, teilweise seine ganze Realität, gestalten können.
Daraus resultiert auch der Nutzen der „science studies“ für die Gesellschaft, aber hauptsächlich für die Wissenschaft, denn die Erkenntnisse der Wissenschaftssoziologie erlauben, nachdem sie die Schwächen der
(Natur-)Wissenschaften offengelegt haben, eine weitere Objektivierung wissenschaftlichen Arbeitens. Für die Wissensgesellschaft bieten die „science studies“ mit der Akteur-Netzwerk-Theorie und der Standpunkttheorie weitere Bewertungsrahmen bei der Beurteilung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Formulierungen.
Aus diesen Gründen bietet es sich an, einzelne Theorien der Wissenschaftssoziologie genauer zu betrachten. So formuliert die Soziologie des Labors, verbunden mit der Theorie des Konstruktivismus, grundlegende theoretische Überlegungen zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und deren Rezeption in der Gesellschaft.
Die Akteur-Netzwerk-Theorie beobachtet hingegen, wie Wissenschaftler versuchen, ihre Ergebnisse unanfechtbar zu gestalten und deren Verbreitung zu fördern. Gleichzeitig stellt die Akteur-Netzwerk-Theorie die Frage, aus welchen Gründen manche wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Gesellschaft eher akzeptiert und aufgenommen werden als andere.
Als dritte Theorie wird die „Standpoint Theory“ vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Laborstudien und der Konstruktivismus
- Die Akteur-Netzwerk-Theorie
- Die Standpunkttheorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Themenfeld der „Science Studies“ und analysiert verschiedene Theorien der Wissenschaftssoziologie. Ziel ist es, die wechselseitige Beeinflussung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu beleuchten und die Funktionsweisen dieser Interaktion zu erforschen.
- Konstruktivismus und die Rolle des Labors in der Wissenschaftsproduktion
- Die Akteur-Netzwerk-Theorie und die Stabilisierung wissenschaftlicher Ergebnisse
- Die Standpunkttheorie und der Einfluss des Standpunkts des Forschers auf die Forschungsergebnisse
- Die Bedeutung der „Science Studies“ für die Wissenschaft und die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Themenfeld der Wissenschaftssoziologie ein und betont die Bedeutung der gegenseitigen Beeinflussung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die die Wissenschaftssoziologie für die Naturwissenschaften und die Gesellschaft mit sich bringt.
Die Laborstudien und der Konstruktivismus
Dieses Kapitel erläutert den Konstruktivismus und seine zentrale These, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht entdeckt, sondern konstruiert werden. Es wird die Rolle des Labors als sozial konstruierter Raum hervorgehoben, in dem die Natur nicht imitiert, sondern verändert und gestaltet wird.
Die Akteur-Netzwerk-Theorie
Die Akteur-Netzwerk-Theorie befasst sich mit der Frage, wie Wissenschaftler ihre Ergebnisse möglichst angriffsicher gestalten und verbreiten können. Sie analysiert die Bedeutung von Netzwerken, die aus verschiedenen Akteuren bestehen, für die Legitimierung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Die Standpunkttheorie
Dieses Kapitel stellt die Standpunkttheorie vor, die den Einfluss des Standpunkts des Forschers auf die Forschungsergebnisse betont. Die Theorie argumentiert, dass Alter, Geschlecht, Ethnie und soziale Stellung des Forschers die Sichtweise und Interpretation der Forschungsergebnisse beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Wissenschaftssoziologie, wie z. B. Konstruktivismus, Laborstudien, Akteur-Netzwerk-Theorie, Standpunkttheorie, wissenschaftliche Objektivität, Wissenschaftskommunikation und die Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
- Quote paper
- Marcel Stepanek (Author), 2009, Wissenschaftssoziologie - Science Studies, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/169673