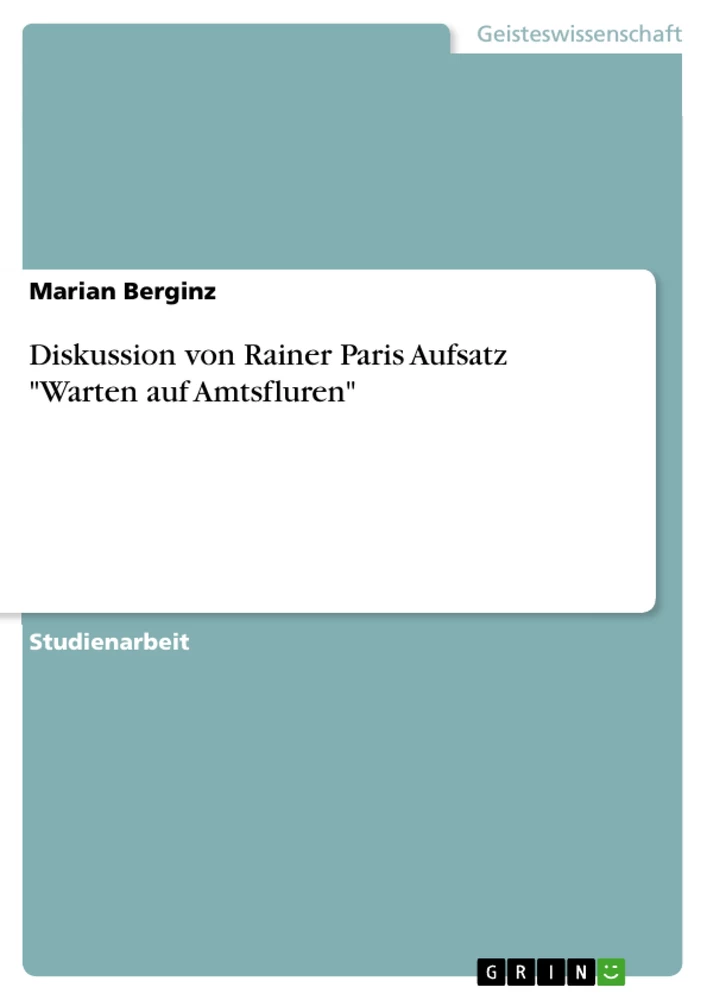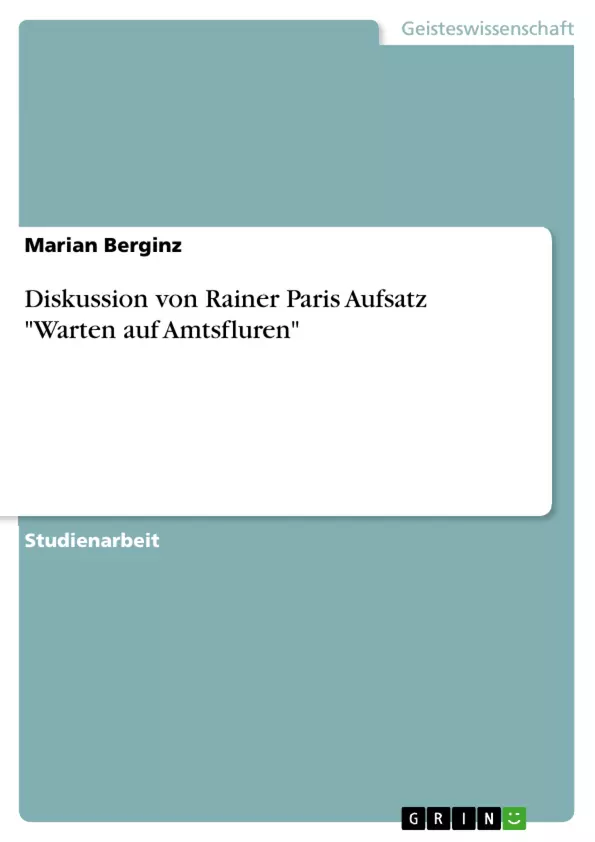Abstract: Rainer Paris hat in seinem Aufsatz “Warten auf Amtsfluren” (2001/4, Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie) fünf Merkmale von Warten aufgezeigt: Zentralität der Zeit, Zielgerichtetheit/
Ereignisorientierung, erzwungene Passivität, Isolation/ Selbstbezogenheit und Abhängigkeit/
Kontingenz. Das Thema meiner Semesterarbeit soll sein: Inwiefern stimmen diese Merkmale und wenn ja,
wie äußern sie sich? Gibt es vielleicht noch ein sechstes Merkmal, auf das Paris nicht gestoßen ist?Dies
habe ich vor durch die Analyse von den field notes, belletristischer (z.b.:Warten auf Godot) und wissenschaftlicher
Literatur zu erreichen.
1)Warten? Was ist warten ?
Warten ist eine eigenartige Tätigkeit. Eigentlich ist es ja keine Tätigkeit im herkömmlichen Sinn,
denn das aktuelle Geschehen steht ja nicht im Vordergrund, sondern das Zukünftige, das unser Ziel
ist. Wir können in dieser Zeit nicht viel anderes machen, da wir meist unsere durch Warten bereits
erreichte Position aufgeben würden, wenn wir uns mit anderen Dingen beschäftigten. So können
wir uns kaum vom „Warten“ lösen. Die Zeit dehnt sich und aus Stunden werden Tage und aus
Tagen Wochen. Dabei wissen wir meist ganz genau, wie lange wir warten. Und erst durch die
Dauer des Wartens auf etwas ergibt sich dessen Wert. Genauso lange wie wir warten, stehen wir in
absoluter Abhängigkeit von eben dem, der uns warten läßt. Und obwohl wir alle zur selben Zeit auf
dasselbe warten, so tun wir das dennoch jeder für sich und jeder alleine.
Früher hatten die Menschen eine ganz eine andere Beziehung zur Zeit. Denn erst als man auf etwas
wartete, nahm man Zeit als solche war. So ist „Warten“ eine recht späte Erfindung, die dem ersten
Menschen vermutlich relativ unbekannt, war, da er die Geschehnisse in seiner Umgebung nicht einschätzen
und berechnen konnte (vgl. Rammstedt 1975).
Nachdem Zeit in verschiedenen Lebensabschnitten verschieden wahrgenommen wird, ist auch das
„Warten“ nicht immer gleich. Wenn ein Kind auf etwas ein Jahr wartet, ist ein Jahr eine kleine
Ewigkeit. Als Erwachsener ein Jahr auf etwas zu warten, ist etwas ganz normales. Z.B. ist man als
Architektur-Student fast genauso lange auf der Universität wie im Gymnasium. Doch wird dem
Studenten die Zeit, verglichen mit einem Gymnasiasten, viel schneller vorbei gehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Warten? Was ist warten?
- Paris und seine fünf Merkmale
- Becketts „Warten auf Godot“
- Die Zeit im Laufe der Zeit
- Warten im Tagesablauf des industrialisierten Menschen
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Wartens, angelehnt an Rainer Paris’ Aufsatz „Warten auf Amtsfluren“. Das Ziel der Arbeit ist es, die von Paris identifizierten Merkmale des Wartens zu analysieren und durch die Auswertung von Feldnotizen, Belletristik und wissenschaftlicher Literatur zu beleuchten. Darüber hinaus wird die Frage aufgeworfen, ob es weitere, nicht von Paris erkannte Merkmale des Wartens gibt.
- Charakterisierung des Wartens als eigenständige Tätigkeit
- Analyse der fünf Merkmale des Wartens nach Paris
- Untersuchung der zeitlichen, kulturellen und räumlichen Varianz des Wartens
- Mögliche Interpretation des Wartens als Ausdruck von Über- und Unterordnung
- Exploration möglicher weiterer Merkmale des Wartens
Zusammenfassung der Kapitel
Warten? Was ist warten?
Das Kapitel beleuchtet das Wesen des Wartens als eine eigenständige Tätigkeit, die sich durch den Fokus auf die Zukunft und die erschwerte Ablenkung durch andere Aktivitäten auszeichnet. Die Bedeutung der Zeit im Kontext des Wartens wird betont, sowie der Zusammenhang zwischen der Dauer des Wartens und der Wertbestimmung des Erwarteten. Es wird argumentiert, dass „Warten“ eine vergleichsweise späte Erfindung ist, die mit dem Bewusstsein für die Zeit und der Möglichkeit, Ereignisse einzuschätzen und zu berechnen, einhergeht. Des Weiteren wird die Varianz des Wartens in verschiedenen Lebensabschnitten und Kulturen herausgestellt.
Paris und seine fünf Merkmale
Dieses Kapitel präsentiert die fünf Merkmale des Wartens nach Paris: Zentralität der Zeit, Zielgerichtetheit/ Ereignisorientierung, erzwungene Passivität, Isolation/ Selbstbezogenheit und Abhängigkeit/ Kontingenz. Es werden Beispiele für die Ausprägung dieser Merkmale im Alltag angeführt und es wird angedeutet, dass die Arbeit diese Merkmale anhand von Feldnotizen, belletristischer und wissenschaftlicher Literatur analysieren wird.
Schlüsselwörter
Warten, Zeit, Zentralität, Ereignisorientierung, Passivität, Isolation, Abhängigkeit, Paris, field notes, Belletristik, wissenschaftliche Literatur, „Warten auf Godot“, Zeitwahrnehmung, kulturelle Unterschiede, Über- und Unterordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die fünf Merkmale des Wartens nach Rainer Paris?
Paris nennt: Zentralität der Zeit, Zielgerichtetheit, erzwungene Passivität, Isolation und Abhängigkeit.
Ist Warten eine „Tätigkeit“?
Eigentlich ist es eine Passivität, da nicht das aktuelle Geschehen, sondern das zukünftige Ziel im Vordergrund steht, von dem man sich kaum lösen kann.
Wie hängen Warten und Macht zusammen?
Warten drückt oft ein Verhältnis von Über- und Unterordnung aus; wer warten lässt, demonstriert Macht über die Zeit des anderen.
Was zeigt Becketts „Warten auf Godot“ über dieses Phänomen?
Das Stück illustriert die existenzielle Dimension des Wartens auf ein Ereignis, das möglicherweise niemals eintritt, und die damit verbundene Dehnung der Zeit.
Wann wurde „Warten“ als solches erfunden?
Laut Rammstedt ist Warten eine späte Erfindung, die erst mit der Fähigkeit entstand, Zeit zu berechnen und Ereignisse in der Umgebung einzuschätzen.
- Quote paper
- Marian Berginz (Author), 2002, Diskussion von Rainer Paris Aufsatz "Warten auf Amtsfluren", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/16908