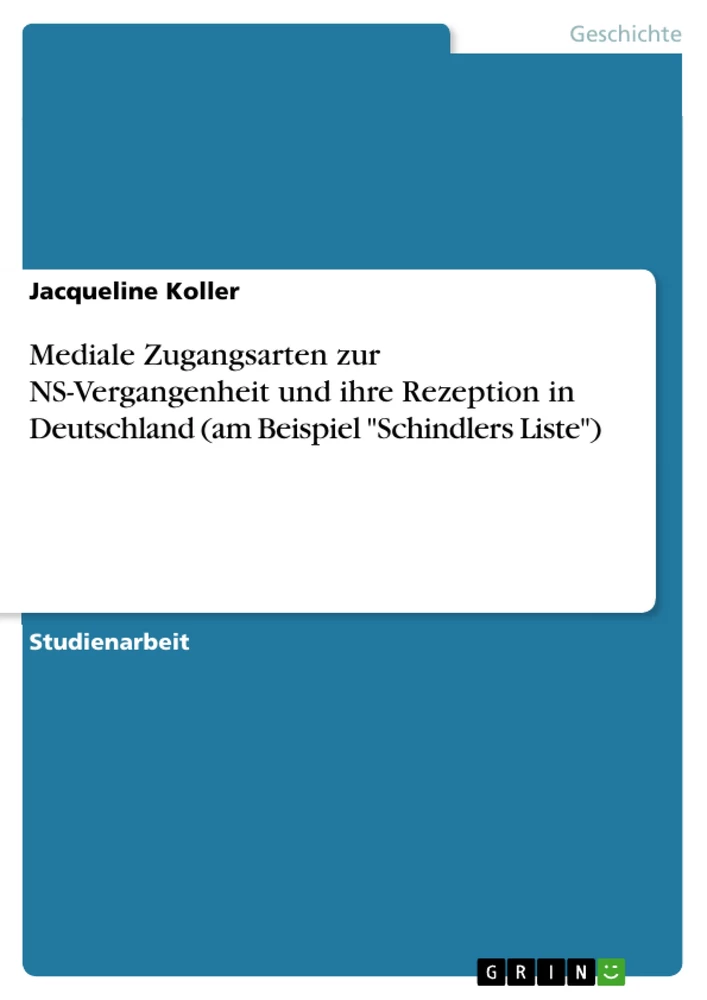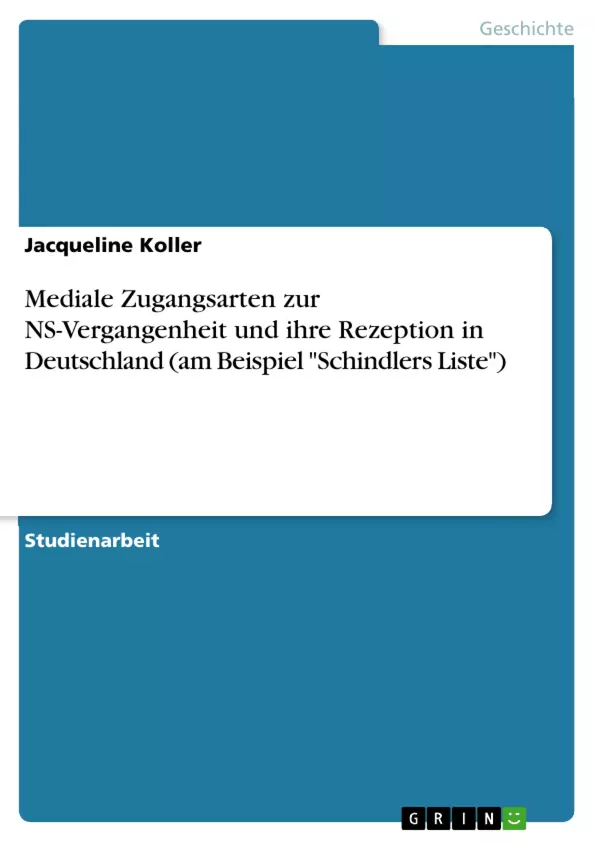Deutschland geht seit dem Kriegsende 1945 durch mehrere Phasen der Vergangenheitsbewältigung, die von Vergessen über Verdrängen bis hin zur intensiven Auseinandersetzung mit den Kriegsverbrechen bzw. dem faschistischen Regime unter Hitler allgemein reichen. Schließlich startete man mit Hilfe verschiedener Medien, u.a. auch mit Hilfe des Mediums Film, den Versuch, die nationalsozialistische Geschichte aufzubereiten. Besonderen Aufruhr erregte Mitte der 90er Jahre Spielbergs "Schindlers Liste".
In der vorliegenden Arbeit wird möglichst genau auf "Schindlers Liste" eingegangen. Dabei ist zuerst dessen Inhalt zu klären, genauer gesagt, eine kurze Inhaltsangabe zu leisten und die wichtigsten Personen (Oskar Schindler, Amon Göth und Itzhak Stern) vorzustellen. Danach steht der Aspekt "Gegensatz zwischen historischer Wirklichkeit und filmischer Umsetzung" im Blickfeld der Argumentation, bevor auf Filmanalytisches hingewiesen wird, was den thematischen Schwerpunkt der Arbeit bildet. Hierbei sollen dann einige Gestaltungsmittel, die Spielberg deutlich zur Beeinflussung des Publikums einsetzt, erwähnt und an Beispielszenen nachvollzogen werden. Im Anschluss daran mündet die Arbeit in den letzten wichtigen Punkt, die Rezeption des Films. Dort werden verschiedene Positionen zu Wort kommen. Als Hauptquelle diente die DVD-Ausgabe von "Schindlers Liste", auf der im Bonusmaterial auch Informationen über Spielbergs "Shoa Foundation" enthalten sind.
Ziel der Arbeit ist eine Untersuchung der medialen Zugangsarten zur NS-Vergangenheit und ihre Rezeption in Deutschland am Beispiel von Spielbergs "Schindlers Liste".
Wichtig bei der Arbeit sind folgende Leitfragen: Inwiefern stellt "Schindlers Liste" ein Mittel zur NS-Vergangenheitsbewältigung dar? Auf welche Weise gelingt es Spielberg mit seinem Film die Menschen derart zu fesseln und für Aufregung zu sorgen? Gibt es bestimmte Gestaltungsmittel, die dazu verwendet werden? Wie legitim ist es, dass ein Amerikaner und nicht Deutsche das Thema Holocaust in Filmen verarbeiten? Wie reagierten die Menschen auf den Film?
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung und Ziel der Arbeit; Leitfragen
- Mediale Zugangsarten zur NS-Vergangenheit und ihre Rezeption am Beispiel von Spielbergs ,,Schindlers Liste“
- Inhalt
- Inhaltliche Gliederung und kurze Inhaltsangabe
- Einführung der Personen Schindler, Stern und Göth
- Charakterisierung der drei Hauptpersonen
- Gegensatz: Historische Wirklichkeit und filmische Umsetzung
- Figur des Itzhak Stern
- Liquidierung des Ghettos
- Erstellung der rettenden Liste
- Transport von Plaszów nach Brünnlitz
- Filmanalytisches – Gestaltungsmittel und ihre Wirkung
- Schwarzweiß und Farbe, Licht und Schatten
- Inserts
- Montage
- Kamera
- Humoristische Elemente
- Musik
- Stimmen zum Film
- Steven Spielberg
- Negative Kritik
- Positive Kritik
- Inhalt
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die medialen Zugangsarten zur NS-Vergangenheit und deren Rezeption in Deutschland anhand von Steven Spielbergs „Schindlers Liste“. Sie analysiert den Film hinsichtlich seines Inhalts, der filmischen Umsetzung im Vergleich zur historischen Realität, sowie der eingesetzten Gestaltungsmittel und ihrer Wirkung auf das Publikum. Die Rezeption des Films, inklusive positiver und negativer Kritik, wird ebenfalls beleuchtet.
- Der Inhalt und die narrative Struktur von „Schindlers Liste“
- Der Vergleich zwischen historischer Realität und filmischer Darstellung
- Die Analyse der filmischen Gestaltungsmittel und ihrer Wirkung
- Die Rezeption des Films in der deutschen Öffentlichkeit
- Die Rolle des Films als Mittel der Vergangenheitsbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Gliederung und Ziel der Arbeit; Leitfragen: Die Einleitung beschreibt den Prozess der deutschen Vergangenheitsbewältigung nach 1945 und führt in die Thematik der medialen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ein. Sie benennt "Schindlers Liste" als Fallbeispiel und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Inhaltsanalyse, den Vergleich von Film und Geschichte, die filmanalytische Betrachtung und die Rezeption umfasst. Die Leitfragen der Arbeit werden formuliert, die sich mit der Funktion des Films als Mittel der Vergangenheitsbewältigung, der Wirkung von Gestaltungsmitteln, der Legitimität der filmischen Aufarbeitung durch einen Amerikaner und den Reaktionen des Publikums beschäftigen.
Mediale Zugangsarten zur NS-Vergangenheit und ihre Rezeption am Beispiel von Spielbergs ,,Schindlers Liste“: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Inhaltsangabe von "Schindlers Liste", gegliedert in Sequenzen. Es beschreibt die Einführung der Hauptfiguren Oskar Schindler, Itzhak Stern und Amon Göth, wobei die jeweilige Charakterisierung im Kontext der Handlung dargestellt wird. Die unterschiedlichen Zugänge zur Darstellung der Figuren und der Handlung werden analysiert, um einen Einblick in die Erzählstruktur und die Intention des Films zu geben.
Schlüsselwörter
Schindlers Liste, Steven Spielberg, NS-Vergangenheit, Holocaust, Vergangenheitsbewältigung, Filmanalyse, Gestaltungsmittel, Rezeption, historische Wirklichkeit, filmische Umsetzung, Oskar Schindler, Itzhak Stern, Amon Göth.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Spielbergs "Schindlers Liste"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Steven Spielbergs Film "Schindlers Liste" als medialen Zugang zur NS-Vergangenheit und dessen Rezeption in Deutschland. Sie untersucht den Film inhaltlich, vergleicht die filmische Darstellung mit der historischen Realität, analysiert die filmischen Gestaltungsmittel und beleuchtet die öffentliche Rezeption, inklusive positiver und negativer Kritik. Ein zentrales Thema ist die Rolle des Films in der deutschen Vergangenheitsbewältigung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Punkte: den Inhalt und die narrative Struktur von "Schindlers Liste"; den Vergleich zwischen historischer Realität und filmischer Darstellung; die Analyse der filmischen Gestaltungsmittel (Schwarzweiß/Farbe, Licht/Schatten, Inserts, Montage, Kameraführung, Musik, Humor) und ihrer Wirkung; die Rezeption des Films in der deutschen Öffentlichkeit; und die Funktion des Films als Mittel der Vergangenheitsbewältigung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (Gliederung, Zielsetzung, Leitfragen), ein Hauptteil mit der detaillierten Analyse von "Schindlers Liste" (Inhaltsangabe, Vergleich Film/Geschichte, Filmanalyse, Rezeptionsanalyse) und einer Schlussbetrachtung. Die Einleitung beschreibt den Kontext der deutschen Vergangenheitsbewältigung und die Relevanz des gewählten Fallbeispiels. Der Hauptteil untersucht die Figuren Schindler, Stern und Göth, analysiert verschiedene Sequenzen und beleuchtet die filmischen Gestaltungsmittel im Detail. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Figuren stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Hauptfiguren Oskar Schindler, Itzhak Stern und Amon Göth stehen im Zentrum der Analyse. Ihre Charakterisierung und Darstellung im Film werden im Kontext der Handlung untersucht und miteinander verglichen. Der Fokus liegt auf der jeweiligen filmischen Umsetzung und deren Vergleich mit den historischen Fakten.
Welche filmischen Gestaltungsmittel werden analysiert?
Die Analyse umfasst eine detaillierte Betrachtung verschiedener filmischer Gestaltungsmittel, darunter der Einsatz von Schwarzweiß und Farbe, Licht und Schatten, Inserts, Montagetechniken, Kameraführung, humoristische Elemente und die Musik. Die Wirkung dieser Mittel auf den Zuschauer und ihre Bedeutung für die filmische Erzählung werden untersucht.
Wie wird die Rezeption des Films behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Rezeption von "Schindlers Liste" in der deutschen Öffentlichkeit. Sie berücksichtigt sowohl positive als auch negative Kritiken und analysiert die unterschiedlichen Reaktionen auf den Film. Der Fokus liegt auf der Frage, wie der Film in der deutschen Gesellschaft aufgenommen wurde und welche Rolle er in der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit spielt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schindlers Liste, Steven Spielberg, NS-Vergangenheit, Holocaust, Vergangenheitsbewältigung, Filmanalyse, Gestaltungsmittel, Rezeption, historische Wirklichkeit, filmische Umsetzung, Oskar Schindler, Itzhak Stern, Amon Göth.
- Arbeit zitieren
- Jacqueline Koller (Autor:in), 2007, Mediale Zugangsarten zur NS-Vergangenheit und ihre Rezeption in Deutschland (am Beispiel "Schindlers Liste"), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/167394