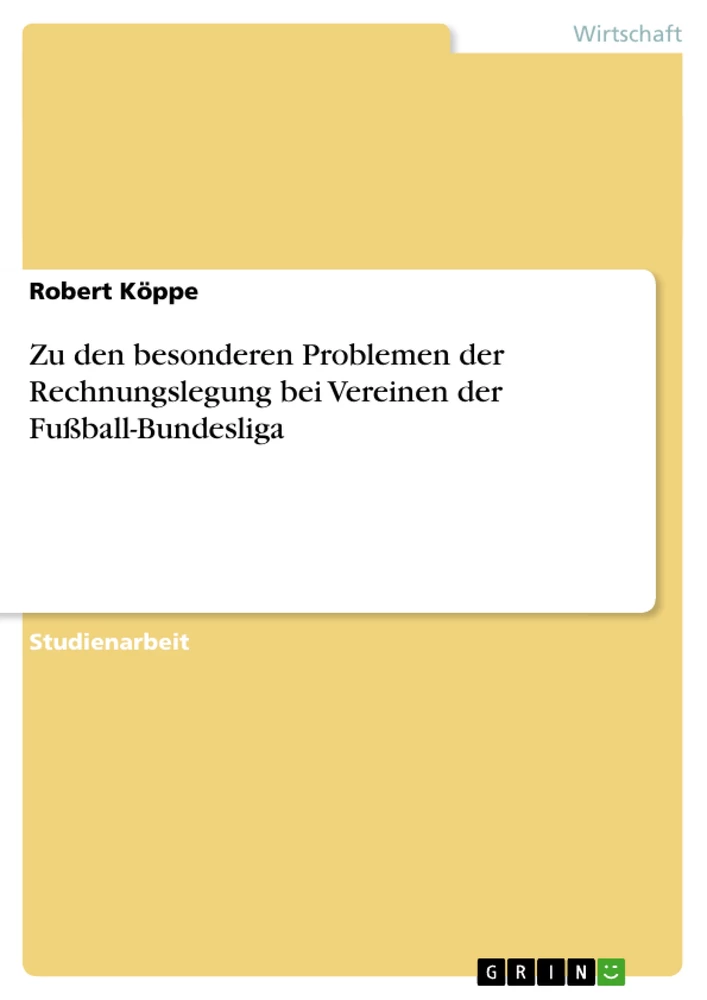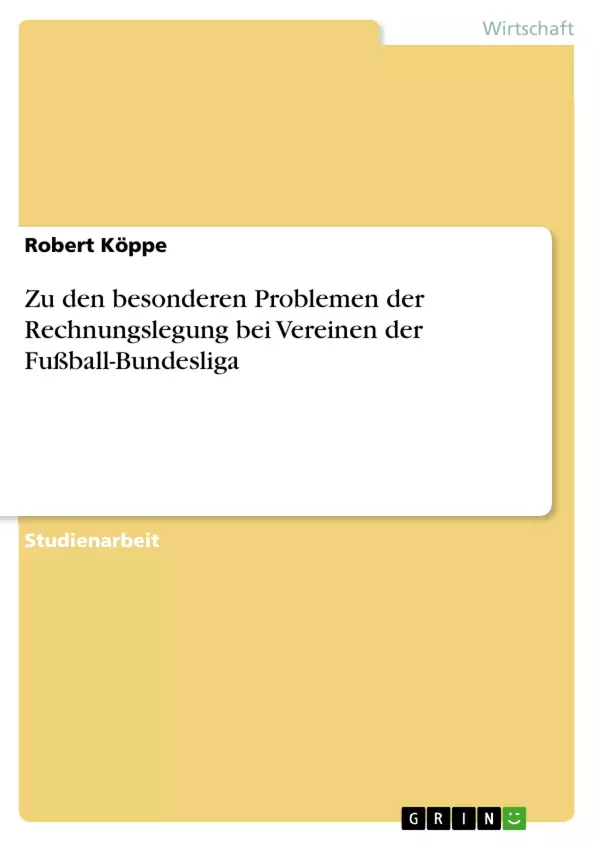Die Lizenzerteilung durch den Deutschen Fußball Bund berechtigt den jeweiligen Fußballverein zur Teilnahme an der Fußball-Bundesliga. Sie stellt daher eine Spielerlaubnis dar. Die Lizenzerteilung ist hauptsächlich an die wirtschaftliche Gesundheit der Vereine gebunden. Dabei ist es von grundlegender Bedeutung, dass der jeweilige Verein die abgelaufene Spielzeit und auch die kommende Spielzeit der 1. oder 2. Fußball-Bundesliga aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchhalten kann. Dies bedeutet, dass eine insolvenzrechtliche Gefährdung des entsprechenden Vereins nicht vorliegt oder innerhalb der folgenden Spielzeit nicht zu erwarten ist.
[...]
Die Lizenzspieler stellen für die Vereine der Fußball-Bundesliga die wichtigste Existenzgrundlage dar, da von ihnen sowohl der sportliche als auch der wirtschaftliche Erfolg abhängt. Daher ist es für die Vereine zwingend notwendig ihre Existenzgrundlage auch als Vermögen in der Bilanz auszuweisen. Ist diese Darstellung von Humankapital handelsrechtlich überhaupt zulässig?
Die Bilanzierung von Lizenzspielern ist maßgeblich davon abhängig, ob es möglich ist, die grundlegenden Tatbestandsmerkmale eines Vermögensgegenstandes in den Eigenschaften der Lizenzspieler wieder zu finden. Dabei ist die abstrakte Aktivierungsfähigkeit eines Lizenzspielers zu prüfen.
[...]
Bekannterweise werden bei den Verpflichtungen von Lizenzspielern Handgelder an die Spieler bzw. die Spielervermittler bzw. –berater gezahlt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsabgrenzung
- Problemstellung
- Rahmenbedingungen der Rechnungslegung von Vereinen der Fußball-Bundesliga
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Gesellschaftsformen in der Fußball-Bundesliga
- Lizenzerteilung durch den Deutschen Fußball Bund
- Bilanzierungsvorschriften nach HGB
- Bilanzierung von Aktivpositionen
- Bilanzierung von Passivpositionen
- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Einnahmequellen der Vereine
- Das Bossmann-Urteil und seine Folgen
- Analyse zu den Problemen der Rechnungslegung von Vereinen der Fußball-Bundesliga
- Besonderheiten aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen
- Gesellschaftsform
- Wirtschaftsjahr
- Bilanzierung von Aktivpositionen
- Lizenzspieler
- Anzahlungen auf zukünftige Lizenzspieler
- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- „Handgelder“ für Verträge mit neuen Lizenzspielern
- Versicherungen für Lizenzspieler über die gesamte Vertragslaufzeit
- Bilanzierung von Passivpositionen
- Personalbezogene Rückstellungen
- Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- Passive Rechnungsabgrenzungsposten
- Erlöse aus internationalen Wettbewerben
- Dauerkarten
- Erlöse aus Sponsoringverträgen
- Erlöse aus der Vermarktung des Stadions
- Praktische Beispiele
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den besonderen Problemen der Rechnungslegung bei Vereinen der Fußball-Bundesliga. Ziel ist es, die Herausforderungen und Besonderheiten in diesem Bereich aufzuzeigen und zu analysieren.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Rechnungslegung von Vereinen der Fußball-Bundesliga
- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Einnahmequellen der Vereine
- Besonderheiten der Bilanzierung von Aktiv- und Passivpositionen
- Praktische Beispiele aus der Rechnungslegung von Vereinen der Fußball-Bundesliga
- Kritische Würdigung der aktuellen Rechnungslegungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung definiert den Begriff der Rechnungslegung und stellt die Problemstellung der Arbeit dar.
- Kapitel 2 analysiert die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Rechnungslegung von Vereinen der Fußball-Bundesliga. Es werden die Gesellschaftsformen, die Lizenzerteilung durch den DFB und die Bilanzierungsvorschriften nach HGB erläutert. Darüber hinaus werden die Einnahmequellen der Vereine und die Auswirkungen des Bossmann-Urteils auf die Rechnungslegung betrachtet.
- Kapitel 3 befasst sich mit den besonderen Problemen der Rechnungslegung von Vereinen der Fußball-Bundesliga. Es werden die Besonderheiten aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen, die Bilanzierung von Aktiv- und Passivpositionen sowie praktische Beispiele aus der Rechnungslegungspraxis analysiert.
Schlüsselwörter
Rechnungslegung, Vereine, Fußball-Bundesliga, Bilanzierung, Aktivpositionen, Passivpositionen, Lizenzspieler, Sponsoring, Bossmann-Urteil, HGB, DFB.
- Quote paper
- Diplom-Kaufmann (FH) Robert Köppe (Author), 2008, Zu den besonderen Problemen der Rechnungslegung bei Vereinen der Fußball-Bundesliga, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/166193