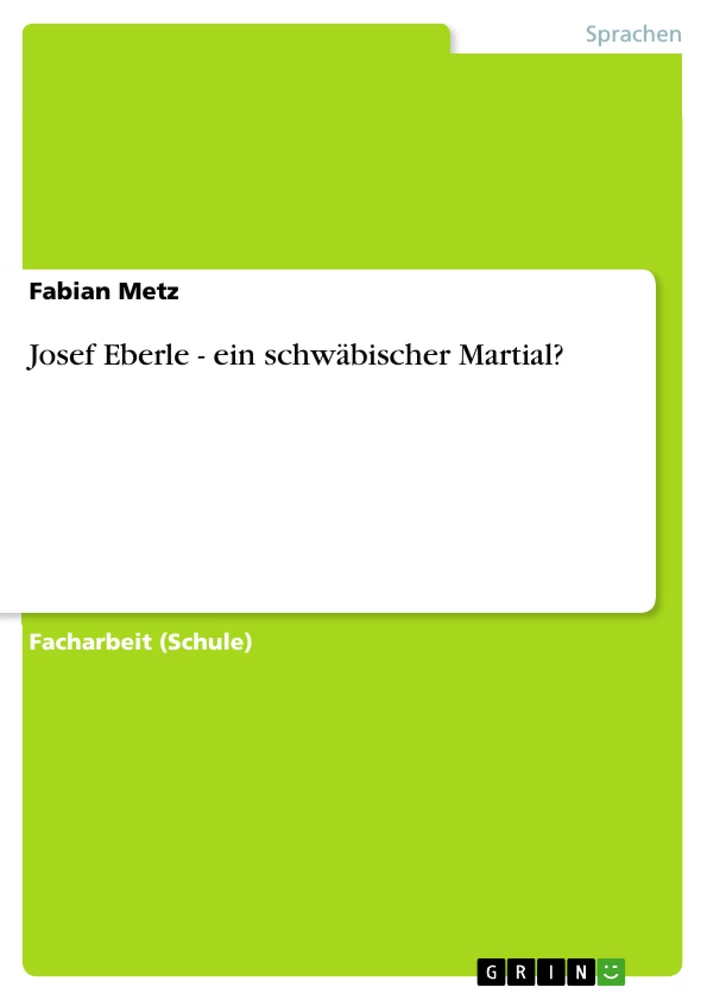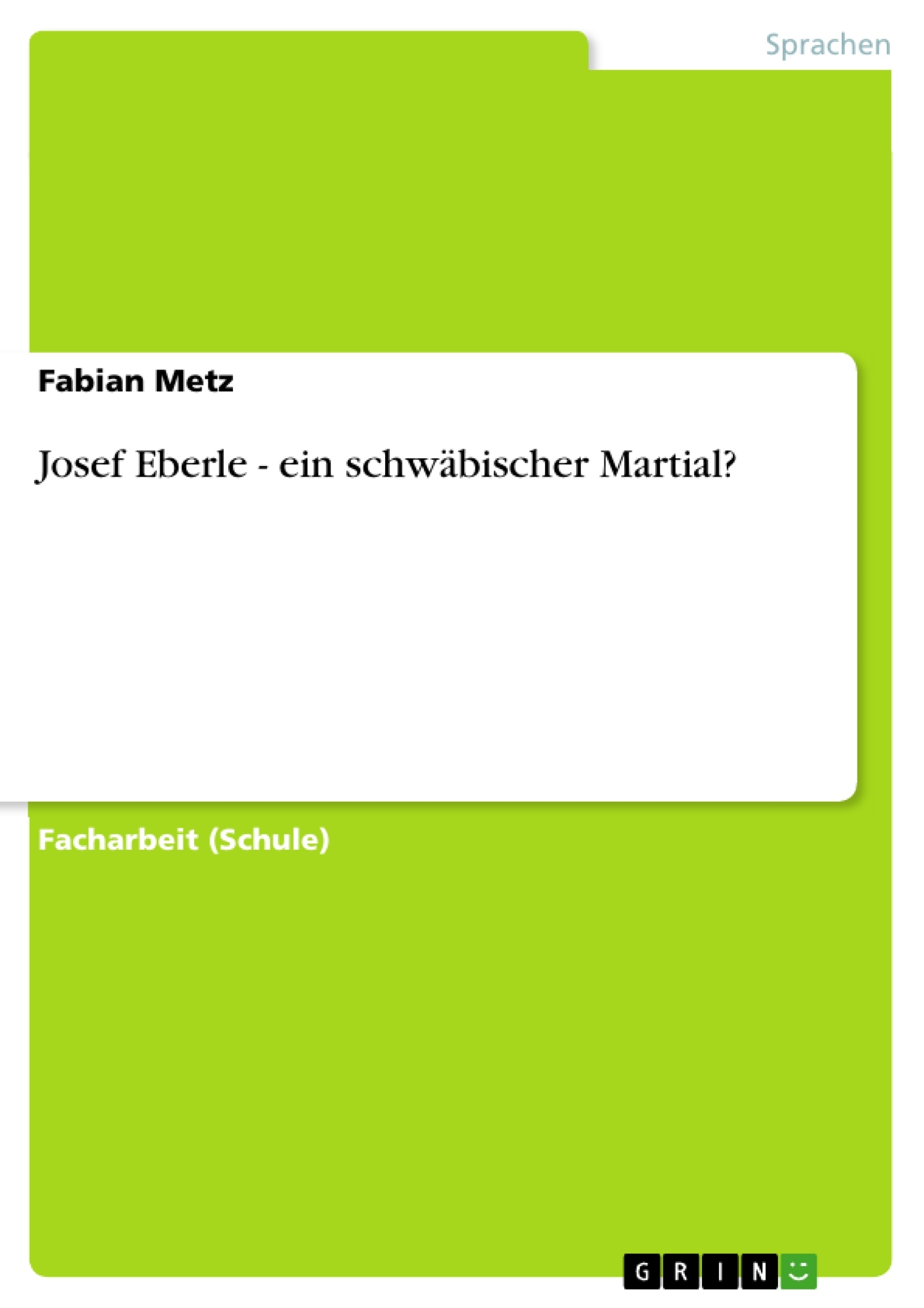„Et quis cras Latii voce peritus erit?“
Zwar gilt das Lateinische schon immer als Sprache der Gelehrten, dennoch sehen viele Menschen in ihr eine „tote“ oder zumindest eine „aussterbende Sprache“, wie auch Josef Eberle, die Hauptfigur der folgenden Arbeit, befürchtete. Diese Sorge machte er durch seine selbst erstellte und eingangs schon zitierte Grabinschrift deutlich. Aber waren seine Ängste begründet, wo sich doch heute noch zahlreiche Schüler durch den Lateinunterricht plagen müssen? Außerdem herrscht ja die weit verbreitete Meinung, Latein könne man nur noch im Vatikan verwenden. Kaum einer hat bestimmt gewusst, dass es auch zahlreiche Autoren außerhalb des heiligen Stuhls gibt, die diese alte Sprache noch heute verbreiten. Einer von ihnen war ebendieser Josef Eberle, ein schwäbischer Schriftsteller der bis 1986 gelebt hat. Er hatte die Sorge, dass „schon morgen vielleicht keiner Latein mehr verstehn“ wird. Einige seiner Werke, bei denen er vor allem die Form des Epigramms umzusetzen versuchte, sollen im Folgenden vorgestellt werden.
Als Vorbild könnte ihm hierbei ein anderer Dichter, der diese Art des Epigramms, allerdings schon in der Antike sehr geprägt hat, gewesen sein: M. Valerius Martialis. Deshalb ist der folgenden Arbeit zum Ziele gesetzt, der Frage etwas näher zu kommen, inwiefern Josef Eberle auch als „schwäbischer Martial“ bezeichnet werden kann. Anfangs werden die Biographien der beiden Schriftsteller vorgestellt, um so eventuelle Parallelen schon im „curriculum vitae“ aufzuzeigen.
Schließlich werden Werke dieser beiden Dichter, die über 1850 Jahre auseinander gelebt haben, genauer betrachtet. Natürlich kann nur auf ausgewählte Gedichte eingegangen werden, die gegenübergestellt werden sollen, sodass auch hier Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden können. Zum besseren Verständnis beschäftigt sich diese Arbeit außerdem mit den Grundlagen des römischen Epigramms.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Biographien
- Martials Lebenslauf
- Eberles Lebenslauf
- Gemeinsamkeiten der Lebensläufe
- Das antike Epigramm
- Entstehung und Entwicklung bis Martial
- Besonderheiten des römischen Epigramms nach Martial
- Josef Eberle – ein schwäbischer Martial?
- Josef Eberle als lateinischer Dichter
- Eberles Meinung über Martial
- Gemeinsamkeiten der literarischen Werke
- Vergleiche zwischen Martials und Eberles Epigrammen
- Vergleich Martial I, 10 mit „In acerbam venustam“
- Komparative Analyse der Texte
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Vergleich Martial XIII, 56 mit „Variatio epigrammatis M. Valerii Martialis“
- Komparative Analyse der Texte
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Vergleich Martial XIII, 20 mit „Compromissum“
- Komparative Analyse der Texte
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Vergleich Martial I, 10 mit „In acerbam venustam“
- Resümee – Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Facharbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Josef Eberle als „schwäbischer Martial“ bezeichnet werden kann. Im Zentrum der Analyse stehen die Biographien der beiden Dichter sowie Vergleiche ihrer Epigramme. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Lebensläufen und Werken aufzuzeigen und die Bedeutung des römischen Epigramms für Eberles Schaffen zu beleuchten.
- Vergleich der Biographien von Martial und Josef Eberle
- Analyse des römischen Epigramms und seiner Entwicklung
- Bedeutung des Epigramms für Josef Eberles Schaffen
- Komparative Analyse ausgewählter Epigramme von Martial und Eberle
- Beurteilung der Vergleichbarkeit von Martial und Eberle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas „Josef Eberle, ein schwäbischer Martial?“ beleuchtet. Anschließend werden die Biographien von Martial und Eberle vorgestellt, wobei insbesondere Parallelen in ihren Lebensläufen hervorgehoben werden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung des römischen Epigramms bis hin zu Martial. Im Fokus steht die Bedeutung des Epigramms als literarische Form und seine Besonderheiten in der römischen Kultur. Das vierte Kapitel untersucht Josef Eberle als lateinischen Dichter und stellt seine Wertschätzung für Martial dar. Anschließend werden Gemeinsamkeiten in ihren literarischen Werken und Schreibstilen herausgearbeitet. Die Kapitel 5 und 6 widmen sich dem Vergleich ausgewählter Epigramme von Martial und Eberle. In einer komparativen Analyse werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Autoren hinsichtlich ihrer Themenwahl, ihrer Sprache und ihrer dichterischen Mittel aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Facharbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich zweier Dichter, Martial und Josef Eberle, und beleuchtet die Bedeutung des römischen Epigramms für Eberles Schaffen. Schwerpunkte sind die Analyse der Biographien, die literarischen Werke und die komparative Analyse ausgewählter Epigramme. Die Arbeit beleuchtet Themen wie die Entstehung und Entwicklung des Epigramms, die literarische Tradition, die poetischen Mittel und die Bedeutung der Sprache für das Verständnis der beiden Dichter.
- Quote paper
- Fabian Metz (Author), 2010, Josef Eberle - ein schwäbischer Martial?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165993