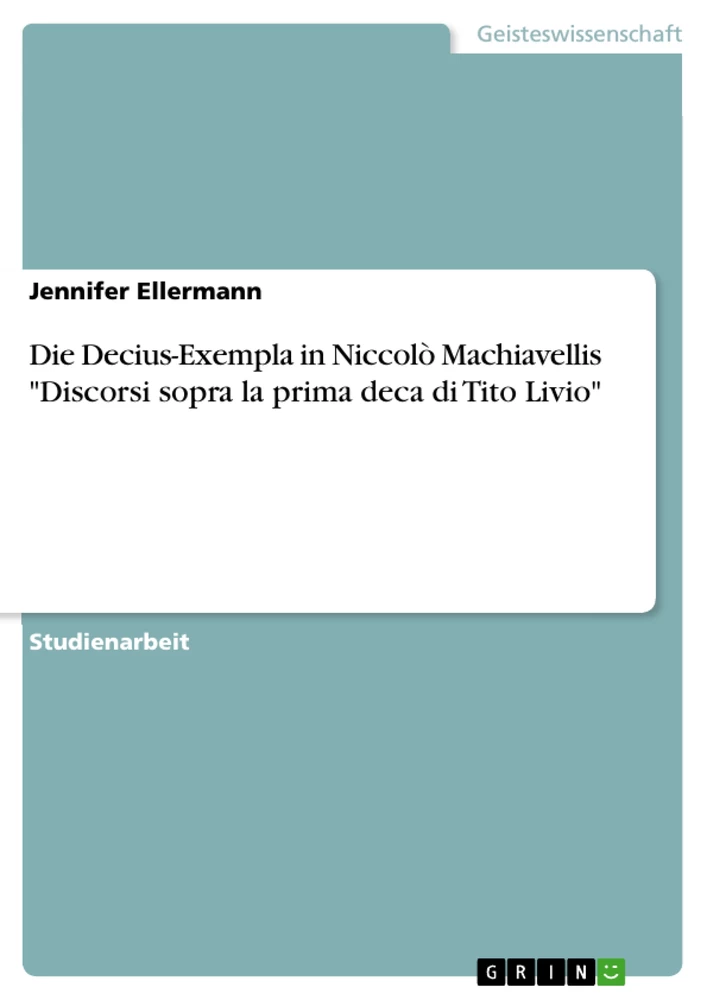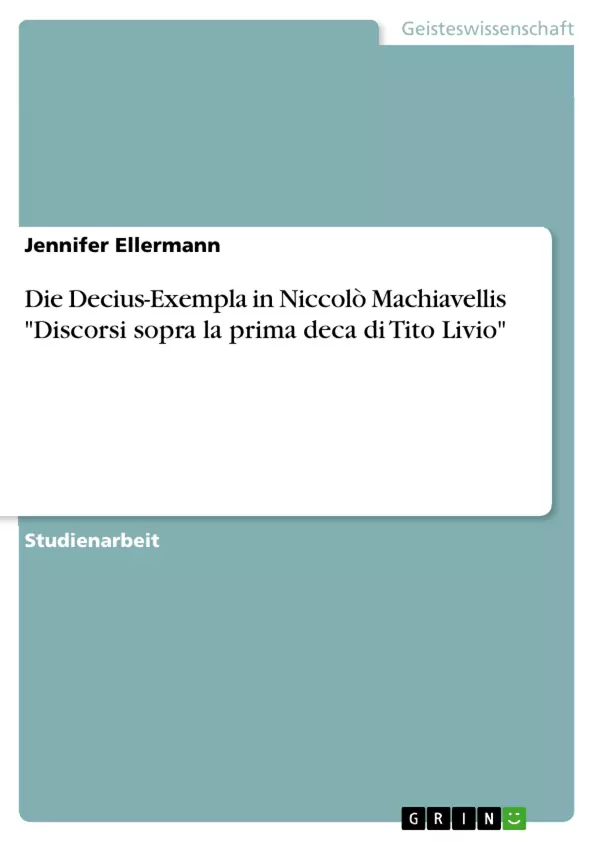Niccolò Machiavelli, eigentlich Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, wurde am 3. Mai 1449 in Florenz geboren und starb dort am 21. Juni 1527. Er lebte somit zum einen während einer Zeit, in der die „Grundfesten der mittelalterlichen Welt […] erschüttert (waren)“, und man „nach neuen Formen“ suchte, die man nach der Abkehr von der heiligen Scheu und der Jenseitsorientierung in der Hinwendung zum Diesseits und der Entdeckung des Individuums fand: der Renaissance; zum anderen lebte er in einem Land, in dem „in den besten Köpfen die Sehnsucht nach […] einem einheitlichen Nationalstaat“ brannte, für dessen Gestaltung jedoch im Italien der Renaissance aufgrund komplizierter Machtkonstellationen kein Raum war. Machiavellis Vater ermöglichte seinem Sohn trotz seines geringen Verdienstes als Anwalt und der hohen Kosten eine „ausgezeichnete Einführung in die ,studia humanitatis’“ , also der damals aufkommenden Geisteshaltung des Humanismus, zu deren führenden Vertretern M. heute gezählt wird. Im Rahmen dieser Ausbildung erwarb er umfassende Kenntnisse über antike Autoren sowie deren Schriften und lernte „Grammatik und Latein […] in einem Alter, in dem man nach dem Aufbau modernen Schulunterrichts noch in der Muttersprache weder lesen noch schreiben kann“ . Somit ist es nicht verwunderlich, dass M. in seinen Discorsi, also seiner Auseinandersetzung mit den „Problemen der inneren und äußeren Politik, der Staatsführung, der Verfassung und Verwaltung, der Volkswirtschaft, Kolonialpolitik und Kriegsführung“ einen antiken Geschichtsschreiber zu Rate zog. Dass er sich letztlich für Titus Livius entschied, statt z.B. für Tacitus, liegt nach Zorn zum einen am Stoff, da sich nur Livius mit der Gründung des römischen Staates befasst habe, zum anderen an der Tatsache, dass beide überzeugte Republikaner gewesen seien.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Leben(szeit) und Werk Machiavellis
- 2. Prämissen, Fragestellung und Zielsetzung der Discorsi
- 2.1. Die Bedeutung der Geschichte
- 3. (Anti-)Machiavellismus
- 3.1. Der Vorwurf des Machiavellismus
- 3.2. Machiavellis Standpunkt zum Moralischen
- 3.3. Die Kirche und die Moral
- 3. Die Decius-exempla bei Machiavelli
- 3.1. Die Notwendigkeit des "außerordentlichen Vorfalls"
- 3.2. Die Bedeutung des exemplums
- 3.3. Die Rolle der Religion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In seinen "Discorsi sopra la prima deca di Livio" untersucht Niccolò Machiavelli das Phänomen des Aufstiegs und Falls von Staaten, insbesondere am Beispiel der römischen Republik. Durch die Analyse historischer Ereignisse möchte Machiavelli die Ursachen für Roms langfristigen Erfolg und die Gründe für den späteren Verfall des römischen Staates verstehen.
- Die Bedeutung von Geschichte als Spiegel der menschlichen Natur und als Quelle für politische Lehre
- Der zykliche Charakter der Geschichte und die Wiederholung von Ereignissen, insbesondere die Entstehung und der Verfall von Staaten
- Die Rolle von "virtù" und "fortuna" im politischen Erfolg und die Herausforderungen, diese Faktoren dauerhaft zu beeinflussen
- Die Bedeutung der Religion als moralische Grundlage für die Stabilität eines Staates
- Der Einfluss von politischer Führung und institutionellen Strukturen auf den Aufstieg und Fall von Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Leben und Werk Machiavellis, sowie den historischen und politischen Umständen, die ihn prägten. Besondere Bedeutung wird dem Einfluss der Renaissance und dem Wunsch nach einem einheitlichen italienischen Nationalstaat auf Machiavellis Denken gelegt.
- Kapitel 2: Hier werden die zentralen Prämissen von Machiavellis Untersuchung erläutert, die Annahme der gleichbleibenden menschlichen Natur sowie die Auffassung von Geschichte als zyklischem Prozess. Machiavelli argumentiert, dass der Mensch von Natur aus schlecht ist und seinen bösen Neigungen folgt, was zu einem ständigen Wandel von Staaten führt.
- Kapitel 3: Machiavelli analysiert die Ursachen für Roms Erfolg und untersucht, wie sich die Stadt über mehrere Jahrhunderte hinweg eine "außerordentliche Tüchtigkeit" erhalten konnte. Dabei stellt er die Rolle von "virtù" und "fortuna" heraus und untersucht, wie diese Faktoren zum Aufbau und zur Erhaltung eines starken Staates beitragen.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit dem "Machiavellismus" und der Kritik an Machiavellis Lehren. Es werden die Vorwürfe der Skrupellosigkeit und der Amoralität, die gegen Machiavelli erhoben werden, beleuchtet und es wird versucht, diese Kritikpunkte zu widerlegen.
- Kapitel 5: Machiavelli analysiert die exempla der Decii und deren Bedeutung für die Erhaltung eines Staates. Er argumentiert, dass die "virtù" eines einzelnen Mannes zwar zum Erfolg beitragen kann, aber nur für einen begrenzten Zeitraum wirken kann. Eine dauerhafte Stabilität kann nur durch die Aufrechterhaltung der Religion erreicht werden, die die Menschen inspiriert und zu moralischem Handeln motiviert.
Schlüsselwörter
Die "Discorsi sopra la prima deca di Livio" behandeln zentrale Fragen der Politik, der Geschichte und der menschlichen Natur. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: "virtù" (Tugend, Fähigkeit), "fortuna" (Glück, Schicksal), "ambizione" (Ehrgeiz), "Republik", "Staat", "Degeneration", "Religion", "Exempla", "Geschichte", "Zyklus", "politische Lehre", "Menschliche Natur", "Machiavellismus".
- Quote paper
- Jennifer Ellermann (Author), 2011, Die Decius-Exempla in Niccolò Machiavellis "Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165969