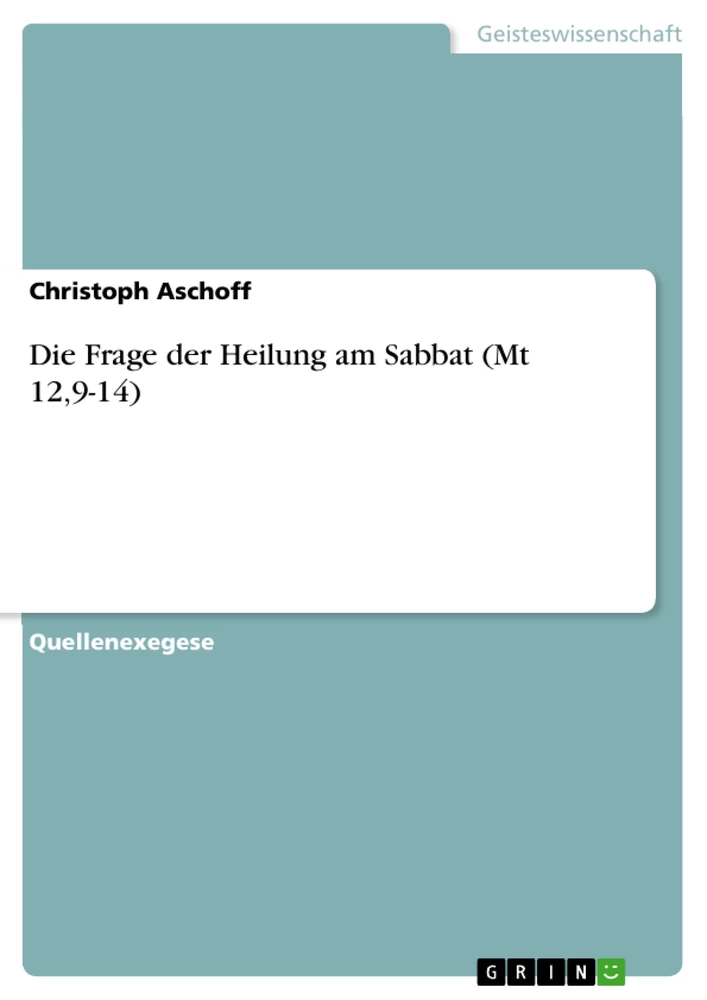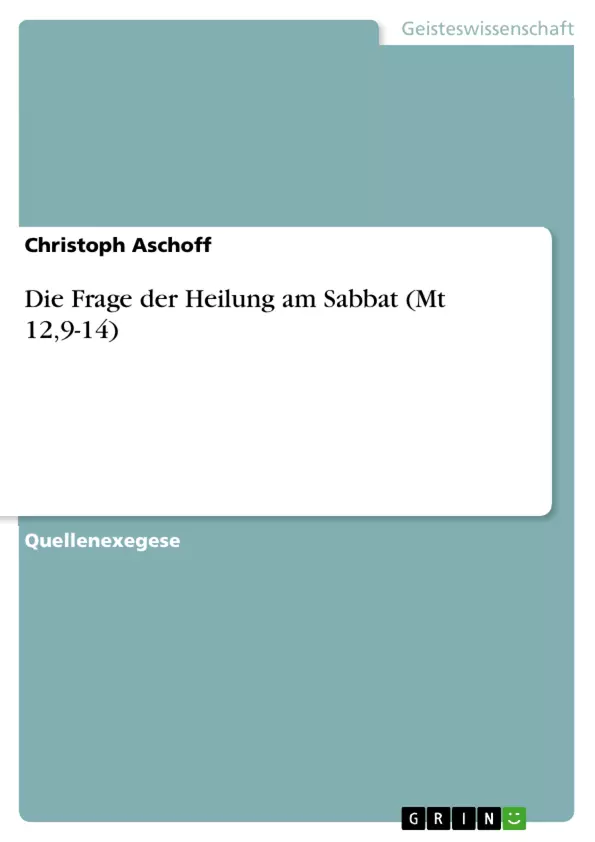In der vorliegenden Arbeit wird eine Exegese der neutestamentlichen Perikope Mt 12,9-14 vorgenommen, in der Jesus von Nazareth die Hand eines Mannes heilt. Da diese Heilung am Sabbat geschieht, gerät Jesus in Konflikt mit der religiösen Gruppierung der Pharisäer.
Die methodische Grundlage für die Auslegung stellt die historisch-kritische Methode dar. Die Exegese umfasst demnach Textkritik, Literarkritik, Formgeschichte, Traditionsgeschichte und Redaktionsgeschichte, Einzelauslegung sowie eine biblisch-theologische Reflexion.
Inhaltsverzeichnis
- I. Der Text
- 1. Übersetzung
- 2. Textkritik
- II. Literarkritik
- 1. Stellung im Kontext
- 2. Abgrenzung
- 3. Gliederung
- 4. Einheitlichkeit des Textes
- 5. Quellenanalyse und synoptischer Vergleich
- III. Formgeschichte
- 1. Feststellung der Gattung
- 2. Erhebung des Sitzes im Leben
- 3. Rekonstruktion der Überlieferungsgeschichte
- IV. Traditionsgeschichte
- 1. Der Sabbat
- 2. Die Pharisäer
- V. Redaktionsgeschichte
- VI. Einzelauslegung
- VII. Biblisch-theologische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Perikope der Sabbatheilung in Matthäus 12,9-14. Ziel ist es, den Text durch Übersetzung, Textkritik, literarkritische, formgeschichtliche und traditionsgeschichtliche Analyse zu verstehen und seine Bedeutung im Kontext des Matthäusevangeliums zu beleuchten. Die Einzelauslegung und biblisch-theologische Reflexion sollen zu einem tieferen Verständnis des Textes und seiner Relevanz beitragen.
- Textkritische Analyse von Matthäus 12,9-14
- Literarische Einordnung der Perikope im Matthäusevangelium
- Die Bedeutung des Sabbats im Kontext des Textes
- Der Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern
- Theologische Implikationen der Sabbatheilung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Der Text: Dieses Kapitel beginnt mit der Übersetzung des griechischen Textes von Matthäus 12,9-14 nach Nestle-Aland. Es folgt eine detaillierte textkritische Analyse verschiedener Lesarten, die sowohl die äußere (Manuskriptüberlieferung) als auch die innere Kritik (grammatikalische und semantische Aspekte) einbezieht. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Varianten und der Begründung für die Wahl der bevorzugten Lesart im Nestle-Aland-Text.
II. Literarkritik: Dieser Abschnitt untersucht die Stellung der Perikope der Sabbatheilung im Kontext des Matthäusevangeliums. Es wird die Einordnung in den Gesamtkontext des Evangeliums, insbesondere innerhalb der galiläischen Streitgespräche, erläutert. Die Abgrenzung der Perikope von anderen Textteilen wird diskutiert, wobei verschiedene Bibelausgaben und Übersetzungen verglichen werden. Schließlich wird die Einheitlichkeit des Textes und dessen sprachliche Verbindungen zu anderen Passagen analysiert.
Schlüsselwörter
Matthäus 12,9-14, Sabbatheilung, Textkritik, Literarkritik, Formgeschichte, Traditionsgeschichte, Pharisäer, Jesus, Konflikt, Bibelauslegung, theologische Implikation, Nestle-Aland.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Perikope Matthäus 12,9-14
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Perikope der Sabbatheilung in Matthäus 12,9-14. Sie untersucht den Text umfassend mittels Übersetzung, Textkritik, literarkritischer, formgeschichtlicher und traditionsgeschichtlicher Methoden, um seine Bedeutung im Kontext des Matthäusevangeliums zu verstehen.
Welche Methoden werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse verwendet eine Vielzahl von Methoden, darunter:
- Übersetzung des griechischen Urtextes (Nestle-Aland)
- Textkritik (äußere und innere Kritik)
- Literarkritik (Stellung im Kontext, Abgrenzung, Gliederung, Einheitlichkeit, Quellenanalyse)
- Formgeschichte (Gattung, Sitz im Leben, Überlieferungsgeschichte)
- Traditionsgeschichte (z.B. Sabbat, Pharisäer)
- Redaktionsgeschichte
- Einzelauslegung
- Biblisch-theologische Reflexion
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte:
- Textkritische Analyse von Matthäus 12,9-14
- Literarische Einordnung der Perikope im Matthäusevangelium
- Die Bedeutung des Sabbats im Kontext des Textes
- Der Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern
- Theologische Implikationen der Sabbatheilung
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, die sich mit verschiedenen Aspekten des Textes befassen. Diese Kapitel umfassen die Übersetzung und Textkritik des griechischen Originals, die literarkritische Einordnung im Matthäusevangelium, die formgeschichtliche und traditionsgeschichtliche Analyse sowie die Einzelauslegung und biblisch-theologische Reflexion. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Matthäus 12,9-14, Sabbatheilung, Textkritik, Literarkritik, Formgeschichte, Traditionsgeschichte, Pharisäer, Jesus, Konflikt, Bibelauslegung, theologische Implikation, Nestle-Aland.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, durch eine umfassende Analyse den Text von Matthäus 12,9-14 zu verstehen und seine Bedeutung im Kontext des Matthäusevangeliums zu beleuchten. Die Einzelauslegung und biblisch-theologische Reflexion sollen zu einem tieferen Verständnis des Textes und seiner Relevanz beitragen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bietet eine Zusammenfassung. Für detaillierte Informationen konsultieren Sie bitte den vollständigen Text der Arbeit.
- Quote paper
- Christoph Aschoff (Author), 2006, Die Frage der Heilung am Sabbat (Mt 12,9-14), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165878