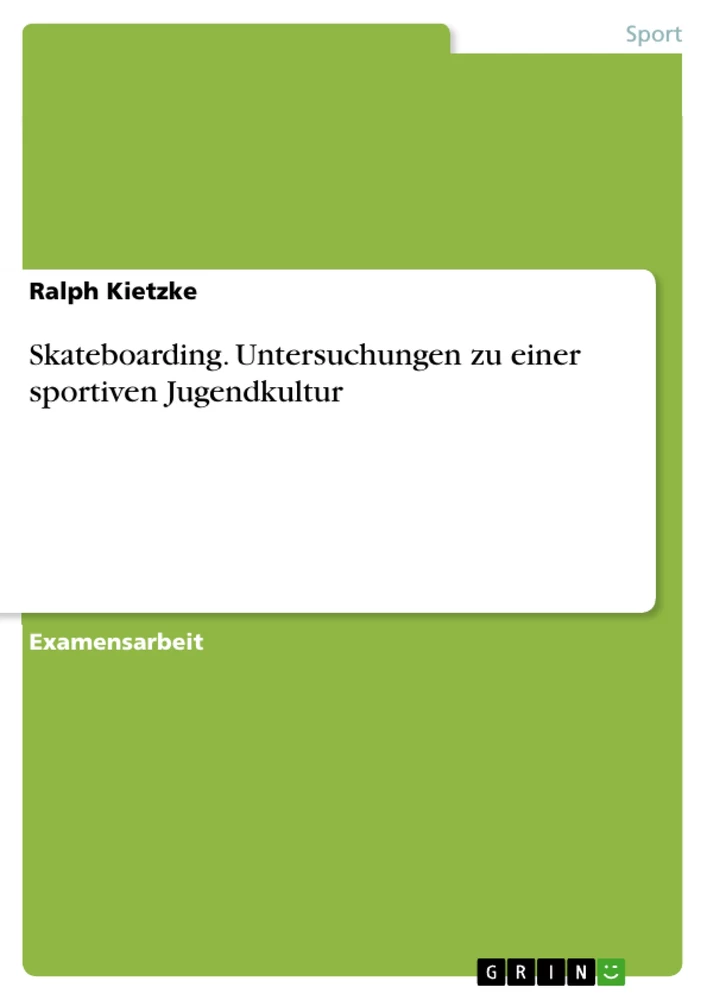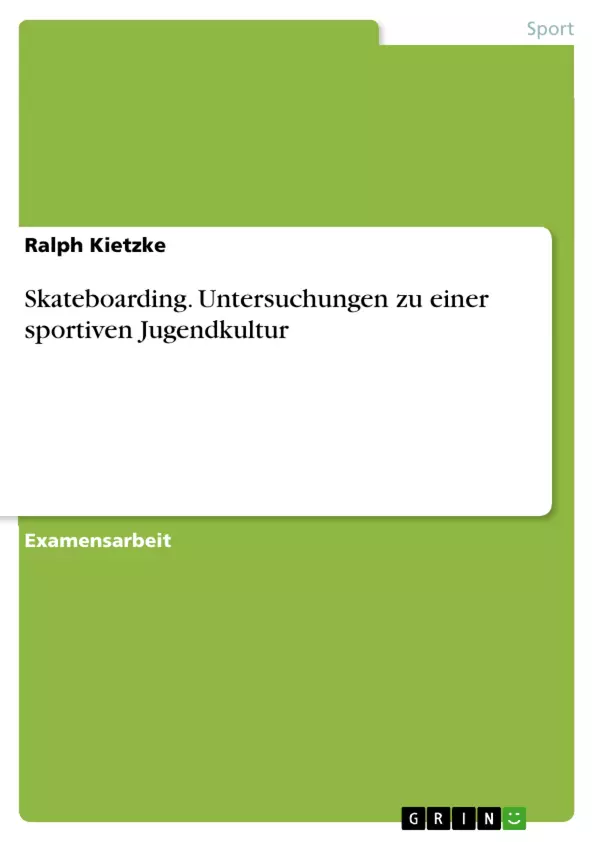Als ich das erste Mal in Kontakt mit der Jugendkultur Skateboarding kam, wirkte sie auf mich zunächst wild, anarchistisch, bunt, kreativ und vor allem elitär. Ihre Sprache war mir unverständlich und die Inhalte ihrer Aktivitäten erschlossen sich mir nur in einem geringen Maße. Sie stellte eine, durch einen hohen Grad innerer Verbundenheit gekennzeichnete, überschaubare Gruppe dar, die sich von der restlichen Gesellschaft durch ihren Habitus distanzierte. Gerade deswegen übte diese Jugendkultur eine große Faszination auf mich aus. Beeindruckend ist es für mich nach wie vor, wie sich Jugendliche um das Thema Skateboarding eine eigene Lebenswelt erschaffen, in der jenseits eines systematischen Vereinstrainings oder pädagogischen Einwirkens, enorme sportliche Leistungen vollbracht werden. Die Bewegungen der Skater sind ebenso spektakulär wie technisch und motorisch hoch anspruchsvoll.
Durch die spektakuläre Art der Bewegungen und dem, auf Distinktion abzielenden elitären Habitus seiner Akteure, übt Skateboarding eine große Anziehungskraft auch auf Jugendliche aus. Skateboarder gelten als exotische Trendsetter und modische Avantgarde. Dementsprechend werden sie als Imageträger von Werbe- und Bekleidungsfirmen umworben. Dass diese Jugendkultur aber nicht, wie vergleichbare andere, nach einem kurzen Moment des Skandalons, durch gesellschaftliche Vereinnahmung und Vermarktung entschärft wurde um sich daraufhin aufzulösen, verdient besondere Aufmerksamkeit. Es scheint daher nicht möglich, Skateboarding in einen Kontext mit modischen, plötzlich auftauchenden, sich verbreitenden und danach wieder verschwindenden Trendsportarten zu stellen. Skateboarding muss durch seine Verbindung von Sport und jugendkulturellem Ausdruck vielmehr als eine ernst zu nehmende Alternative zum traditionellen Vereinssport gesehen werden, die im Rahmen der Enttraditionalisierung moderner Gesellschaften immer populärer wird.
Insbesondere Sportwissenschaftler und Pädagogen müssen jugendliche Lebenswelten, außerhalb von Schule und Verein, verstehen können, wenn sie adäquat auf die Bedürfnisse ihrer ′Klienten′ reagieren wollen. Die Grundlage jedes Verstehens ist die nähere Beschäftigung mit dem Gegenstand. Dazu soll diese Arbeit einen Beitrag leisten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in das Thema
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Forschungsstand
- 1.4 Der theoretische Rahmen des Lebensstilkonzepts
- 1.5 Aufbau der Arbeit
- 2. Exkurs: Der historische Kontext
- 2.1 Vorgeschichte
- 2.2 Die erste kommerzielle Welle (USA: 1959-1963)
- 2.3 Die zweite Welle (USA: 1973-1980)
- 2.4 Die erste Skateboardwelle in Deutschland
- 2.5 Skateboarding in den achtziger Jahren
- 2.6 Die derzeitige Situation
- 2.7 Zusammenfassung
- 3. Methodologie
- 3.1 Diskussion der Methodenwahl
- 3.2 Die Praxis der qualitativen Forschung
- 3.2.1 Die beobachtende Teilnahme
- 3.2.2 Die qualitative Befragung
- 3.2.3 Das Skateboard-Magazin als Datenquelle
- 3.2.4 Der Alltagsdialog als Datenquelle
- 3.3 Durchführung der eigenen Forschung
- 4. Die Forschungsergebnisse
- 5. Auswertung der Forschungsergebnisse
- 5.1 Aktivitäten und Werthaltungen im Skateboarding
- 5.1.1 Allgemeine Aktivitäten
- 5.1.2 Informelle Aktivitäten
- 5.1.3 Die globale Gemeinschaft
- 5.2 Die Fotografie
- 5.3 Der Drogenkonsum
- 5.4 Affinitäten und Abgrenzungen zu anderen Jugendkulturen
- 5.5 Die Verteilung der Geschlechtsrollen
- 5.6 Die sportlichen Aktivitäten
- 5.6.1 Das Training
- 5.6.2 Über Konkurrenz und Kooperation
- 5.6.3 Die Ästhetik
- 5.6.4 Kreativität, Motivation und Flow
- 5.6.5 Der Wettkampf
- 5.7 Die Tricks
- 5.7.1 Basics
- 5.7.2 Technische Tricks
- 5.7.3 Grinds und Slides
- 5.7.4 Klassifizierung der Tricks
- 5.8 Die räumliche Dimension der Aktivitäten
- 5.8.1 Kritik des öffentliche Raums
- 5.8.2 Die Skatehalle
- 5.8.3 Jugendkulturelle Konflikte in der Skatehalle
- 5.9. Sozialstruktur und Hierarchisierung
- 5.9.1 Kapitalformen im Feld der Skateszene
- 5.9.2 Die Kernszene
- 5.9.2.1 Der gesponserte Fahrer
- 5.9.2.2 Der Fotografierte
- 5.9.3 Die Randszene
- 5.9.4 Die Freizeitszene
- 5.9.5 Die Sympathisanten
- 5.9.6 Zusammenfassung
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit im Fach Sport befasst sich mit der Jugendkultur Skateboarding und untersucht deren spezifischen Charakter und Anziehungskraft. Die Arbeit beleuchtet das Skateboarding als eine eigenständige Lebenswelt, die sich von traditionellem Vereinssport und anderen Jugendkulturen abgrenzt. Die Untersuchung geht der Frage nach, wie Skateboarding als eine sportliche Jugendkultur funktioniert, wie sie organisiert ist, welche Werte sie repräsentiert und wie sie sich im gesellschaftlichen Kontext positioniert.
- Analyse der Aktivitäten und Werthaltungen im Skateboarding
- Untersuchung der räumlichen Dimension und der Konflikte im öffentlichen Raum
- Beurteilung der Sozialstruktur und Hierarchisierung innerhalb der Skateszene
- Einordnung von Skateboarding in den Kontext der Jugendkulturforschung
- Analyse der sportlichen Aspekte und der Rolle des Trainings, der Ästhetik und des Wettbewerbs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Skateboarding ein und stellt die Forschungsfrage, welche die Untersuchung leitend ist. Sie erläutert den theoretischen Rahmen der Arbeit und skizziert den Aufbau. Kapitel 2 bietet einen historischen Exkurs in die Entwicklung des Skateboardings, von den Anfängen in den USA bis zur gegenwärtigen Situation. Kapitel 3 erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf qualitative Forschungsmethoden stützt. Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Forschung, bevor Kapitel 5 die Ergebnisse detailliert auswertet. Dieses Kapitel befasst sich mit den Aktivitäten und Werthaltungen im Skateboarding, der Rolle der Fotografie und des Drogenkonsums sowie den Beziehungen zu anderen Jugendkulturen. Es behandelt auch die Geschlechterrollen, die sportlichen Aspekte und die räumliche Dimension der Aktivitäten, sowie die soziale Struktur und Hierarchisierung innerhalb der Skateszene.
Schlüsselwörter
Skateboarding, Jugendkultur, Sport, Lebenswelt, Aktivitäten, Werthaltungen, Raum, Sozialstruktur, Hierarchisierung, Fotografie, Drogenkonsum, Geschlechterrollen, Training, Ästhetik, Wettbewerb, Traditioneller Vereinssport, Jugendkulturforschung
- Arbeit zitieren
- Ralph Kietzke (Autor:in), 2001, Skateboarding. Untersuchungen zu einer sportiven Jugendkultur, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1656