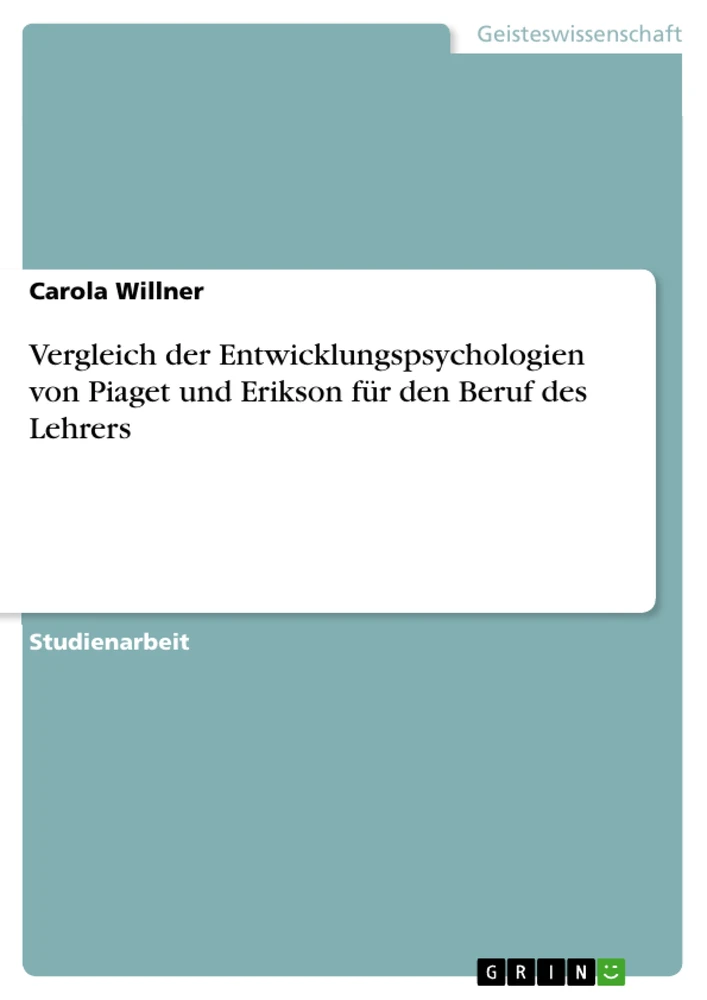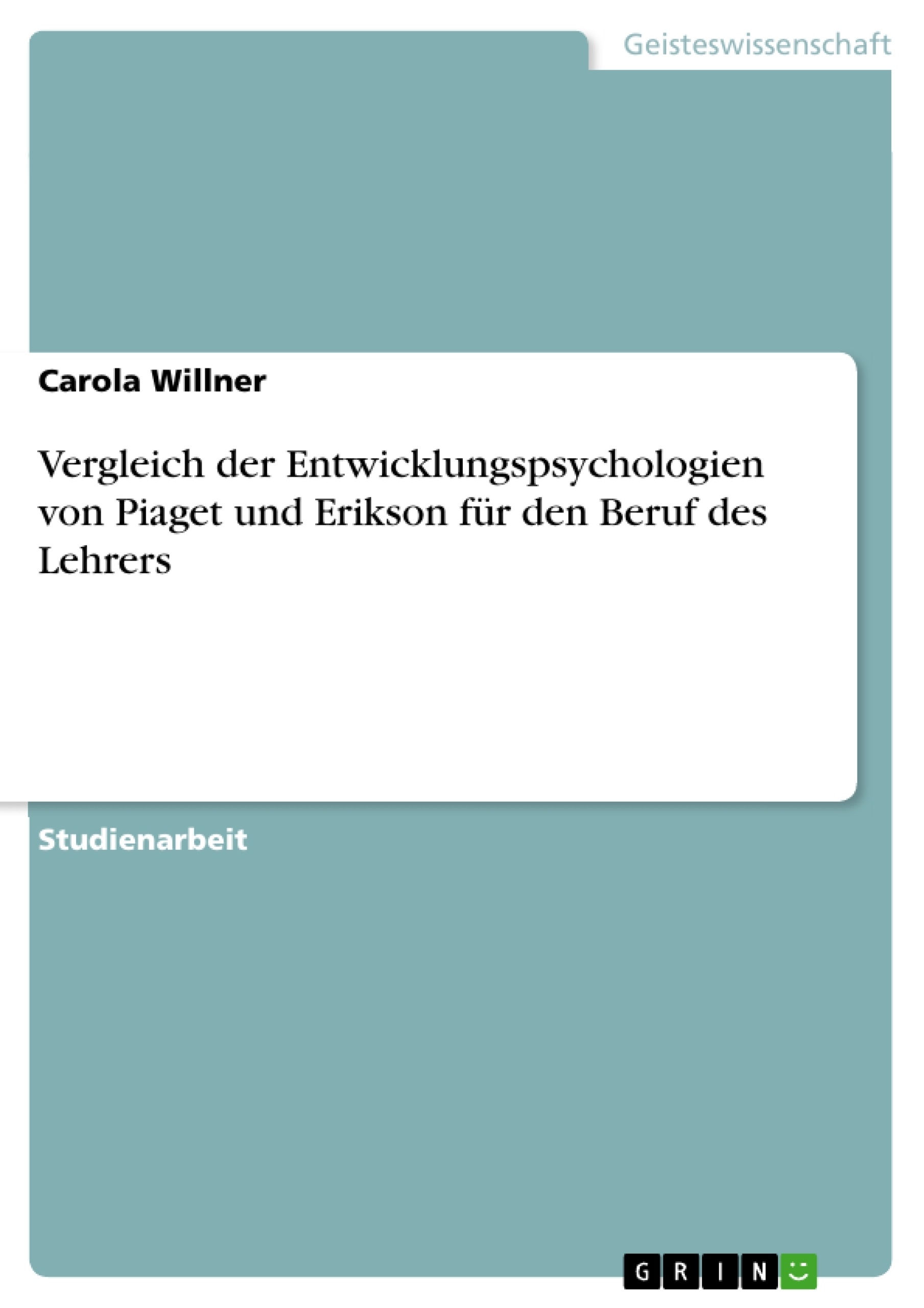1 Einleitung
Im Rahmen des Studiums zum B.A. Lehren und Lernen an der Leuphana Universität Lüneburg im Wintersemester 2009/2010 wurde im Modul „Psychologie der Entwicklung und Interaktion“ das Seminar „Kognitive Theorien der Entwicklungspsychologie“ angeboten. Innerhalb dieses Seminars wurden unterschiedliche Entwicklungstheorien vorgestellt. Diese Hausarbeit beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Frage, in wieweit Wissen über die kognitive Theorie Piagets und die tiefenpsychologische Theorie Eriksons im Alltag des Lehrerberufes von Bedeutung sein kann.
Es ist bekannt, dass in jeder Klasse SchülerInnen unterschiedlich weit entwickelt sind und dass ihre Wissensstände oftmals weit auseinander liegen. Besteht zwischen diesen Differenzen und den unterschiedlichen Entwicklungsstufen ein Zusammenhang? Wie unterschiedlich sich die SchülerInnen trotz gleicher Altersgruppe entwickeln und ob verschiedene Verhaltensmuster mit Hilfe der Theorien geklärt, beziehungsweise besser verstanden werden können, wird in dieser Ausarbeitung geklärt.
Dieses wird erreicht, indem vorab die Ziele der Entwicklungspsychologie und Ursachen der menschlichen Entwicklung kurz beschreiben werden. Abschließend wird ein Vergleich der beiden Entwicklungspsychologen und ihren Theorien gezogen. Zudem wird innerhalb der Kapitel stets ein Bezug zum schulischen Umfeld hergestellt.
Das Thema Entwicklung wird in der Psychologie sehr unterschiedlich bestimmt, wodurch es viele Definitionen für sie gibt. Jedoch konnten Übereinstimmungen gefunden werden, sodass man den Begriff Entwicklung als diverse Veränderungen eines Organismus definieren kann. Diese Veränderungen stehen in Abhängigkeit zueinander und bilden einen Zusammenhang. Kennzeichnend für die Entwicklung ist, dass die gesamten Veränderungen auf ein Ziel hingerichtet sind, in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen, die nicht umkehrbar ist und dass die verschiedenen Veränderungsprozesse zu bestimmten Altersstufen zugeordnet werden können (vgl. Altenthan, 1996, S. 189).
Folglich beschäftigt sich die Entwicklungspsychologie mit dem Erleben und Verhalten eines Menschen im Laufe der Zeit. Der Begriff Entwicklung besteht aus den Begriffen ‚Erleben‘ sowie ‚Verhalten‘ und wird auf diese eingeschränkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele der Entwicklungspsychologie
- Ursachen der Entwicklung
- Entwicklung und ihre Theorien
- Die psychosozialen Entwicklungsstufen nach Erikson
- Piagets kognitive Entwicklungspsychologie des Kindes
- Assimilation
- Akkommodation
- Stufen der kognitiven Entwicklung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bedeutung der kognitiven Theorie Piagets und der tiefenpsychologischen Theorie Eriksons für den Lehrerberuf im Alltag. Sie untersucht, ob und wie sich das unterschiedliche Entwicklungsniveau von Schülerinnen und Schülern mit Hilfe dieser Theorien erklären lässt, insbesondere im Hinblick auf verschiedene Verhaltensmuster und Lernprozesse.
- Bedeutung der Entwicklungspsychologie für den Lehrerberuf
- Analyse der kognitiven Entwicklungstheorie Piagets
- Untersuchung der psychosozialen Entwicklungsstufen nach Erikson
- Zusammenhang zwischen Entwicklungstheorien und Lernprozessen
- Praktische Anwendung der Theorien im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Fragestellung vor und erläutert die Relevanz der Untersuchung im Kontext der Lehramtsausbildung. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit, die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern im Lehrerberuf zu berücksichtigen.
- Ziele der Entwicklungspsychologie: Dieser Abschnitt beschreibt die zentralen Ziele der Entwicklungspsychologie, wie die Erforschung universeller Veränderungen, die Erklärung individueller Unterschiede und die Analyse des Einflusses des Kontextes auf die Entwicklung.
- Ursachen der Entwicklung: Das Kapitel beleuchtet die drei Hauptgruppen von Entwicklungsfaktoren: endogene, exogene und autogene Faktoren. Es werden Beispiele gegeben, wie diese Faktoren die Entwicklung beeinflussen.
- Entwicklung und ihre Theorien: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den kognitiven Entwicklungsstufen nach Piaget und den psychosozialen Entwicklungsstufen nach Erikson.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Entwicklungspsychologie, kognitive Entwicklung, psychosoziale Entwicklung, Piagets Theorie, Eriksons Theorie, Lehrerberuf, Lernprozess, Schülerentwicklung, Verhaltensmuster und schulischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Entwicklungspsychologie für Lehrer wichtig?
Sie hilft Lehrkräften zu verstehen, warum Schüler unterschiedliche Wissensstände und Verhaltensmuster zeigen und wie Lernprozesse an den jeweiligen Entwicklungsstand angepasst werden können.
Was versteht Piaget unter Assimilation und Akkommodation?
Assimilation bedeutet die Einordnung neuer Erfahrungen in vorhandene Schemata. Akkommodation ist die Anpassung der Schemata, wenn neue Informationen nicht in die alten Muster passen.
Welchen Fokus hat die Theorie von Erikson?
Erikson konzentriert sich auf psychosoziale Krisen in verschiedenen Lebensphasen, die bewältigt werden müssen, um eine gesunde Identität zu entwickeln.
Was sind endogene und exogene Entwicklungsfaktoren?
Endogene Faktoren sind die genetischen Anlagen, während exogene Faktoren die Umwelteinflüsse bezeichnen, die die Entwicklung eines Kindes prägen.
Können Entwicklungsstufen übersprungen werden?
Laut Piaget verlaufen die Stufen der kognitiven Entwicklung in einer festen, unumkehrbaren Reihenfolge, die eng mit bestimmten Altersstufen verknüpft ist.
- Quote paper
- Carola Willner (Author), 2010, Vergleich der Entwicklungspsychologien von Piaget und Erikson für den Beruf des Lehrers, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165479