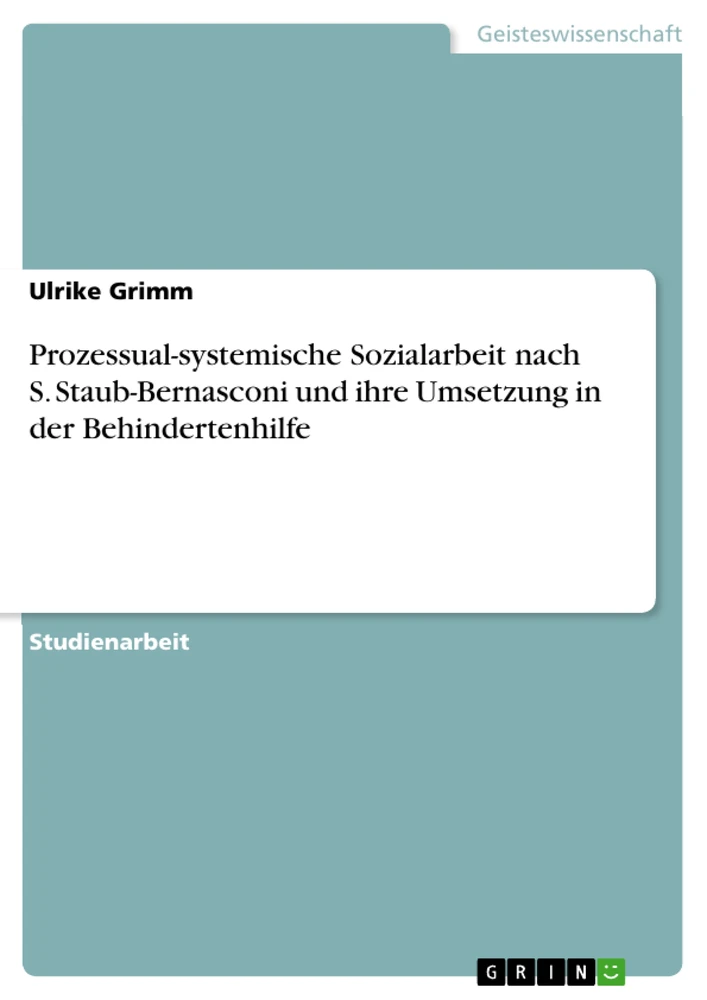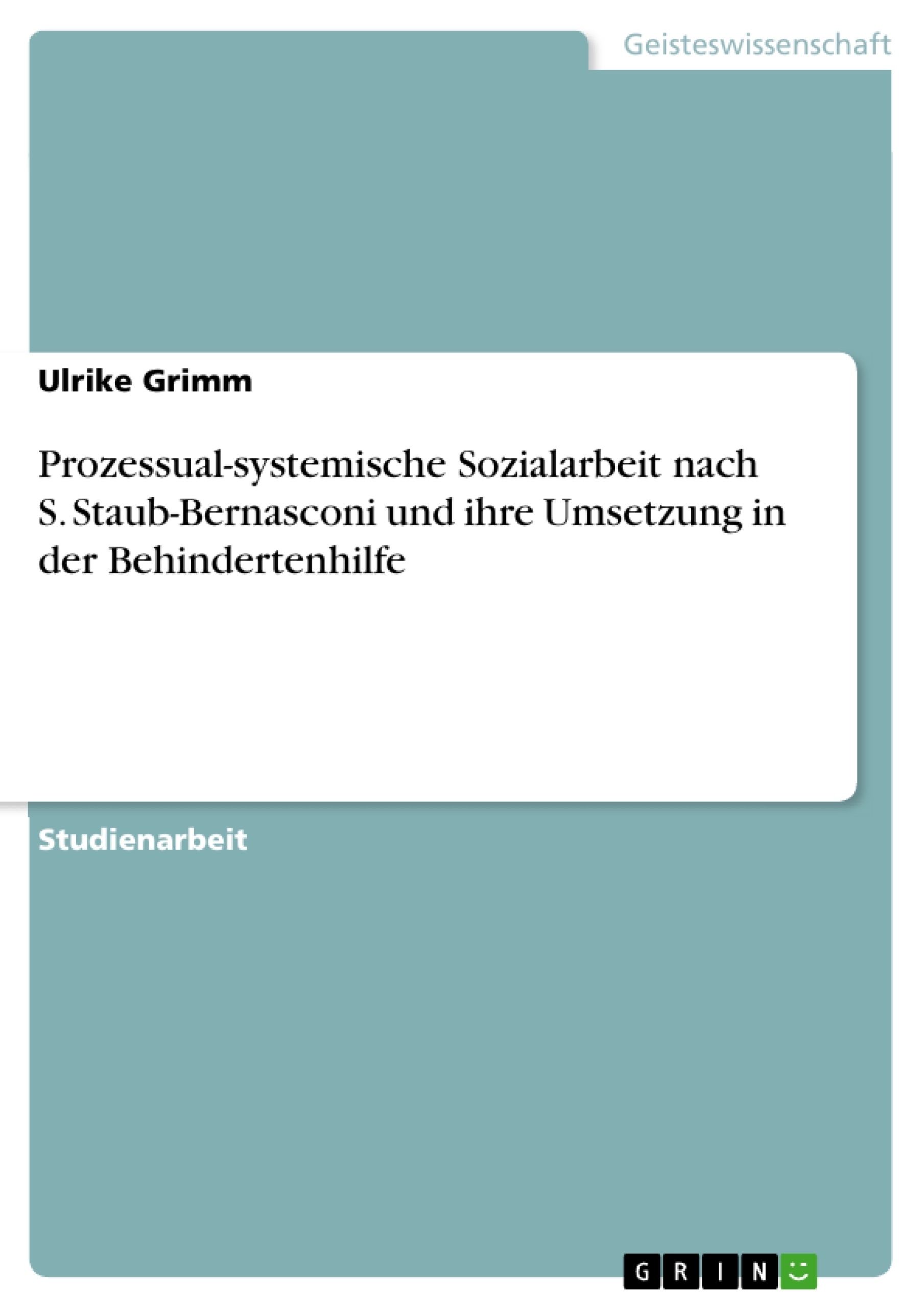Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung der von Silvia Staub-Bernasconi entwickelten Theorie der prozessual-systemischen Sozialarbeit in der Behindertenhilfe. Schwerpunkt ist das Arbeitsfeld der geistigen Behinderung. Staub-Bernasconi beschäftigt sich in ihren Hauptwerken nicht explizit mit dem Thema der geistigen Behinderung. Aktuelle Entwicklungen wie die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 und der Auseinandersetzung mit Machtproblemen in der Behindertenhilfe (Empowerment und Selbstbestimmung) weisen jedoch Verbindungen zur Arbeit von Silvia Staub-Bernasconi auf. Diese werden in dieser Hausarbeit genauer betrachtet.
Dazu werden zuerst die Merkmale und Methoden der prozessual-systemischen Sozialarbeit herausgearbeitet, um anschließend ihre Umsetzung in der Behindertenhilfe zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Merkmale prozessual-systemischer Sozialarbeit nach S. Staub-Bernasconi
- 2.1.1 Grundannahmen
- 2.1.2 Funktion Sozialer Arbeit
- 2.1.3 Behinderung als Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterienproblem
- 2.3 Umsetzung in der Behindertenhilfe
- 2.3.1 Umsetzung von Grundannahmen am Beispiel der Ganzheitlichkeit
- 2.3.2 Umsetzung von Methoden am Beispiel vom Umgang mit Machtquellen und Machtstrukturen bzw. des Empowerments
- 2.1 Merkmale prozessual-systemischer Sozialarbeit nach S. Staub-Bernasconi
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung der prozessual-systemischen Sozialarbeit nach Silvia Staub-Bernasconi im Kontext der Behindertenhilfe, insbesondere im Bereich der geistigen Behinderung. Sie beleuchtet, wie die theoretischen Konzepte Staub-Bernasconis in der Praxis angewendet werden können und welche Herausforderungen sich dabei stellen.
- Die Grundannahmen der prozessual-systemischen Sozialarbeit nach Staub-Bernasconi.
- Die Funktion Sozialer Arbeit im Umgang mit Behinderung.
- Die Betrachtung von Behinderung als Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterienproblem.
- Die Umsetzung der prozessual-systemischen Ansätze in der Praxis der Behindertenhilfe.
- Die Bedeutung von Empowerment und Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Silvia Staub-Bernasconi und ihren Werdegang als Sozialarbeiterin und Wissenschaftlerin vor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Umsetzung ihrer prozessual-systemischen Sozialarbeit in der Behindertenhilfe, insbesondere im Kontext der geistigen Behinderung, und betont den Bezug zu aktuellen Entwicklungen wie der UN-Behindertenrechtskonvention und dem Thema Empowerment. Der methodische Ansatz der Arbeit, der die Merkmale und Methoden der prozessual-systemischen Sozialarbeit herausarbeitet, um anschließend deren Umsetzung zu untersuchen, wird skizziert.
2. Hauptteil: Der Hauptteil ist in zwei Abschnitte gegliedert. Zuerst werden die Merkmale der prozessual-systemischen Sozialarbeit nach Staub-Bernasconi detailliert beschrieben, inklusive der Grundannahmen (naturalistische Ontologie, biopsychosoziales Menschenbild, Systemtheorie als prozessual-systemisch), der Funktion Sozialer Arbeit (Reaktion auf soziale Probleme, Befähigung von Menschen), und der Betrachtung von Behinderung als ein komplexes Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterienproblem. Anschließend wird die Umsetzung dieser theoretischen Konzepte in der Behindertenhilfe untersucht, wobei die Ganzheitlichkeit als Grundannahme und der Umgang mit Machtstrukturen und Empowerment als Methoden im Mittelpunkt stehen. Die Kapitel erläutern detailliert, wie diese Konzepte in der Praxis der Behindertenhilfe angewendet und mit welchen Herausforderungen man dabei konfrontiert ist. Es werden konkrete Beispiele gegeben, die die Anwendung der Theorie verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Prozessual-systemische Sozialarbeit, Silvia Staub-Bernasconi, Behindertenhilfe, geistige Behinderung, Empowerment, Selbstbestimmung, Machtstrukturen, Ganzheitlichkeit, UN-Behindertenrechtskonvention, soziale Probleme, Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterienproblem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Umsetzung prozessual-systemischer Sozialarbeit in der Behindertenhilfe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung der prozessual-systemischen Sozialarbeit nach Silvia Staub-Bernasconi in der Behindertenhilfe, insbesondere bei Menschen mit geistiger Behinderung. Sie analysiert die Anwendung theoretischer Konzepte in der Praxis und die damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundannahmen der prozessual-systemischen Sozialarbeit nach Staub-Bernasconi, die Funktion Sozialer Arbeit im Umgang mit Behinderung, die Betrachtung von Behinderung als komplexes Problem (Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterienproblem), die praktische Umsetzung prozessual-systemischer Ansätze in der Behindertenhilfe und die Bedeutung von Empowerment und Selbstbestimmung.
Welche Autorin steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die theoretischen Ansätze von Silvia Staub-Bernasconi und deren Anwendung in der Praxis der Behindertenhilfe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit. Der Hauptteil beschreibt detailliert die Merkmale der prozessual-systemischen Sozialarbeit nach Staub-Bernasconi und analysiert deren Umsetzung in der Praxis der Behindertenhilfe anhand konkreter Beispiele. Die Einleitung stellt Staub-Bernasconi und den methodischen Ansatz der Arbeit vor. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselkonzepte werden erklärt?
Die Arbeit erklärt und erläutert Schlüsselkonzepte wie prozessual-systemische Sozialarbeit, Ganzheitlichkeit, Empowerment, Selbstbestimmung, den Umgang mit Machtstrukturen und die Betrachtung von Behinderung als ein komplexes Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterienproblem.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der die Merkmale und Methoden der prozessual-systemischen Sozialarbeit herausarbeitet, um anschließend deren Umsetzung in der Praxis zu untersuchen.
Welche Bedeutung hat die UN-Behindertenrechtskonvention?
Die Arbeit bezieht sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Relevanz für die Umsetzung von Empowerment und Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit enthält konkrete Beispiele aus der Praxis der Behindertenhilfe, um die Anwendung der theoretischen Konzepte von Staub-Bernasconi zu verdeutlichen. Die genauen Beispiele werden im Hauptteil detailliert dargestellt.
Wer sollte diese Arbeit lesen?
Diese Arbeit richtet sich an Studierende und Fachkräfte der Sozialen Arbeit, insbesondere im Bereich der Behindertenhilfe, die sich mit prozessual-systemischen Ansätzen auseinandersetzen möchten.
Wo finde ich den detaillierten Inhaltsverzeichnis?
Der detaillierte Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und umfasst Kapitel zu Einleitung, Hauptteil (mit Unterkapiteln zu den Merkmalen der prozessual-systemischen Sozialarbeit und deren Umsetzung in der Behindertenhilfe) und Fazit.
- Quote paper
- Ulrike Grimm (Author), 2010, Prozessual-systemische Sozialarbeit nach S. Staub-Bernasconi und ihre Umsetzung in der Behindertenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165311