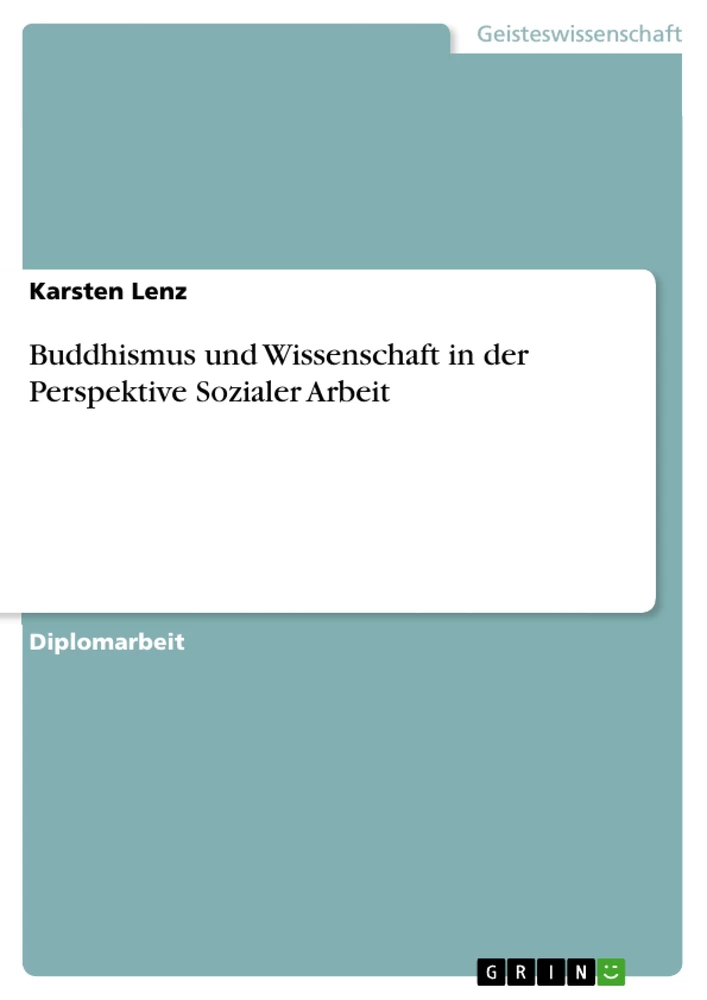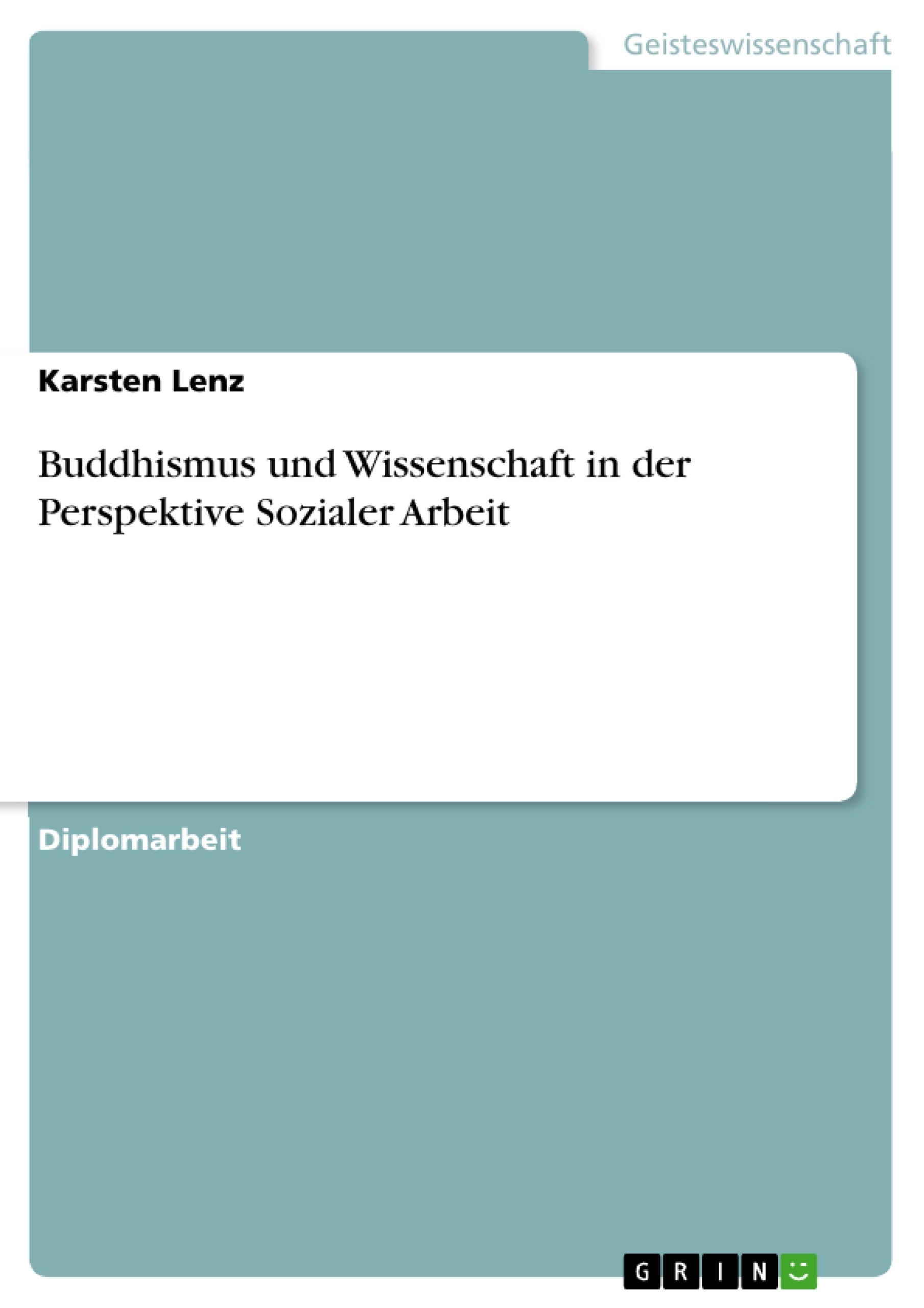Durch diese Arbeit wird eine empirische/wissenschaftliche Betrachtung der buddhistischen Lehre durch die Analogisierung mit modernen Psychotherapien möglich.
Im ersten Teil wird die grundsätzliche buddhistische Lehre dargestellt.
Im zweiten Teil werden die Grundelemente des Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation und die Lehre vom Nicht-Selbst, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Theorien aus dem psychologischen und pädagogischen Bereich gegenübergestellt und kontextualisiert. Die vorhandenen Analogien lassen so eine empirische Überprüfung der buddhistischen Lehre zu.
Die betrachteten Therapienformen sind Mindfulnessbased Stressreduction bzw. Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR), die Dialektisch-Behavoriale Therapie der Borderlinestörung nach Linehan (DBT) und die Klientenzentrierte Gesprächstherapie nach Rogers und Gendlin.
Ausserdem werden pädagogische Konzepte die buddhistische Elemente beinhalten betrachtet. Diese sind Achtsamkeitsbasierte Übungen für Kinder und der Offene Dialog nach David Bohm.
Im dritten Teil werden die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich ihres Potenzials für die Soziale Arbeit untersucht. Als Bezugspunkte dient hier unter anderem das Konzept des Empowerments nach Herriger.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- Methodische Anmerkungen
- B. Der Buddhismus
- 1. Siddharta Gautama Sakyamuni – Der erste Buddha
- 2. Die Überlieferungssituation
- 3. Samsara, Nirvana und Karma
- 4. Die drei Daseinsmerkmale
- 5. Anatta - Die Lehre vom Nicht-Selbst
- 5.1. Die Enstehung der Anattalehre
- 5.2. Die Khandha sind Nicht-Selbst
- 5.3. Begründungen für Anatta
- 5.4. Nicht-Identifikation und Besitzlosigkeit als wegweisende Aussage von anatta
- 5.5. Die positiven Folgen von anatta
- 5.6. Anatta als dialektischer Begriff für Wahrnehmung
- 5.7. Die konventionelle Persönlichkeit und ihr Verhältnis zum Nicht-Selbst
- 5.8. Zusammenfassung
- 6. Das Entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit
- 7. Die Vier Edlen Wahrheiten
- 7.1. Die Erste Edle Wahrheit: Die Wahrheit vom Leid
- 7.2. Die zweite edle Wahrheit: Die Wahrheit von der Leidensentstehung
- 7.3. Die dritte edle Wahrheit: Die Wahrheit von der Leidenserlöschung
- 7.4. Die vierte edle Wahrheit: Der achtfachen Pfad
- 8. Die Rechte Achtsamkeit
- 8.1. Das Reine Beobachten
- 8.1.1. Reines Beobachten und Wissensklarheit
- 8.1.2. Die Wissensklarheit
- 8.1.3. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit
- 8.2. Die Achtsamkeit auf den Körper
- 8.2.1. Die Betrachtung der Gefühle
- 8.2.2. Betrachtung des Geistes und der Geistobjekte
- 8.2.3. Die positiven Auswirkungen der Achtsamkeit
- 8.3. Die Wirkungskraft der Achtsamkeit bei Nyanaponika
- 8.4. Die Wunder der Achtsamkeit bei Thich Nath Hanh
- 8.5. Abgrenzung von konzentrativer Meditation und Achtsamkeit
- 8.6. Die Vier Göttlichen Verweilungszustände als seelische Grundlage der Achtsamkeit
- Zusammenfassung
- C. Buddhismus und Wissenschaft
- 1. Das Konzept der Achtsamkeit in der Psychotherapie
- 1.1. Mindfulnessbased-Stress-Reduction: Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion
- 1.1.1. Zielgruppe der MBSR
- 1.1.2. Achtsamkeit in der MBSR
- 1.1.3. Die Methodik des MBSR
- 1.1.4. Studien zu MBSR
- 1.1.4.1. Chronischer Schmerz
- 1.1.4.2. Depressionen und Angststörung
- 1.1.4.3. Gesundheit und Lebensqualität
- 1.1.4.4. Mitgefühl und Kommunikation
- 1.1.4.5. Metaanalyse von Studien zu MBSR
- 1.1.5. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 1.2. Dialektisch-Behavoriale Therapie der Borderlinestörung
- 1.2.1. Grundaufbau der DBT
- 1.2.2. Das Krankheitsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- 1.2.3. Achtsamkeit als Teil der DBT
- 1.2.3.1. Das Achtsamkeitsmodul als Teil des Fertigkeitentrainigs
- 1.2.3.1.1. Darstellung der „Wie-Fertigkeiten“
- 1.2.3.1.2. Darstellung der „Was-Fertigkeiten“
- 1.2.3.1.3. Achtsamkeit in den anderen Fertigkeitsmodulen
- 1.2.3.2. Kontextualisierung von DBT und buddhistischer Achtsamkeit
- 1.2.3.3. Borderline im Kontext der Achtsamkeit
- 1.2.4. Zusammenfassung
- 1.2.5. Studien zur Dialektisch-Behavorialen Therapie
- 1.2.6. Anwendung der DBT ausserhalb der BPS
- 1.2.7. Zusammenfassung
- 1.2.8. Die Klientenzentrierte Psychotherapie
- 1.2.9. Weiterentwicklungen der Klientenzentrierten Psychotherapie
- 1.3.1. Die Präsenz als Grundhaltung des Therapeuten
- 1.3.1.1. Feld-Sense als gegenwärtig gespürtes körperliches Erleben
- 1.3.1.2. Zusammenfassende Kontextualisierung von klientzentriert-basierten Psychotherapien und Achtsamkeit
- 1.3.2. Zusammenfassung
- 1.3.3. Die Achtsamkeit des Therapeuten
- 2. Studien zur Achtsamkeitsvermittlung bei Kindern
- 2.1. Studien zur Achtsamkeitsvermittlung bei Kindern
- 2.1.1. Die Studiendesigns
- 2.1.1.1. Yoga, Qigong und stille Meditation
- 2.1.1.2. Achtsamkeit in der Pädagogik
- 2.1.1.3. Entspannungstraining mit Yogaelementen für ängstliche Schulkinder
- 2.1.1.4. Yoga mit hyperaktiven Kindern
- 2.1.1.5. Yoga und Aufmerksamkeit bei Vor- und Grundschulkindern
- 2.1.1.6. Qigong für Schulkinder
- 2.1.2. Schildkrötenentspannungstraining
- 2.1.3. Vorläufige Stellungnahme
- 2.1.3.1. Ergebnisse der Studien
- 2.1.3.2. Körperliche Gesundheit
- 2.1.3.3. Emotionale Gesundheit
- 2.1.3.4. Kognitive Fähigkeiten
- 2.1.3.5. Sozialverhalten
- 2.1.4. Eigeninteresse
- 2.2. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 2.3. Der Offene Dialog nach David Bohm
- D. Buddhismus aus der Perspektive der Sozialarbeit
- 1. Achtsamkeit vor dem Hintergrund des Empowermentkonzepts
- 1.1. Die Achtsamkeit in der Ausübung durch den Klienten
- 1.2. Achtsamkeit in der Ausübung durch den Berater
- 1.3. Zusammenfassung
- 2. Achtsamkeit aus der Perspektive des Sozialarbeiters
- 3. Achtsamkeit als eine integrale und integrative Kompetenz des Sozialarbeiters
- 4. Praxisfelder für die Vermittlung von Achtsamkeit
- 5. Achtsamkeit als Bildungsinhalt an Hochschulen
- 5.1. Der Offene Dialog als Vermittlung von Achtsamkeit im universitären Kontext
- 5.1.1. Das Seminar
- 5.1.2. Auswertungen der Lernerfahrungen
- 5.2. Die direkte Vermittlung von Achtsamkeit
- E. Schluss
- Die Integration buddhistischer Konzepte, insbesondere der Achtsamkeit, in verschiedene Disziplinen wie Psychotherapie und Pädagogik.
- Die Analyse der wissenschaftlichen Fundierung und empirischen Evidenz für die Anwendung von Achtsamkeit in verschiedenen Kontexten.
- Die Darstellung der Rolle der Achtsamkeit im Rahmen von Empowerment und der professionellen Handlungskompetenz von Sozialarbeitern.
- Die Erörterung der Möglichkeiten zur Vermittlung von Achtsamkeit in der Praxis der Sozialarbeit, sowohl in der direkten Arbeit mit Klienten als auch in der Ausbildung von Sozialarbeitern.
- Die kritische Auseinandersetzung mit den potenziellen Herausforderungen und Grenzen der Integration buddhistischer Konzepte in die Sozialarbeit.
- A. Einleitung: Dieses Kapitel erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die Relevanz der buddhistischen Lehre für die Sozialarbeit konzentriert. Es wird betont, dass Religionen ursprünglich Heilslehren waren und dass der Buddhismus wesentliche Aspekte sozialarbeiterischen Handelns und Daseins anspricht. Der Fokus liegt auf der „Rechten Achtsamkeit“ als zentrale Methode zur Überwindung von Leid.
- B. Der Buddhismus: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die zentralen Lehren des Buddhismus, darunter die Geschichte des Buddha, die Konzepte von Samsara, Nirvana und Karma, sowie die Lehre vom Nicht-Selbst (Anatta). Besonderes Augenmerk wird auf die „Rechte Achtsamkeit“ gelegt, die als Schlüsselmethode zur spirituellen Entwicklung im Buddhismus gilt.
- C. Buddhismus und Wissenschaft: In diesem Kapitel wird untersucht, wie die buddhistische Lehre von Achtsamkeit in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere in der Psychotherapie, Anwendung findet. Es werden verschiedene Therapieformen vorgestellt, die auf dem Konzept der Achtsamkeit basieren, wie beispielsweise Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) und Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), und es werden die Ergebnisse einschlägiger Forschungsstudien diskutiert. Weiterhin wird die Bedeutung der Achtsamkeit in der Pädagogik und die Implikationen für die Rolle des Therapeuten behandelt.
- D. Buddhismus aus der Perspektive der Sozialarbeit: Dieses Kapitel analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen der Integration buddhistischer Konzepte, insbesondere der Achtsamkeit, in die Sozialarbeit. Es wird diskutiert, wie die Achtsamkeit im Kontext des Empowerment-Konzepts zur Förderung der Selbstwirksamkeit von Klienten beitragen kann, welche Rolle die Achtsamkeit für die professionelle Handlungskompetenz von Sozialarbeitern spielt und welche Praxisfelder für die Vermittlung von Achtsamkeit in der Sozialarbeit relevant sind. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Achtsamkeit als Bildungsinhalt an Hochschulen betrachtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Untersuchung des Potenzials der buddhistischen Lehre für die Sozialarbeit. Durch die Evaluierung und Relativierung buddhistischer Anschauungen im Kontext gegenwärtiger wissenschaftlicher Erkenntnisse und Theorien, soll ein tieferes Verständnis für die Relevanz des Buddhismus für die Praxis der Sozialarbeit erarbeitet werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Buddhismus und seiner Bedeutung für die Sozialarbeit. Schlüsselkonzepte sind die „Rechte Achtsamkeit“ als Methode zur Bewältigung von Leid und zur Förderung von Wohlbefinden, die Lehre vom Nicht-Selbst (Anatta), die Vier Edlen Wahrheiten, sowie der Zusammenhang zwischen buddhistischer Achtsamkeit und wissenschaftlichen Konzepten wie Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) und Empowerment.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Buddhismus und moderne Psychotherapie zusammen?
Viele moderne Therapien nutzen buddhistische Elemente wie Achtsamkeit und Meditation, um Stress zu reduzieren und psychische Störungen (z. B. Borderline) zu behandeln.
Was ist MBSR?
MBSR steht für „Mindfulness-Based Stress Reduction“ (Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion), ein wissenschaftlich fundiertes Programm zur Stressbewältigung durch Achtsamkeitstraining.
Was bedeutet „Anatta“ im Buddhismus?
Anatta ist die Lehre vom Nicht-Selbst. Sie besagt, dass es kein dauerhaftes, unveränderliches „Ich“ gibt, was in der Arbeit mit psychologischen Identitätstheorien verglichen wird.
Wie kann Achtsamkeit in der Sozialen Arbeit genutzt werden?
Achtsamkeit dient als Instrument des Empowerments für Klienten und als professionelle Kompetenz für Sozialarbeiter, um die Beziehungsgestaltung und Selbstreflexion zu verbessern.
Welche Rolle spielt der „Offene Dialog“?
Der Offene Dialog nach David Bohm wird als pädagogisches Konzept betrachtet, das buddhistische Achtsamkeit in die Kommunikation und Gruppeninteraktion integriert.
- Quote paper
- Karsten Lenz (Author), 2009, Buddhismus und Wissenschaft in der Perspektive Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165256