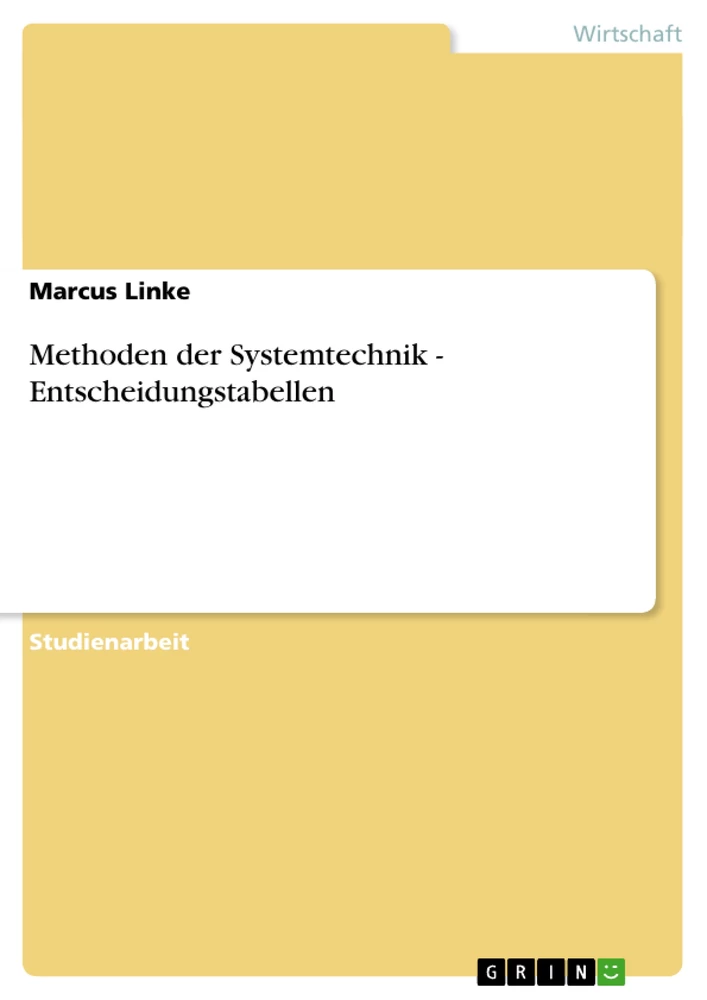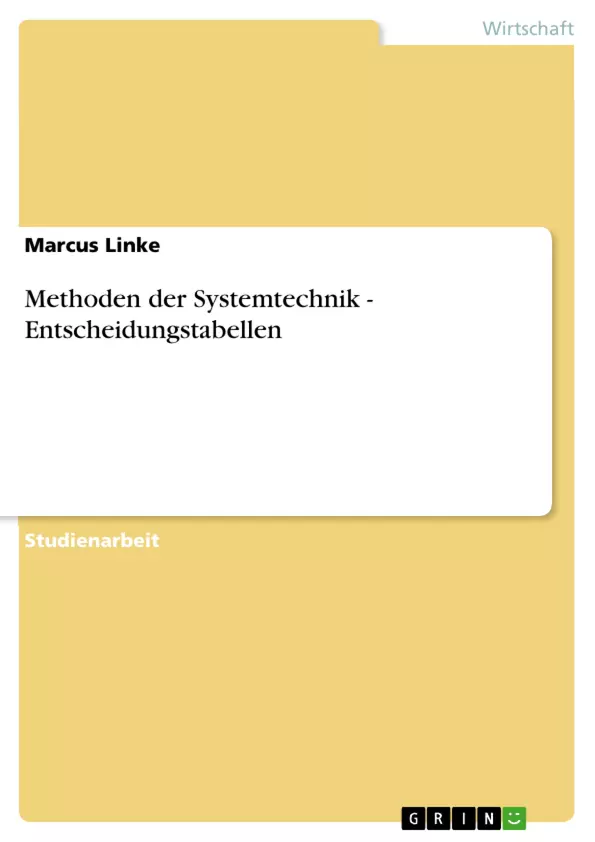Die Systemtechnik als interdisziplinäre Wissenschaft will Methoden, Verfahren und Hilfs-mittel zur Analyse, Planung, Auswahl und optimalen Gestaltung komplexer Systeme bereit-stellen. Ihr Vorgehen beginnt mit der Gewinnung von Informationen über das geplante System, das sich aus Marktanalyse, Trendstudien oder bereits konkreten Aufgabenstellungen ergeben kann. Ziel solcher Systemstudien ist eine klare Formulierung der zu lösenden Proble-me bzw. Teilaufgaben, die dann eigentlicher Ausgangspunkt für die Systementwicklung sind. Danach wird ein Zielprogramm aufgestellt, das die Zielsetzung für das zu schaffende System formal festlegt. Zur Auswahl eines für die Aufgabenstellung optimalen Systems werden nun die gefunden Lösungsvarianten mit dem eingangs aufgestellten Zielprogramm verglichen und die Lösungsvariante gewählt, welche den Anforderungen der Aufgabenstellung am besten erfüllt. Entscheiden heißt, zwischen zwei oder mehreren Alternativen mit unterschiedlichen Auswir-kungen auszuwählen. Für diesen „Auswahlprozess“ stehen einige in der Praxis vielfach erprobte Entscheidungstechniken zur Verfügung, wie zum Beispiel die ABC-Analyse, die Entscheidungstabelle, die Entscheidungsmatrix, der Entscheidungsbaum oder die Portfolio-Methode.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zielsetzung der Arbeit
- 3. Entscheidungstabellen
- 3.1. Benötigte Informationen und Vorraussetzungen zur Anwendung der Methode
- 3.2. Aufbau und Formen von Entscheidungstabellen
- 3.3. Verfahrensbeschreibung anhand eines Beispiels
- 3.4. Einsatzbereiche
- 3.5. Bewertung der Methode
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Entscheidungstabellen als Methode zur Entscheidungsfindung. Ziel ist es, den Aufbau, verschiedene Formen und Anwendungsbereiche dieser Methode aufzuzeigen und ihre Effektivität zu bewerten. Die Arbeit untersucht, wie Entscheidungssituationen mithilfe von Entscheidungstabellen getroffen und beurteilt werden können.
- Aufbau und Formen von Entscheidungstabellen
- Verfahrensbeschreibung und Anwendungsbeispiele
- Einsatzbereiche von Entscheidungstabellen in der Praxis
- Bewertung der Effektivität von Entscheidungstabellen
- Analyse von Entscheidungssituationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Systemtechnik als interdisziplinäre Wissenschaft ein und beschreibt deren Vorgehen bei der Analyse und Gestaltung komplexer Systeme. Sie betont die Bedeutung der Auswahl optimaler Systeme durch den Vergleich von Lösungsvarianten mit einem zuvor definierten Zielprogramm. Der Auswahlprozess wird als Entscheidungsprozess zwischen Alternativen mit unterschiedlichen Auswirkungen dargestellt, wobei verschiedene Entscheidungstechniken wie die ABC-Analyse, Entscheidungsmatrizen und Entscheidungsbäume erwähnt werden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Entscheidungstabellen als eine dieser Techniken.
2. Zielsetzung der Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt das zentrale Ziel der Arbeit: die Analyse von Entscheidungstabellen als Methode zur Entscheidungsfindung. Es werden die zu behandelnden Aspekte benannt: Aufzeigen des Aufbaus und der verschiedenen Formen von Entscheidungstabellen, deren Verfahrensbeschreibung, Darstellung der Einsatzbereiche in der Praxis und schlussendlich die Bewertung ihrer Effektivität. Die Zielsetzung ist prägnant und fokussiert auf die umfassende Untersuchung der Entscheidungstabellenmethode.
3. Entscheidungstabellen: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit Entscheidungstabellen. Es erläutert deren Entstehung und Normung und hebt ihre Bedeutung als Technik zur klaren und eindeutigen Darstellung komplexer Entscheidungssituationen hervor, insbesondere im Vergleich zu ungenauen verbalen Beschreibungen. Die verschiedenen Abschnitte innerhalb des Kapitels (3.1 - 3.5) werden detailliert behandelt, um ein vollständiges Verständnis für die Anwendung und Bewertung von Entscheidungstabellen zu liefern.
Schlüsselwörter
Entscheidungstabellen, Systemtechnik, Entscheidungsfindung, Methode, Aufbau, Formen, Einsatzbereiche, Bewertung, Effektivität, Routineentscheidungen, komplexe Systeme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Entscheidungstabellen: Eine Analysemethode"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Entscheidungstabellen als Methode zur Entscheidungsfindung. Sie untersucht Aufbau, verschiedene Formen und Anwendungsbereiche dieser Methode und bewertet deren Effektivität.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Aufbau und Formen von Entscheidungstabellen, Verfahrensbeschreibung mit Anwendungsbeispielen, Einsatzbereiche in der Praxis, Bewertung der Effektivität und Analyse von Entscheidungssituationen mithilfe von Entscheidungstabellen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Systemtechnik und die Bedeutung der Entscheidungsfindung bei der Auswahl optimaler Systeme. Kapitel 2 (Zielsetzung): Klare Definition des Ziels der Arbeit – die umfassende Analyse von Entscheidungstabellen. Kapitel 3 (Entscheidungstabellen): Detaillierte Erläuterung von Entscheidungstabellen, inklusive Aufbau, verschiedenen Formen, Anwendungsbeispielen, Einsatzbereichen und einer abschließenden Bewertung. Kapitel 4 (Literaturverzeichnis): Auflistung der verwendeten Literatur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das zentrale Ziel der Arbeit ist die umfassende Analyse von Entscheidungstabellen als Methode zur Entscheidungsfindung. Es soll aufgezeigt werden, wie Entscheidungssituationen mithilfe von Entscheidungstabellen strukturiert, bearbeitet und beurteilt werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entscheidungstabellen, Systemtechnik, Entscheidungsfindung, Methode, Aufbau, Formen, Einsatzbereiche, Bewertung, Effektivität, Routineentscheidungen, komplexe Systeme.
Wie ist der Aufbau der Entscheidungstabellen im Detail erklärt?
Kapitel 3 (Entscheidungstabellen) beschreibt detailliert den Aufbau und die verschiedenen Formen von Entscheidungstabellen. Es wird erläutert, wie diese zur klaren und eindeutigen Darstellung komplexer Entscheidungssituationen eingesetzt werden können, insbesondere im Vergleich zu ungenauen verbalen Beschreibungen. Die einzelnen Unterkapitel (3.1 - 3.5) behandeln die benötigten Informationen, den Aufbau, ein Anwendungsbeispiel, Einsatzbereiche und eine Bewertung der Methode.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Entscheidungsfindung in komplexen Systemen beschäftigen, insbesondere im Kontext der Systemtechnik. Sie bietet eine strukturierte und detaillierte Analyse einer spezifischen Entscheidungsfindungsmethode.
Wo finde ich ein Anwendungsbeispiel für Entscheidungstabellen?
Ein Anwendungsbeispiel für Entscheidungstabellen findet sich in Kapitel 3.3 (Verfahrensbeschreibung anhand eines Beispiels) innerhalb des Kapitels "Entscheidungstabellen".
- Quote paper
- Marcus Linke (Author), 2010, Methoden der Systemtechnik - Entscheidungstabellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/164393