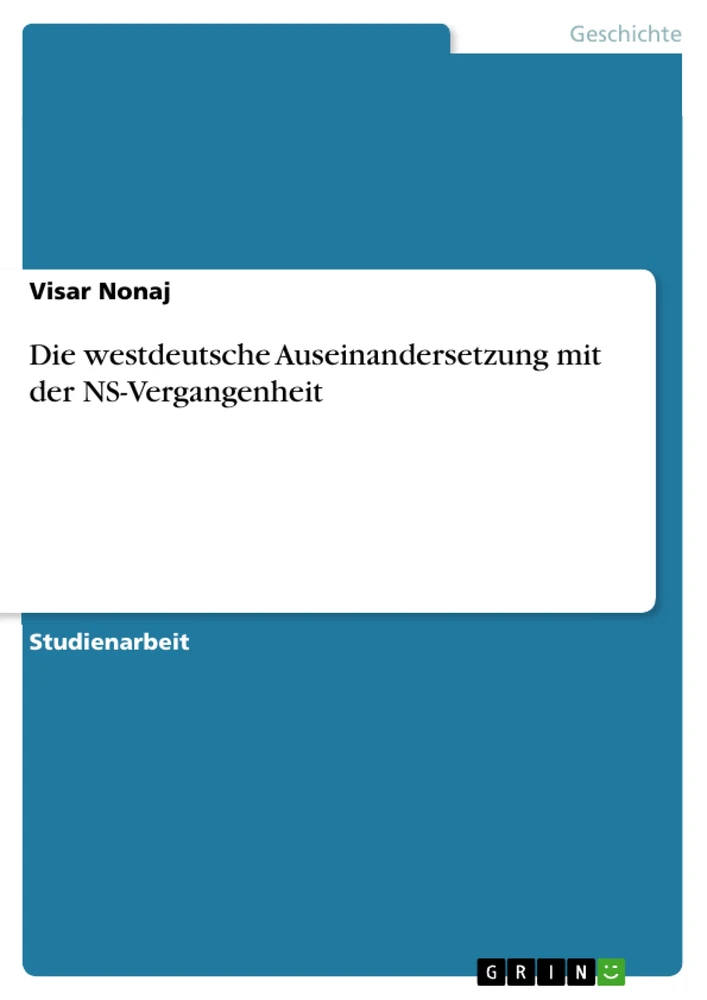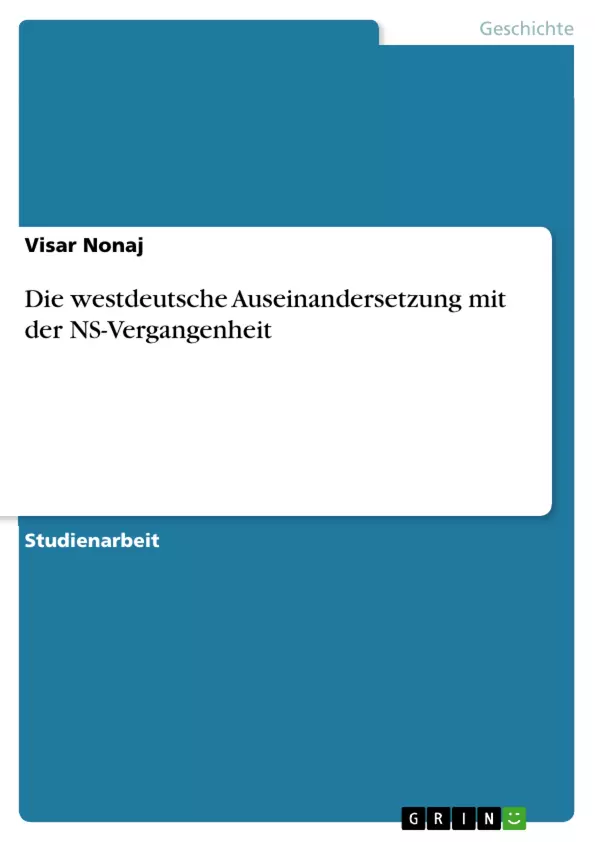Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit. Es stellt sich dabei die Frage, ob diese Auseinandersetzung wirklich eine gelungene war oder nicht.
In der langen Zeit seit der Kapitulation des „tausendjährigen Reiches“ sind mehrere Theorien und Thesen entstanden, die über die Art und Weise, wie das Hitlerregime im Nachkriegsdeutschland betrachtet wurde, Reflexionen angestellt haben. Es geht bei dieser Arbeit darum, die wesentlichsten Maßnahmen darzustellen, die in der Frühzeit der Bundesrepublik bezüglich der Vergangenheitspolitik getroffen wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. NS-Vergangenheit - nur historisch relevant?
- 2. Abschluß der Entnazifizierung
- 3. Gesetzgeberische Maßnahmen zur Vergangenheitspolitik
- 4. Das Kriegsverbrecherproblem
- 5. Die Kollektivschuldfrage
- 6. Rechtliche Normsetzung in der Vergangenheitspolitik
- 7. Unbewältigte Vergangenheit
- 8. Die These Lübbes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Auseinandersetzung der westdeutschen Gesellschaft mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit. Sie befasst sich mit der Frage, ob diese Auseinandersetzung erfolgreich war und welche Maßnahmen in der Frühzeit der Bundesrepublik zur Vergangenheitspolitik ergriffen wurden.
- Die Bedeutung der NS-Vergangenheit für die Geschichtsforschung
- Die Entnazifizierung und ihre Folgen für die deutsche Gesellschaft
- Die Gesetzgebung zur Vergangenheitspolitik in der Bundesrepublik
- Das Kriegsverbrecherproblem und die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen
- Die Debatte um die Kollektivschuld und die These von der „unbewältigten Vergangenheit“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit analysiert die Auseinandersetzung der westdeutschen Gesellschaft mit ihrer NS-Vergangenheit und untersucht, ob diese erfolgreich war. Sie beleuchtet die wichtigsten Maßnahmen der frühen Vergangenheitspolitik der Bundesrepublik.
- 1. NS-Vergangenheit - nur historisch relevant?: Das Kapitel betrachtet die Bedeutung der NS-Vergangenheit für die Geschichtsforschung und die Herausforderungen, die mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema verbunden waren.
- 2. Abschluß der Entnazifizierung: Dieses Kapitel analysiert die Bemühungen der Bundesrepublik, die Entnazifizierung zu beenden und die politischen Säuberungen der Besatzungsmächte rückgängig zu machen. Es beleuchtet die Folgen für die Betroffenen und die politische Legitimation der jungen Bundesrepublik.
- 3. Gesetzgeberische Maßnahmen zur Vergangenheitspolitik: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den wichtigsten Gesetzen zur Vergangenheitspolitik, insbesondere dem Straffreiheitsgesetz von 1949. Die Folgen dieser Gesetze für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der NS-Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik, darunter Entnazifizierung, Vergangenheitspolitik, Kriegsverbrecherproblem, Kollektivschuld, die These von der „unbewältigten Vergangenheit“ und Hermann Lübbes Gegentheorie. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind: Geschichtsforschung, juristische Normsetzung, politische Amnestie, soziale Wiederintegration, und die Rolle der öffentlichen Meinung.
- Quote paper
- Visar Nonaj (Author), 2000, Die westdeutsche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/163895