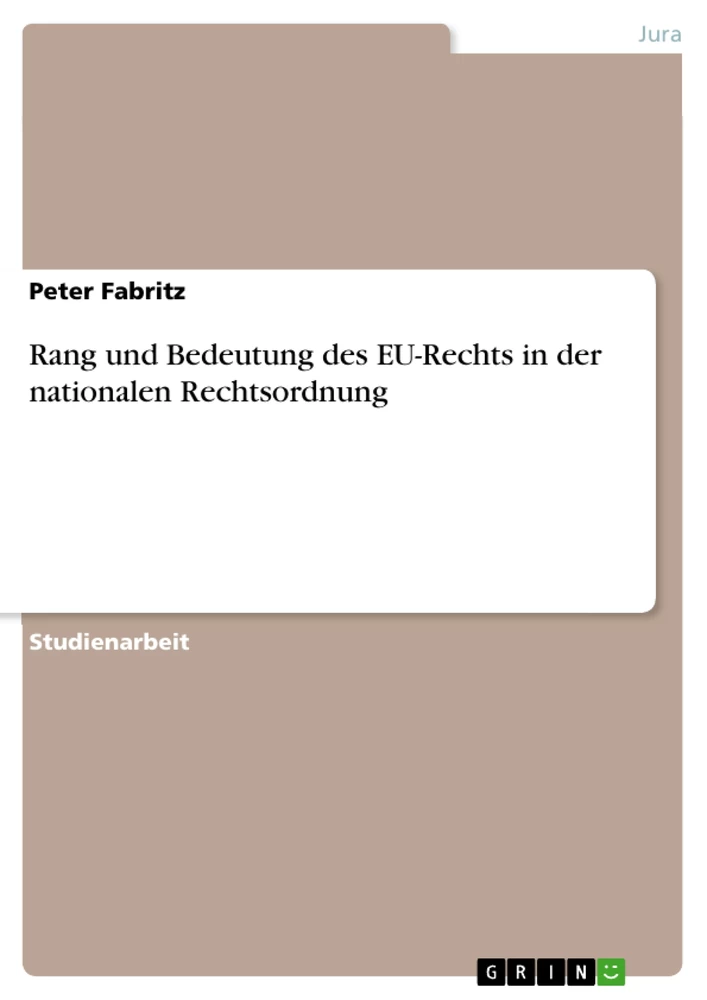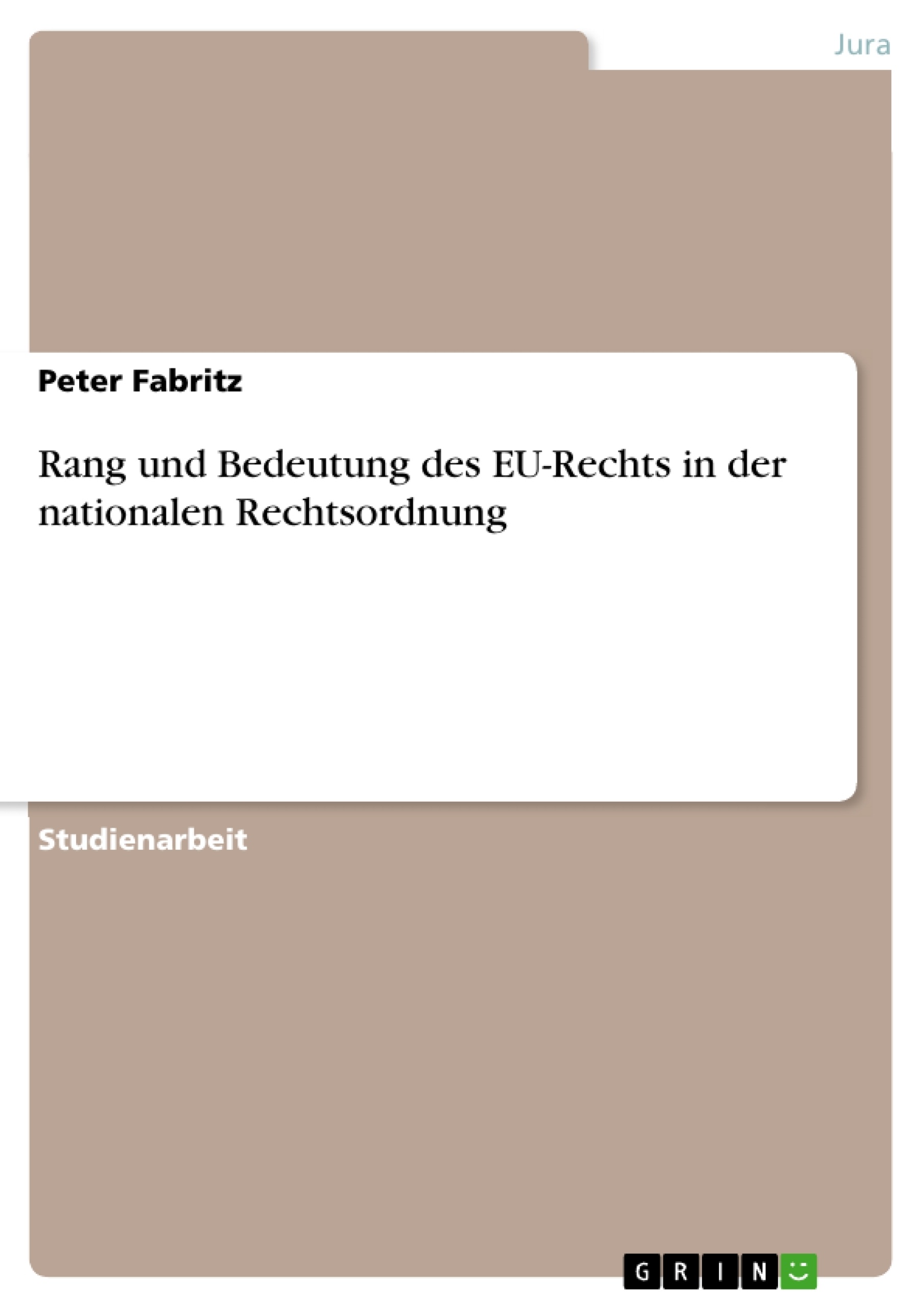Die Rechtsordnungen, deren Verhältnis und Rang zueinander es im Laufe dieser Arbeit zu untersuchen gilt, werden durch das Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union (EU) einerseits und durch das nationale Recht der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU andererseits gebildet. Der Fokus bezüglich des nationalen Rechts, wird hierbei auf die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere auf die Rechtsprechung des hiesigen Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) gelegt, das bei der unterschiedlichen Interpretation des Rangverhältnisses, mit dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) einen rechtlichen Diskurs bestritt. Die Leitentscheidungen der jeweiligen Gerichtshöfe, sowie die daraus resultierende Entwicklung des Rangverhältnisses der Rechtsordnungen bilden den Ausgangspunkt dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- A. Entwicklung des europäischen Gemeinschaftsrechts hin zu einer Verschränkung mit den nationalen Rechtsordnungen
- B. Die Abhängigkeit des EU-Rechts vom nationalen Recht
- C. Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts
- I. Die Ausstrahlung des EU-Rechts in die nationale Rechtsordnung unter dem Aspekt des Vorranges
- II. Die Ursprünge der Diskussion um den Vorrang in der Entscheidung des EuGH zu Costa/E.N.E.L
- D. Anwendungsvorrang des EU-Rechts gegenüber dem nationalen Verfassungsrecht
- I. Die Entscheidung Simmenthal II des EuGH unter dem Aspekt des Geltungs- und Anwendungsvorranges
- II. Die Entscheidung IN.CO.GE des EuGH unter dem Aspekt des Geltungs- und Anwendungsvorranges
- E. Die Rechtsprechung des BVerfG zu Fragen des Rangverhältnisses
- I. Akzeptanz und Vorbehalte in der Rechtsprechung des BVerfG
- II. Die Frage nach dem Grundrechtsschutz und deren vorläufige Lösung durch den Solange-I-Beschluss
- III. Der Solange-II-Beschluss des BVerfG in Anbetracht einer gefestigten Grundrechtsprechung auf europäischer Ebene
- F. Die wesentlichen Vorbehalte des BVerfG
- I. Das Maastricht-Urteil und die Entstehung eines Kooperationsverhältnisses mit dem EuGH
- II. Der Vorbehalt in Form von Integrationsschranken im Maastricht- und Lissabon-Urteil
- IIG. Zusammenfassende Begründung des Vorrangs des Unionsrechts gegenüber den Mitgliedsstaaten
- I. Die Sichtweise des EuGH zur Begründung des Vorranges
- II. Die Sichtweise des BVerfG zur Begründung des Vorranges
- III. Der aktuell drohende Justizkonflikt und die mit ihm zusammenhängenden Forderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis zwischen EU-Recht und nationalem Recht, insbesondere dem deutschen Recht. Sie untersucht die Entwicklung des europäischen Gemeinschaftsrechts, seinen Einfluss auf die nationalen Rechtsordnungen und die Frage des Vorrangs des EU-Rechts gegenüber nationalem Recht, insbesondere dem deutschen Verfassungsrecht.
- Entwicklung des europäischen Gemeinschaftsrechts und dessen Verschränkung mit den nationalen Rechtsordnungen
- Abhängigkeit des EU-Rechts vom nationalen Recht
- Vorrang des EU-Rechts gegenüber dem nationalen Recht
- Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Rangverhältnis zwischen EU-Recht und nationalem Recht
- Begründung des Vorrangs des EU-Rechts
Zusammenfassung der Kapitel
Diese Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des europäischen Gemeinschaftsrechts und seine Verzahnung mit den nationalen Rechtsordnungen. Sie analysiert die Abhängigkeit des EU-Rechts vom nationalen Recht, wobei insbesondere das deutsche Verwaltungsverfahrensrecht als Beispiel dient. Zudem wird der Vorrang des Gemeinschaftsrechts und dessen Ausstrahlung auf die nationale Rechtsordnung betrachtet, wobei die wegweisenden Entscheidungen des EuGH zu Costa/E.N.E.L., Simmenthal II und IN.CO.GE im Vordergrund stehen.
Die Arbeit untersucht die Rechtsprechung des BVerfG zum Rangverhältnis zwischen EU-Recht und nationalem Recht. Sie stellt die Akzeptanz des Vorrangs des EU-Rechts durch das BVerfG sowie die damit verbundenen Vorbehalte dar. In diesem Zusammenhang wird der Solange-I- und Solange-II-Beschluss sowie das Maastricht-Urteil des BVerfG analysiert. Die Arbeit analysiert die wesentlichen Vorbehalte des BVerfG und die daraus resultierende Entwicklung eines Kooperationsverhältnisses mit dem EuGH.
Schlussendlich betrachtet die Arbeit die Begründung des Vorrangs des EU-Rechts aus der Sicht des EuGH und des BVerfG. Sie analysiert den aktuell drohenden Justizkonflikt und die damit verbundenen Forderungen.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit konzentriert sich auf das Verhältnis zwischen EU-Recht und nationalem Recht, insbesondere dem deutschen Recht. Die zentralen Themen sind die Entwicklung des europäischen Gemeinschaftsrechts, die Abhängigkeit des EU-Rechts vom nationalen Recht, der Vorrang des EU-Rechts gegenüber dem nationalen Recht und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu diesem Thema. Die Arbeit analysiert die Entstehung des Vorrangs des EU-Rechts und die damit verbundenen Probleme und Herausforderungen.
- Quote paper
- Peter Fabritz (Author), 2009, Rang und Bedeutung des EU-Rechts in der nationalen Rechtsordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/163804