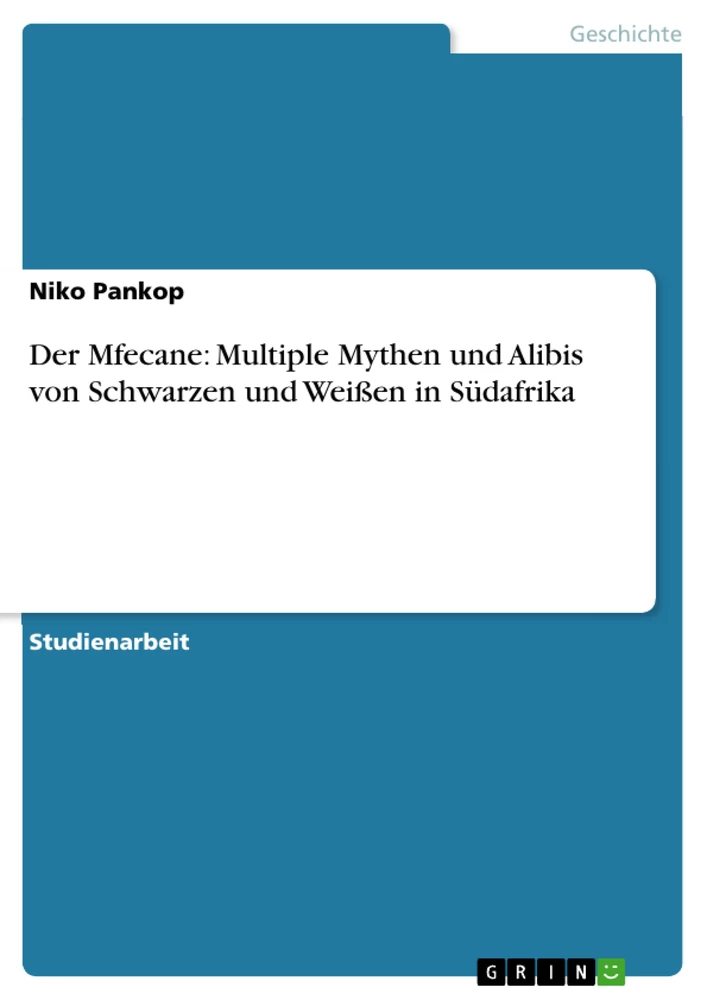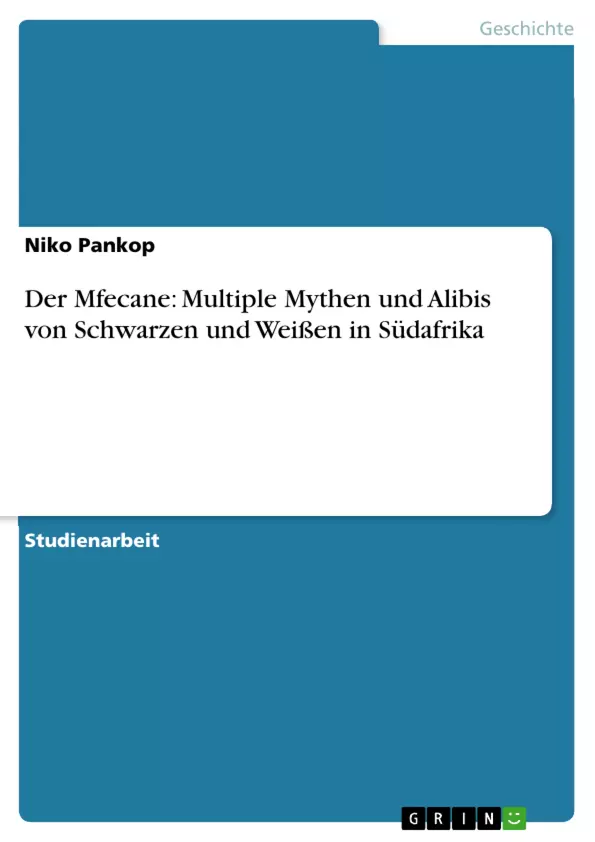Das Bild des Mfecane war in der Forschung bis zu Cobbings aufsehenregendem Artikel „The Mfecane as Alibi“ beinahe unumstritten. So ging man davon aus, dass es im südlichen Afrika eine Kettenreaktion von gesellschaftlichen Zentralisierungsprozessen, Gewalt und Fluchtbewegungen gegeben habe. Am Anfang und im Zentrum dieser Kettenreaktion stand dabei Shaka Zulu bzw. das Zulu Reich. Daher war diese Sichtweise auch eng verbunden mit einem Mythos über Shaka Zulu selber: Als brutalem Despoten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch als genialem Napoleon, der durch die Einführung einiger militärischer Innovationen wie der eines neuartigen Speeres und der Schaffung von Regimentern, den amabutho, mit dem ihm quasi ein stehendes Heer zur Verfügung stand, eine Zulu-Nation schuf. Shaka hat, folgt man diesem Mythos, das Leben von Millionen von Menschen auf dem Gewissen. Mit seinen Kriegszügen habe er ganze Völker in die Flucht getrieben, die als Reaktion darauf, seine Innovationen übernahmen, selber Reiche gründeten und wiederum weitere Fluchtbewegungen auslösten. Die Mythisierung der Figur Shakas wurde nicht zuletzt durch die sehr begrenzte Zahl an Quellen und ihre mangelnde Verlässlichkeit gefördert.
Der aus Shakas Reichsgründung resultierende Mfecane hatte nach der damaligen Lehrmeinung die Entvölkerung ganzer Regionen im Süden Afrikas zur Folge. Somit erschien also schließlich auch die Kolonisierung dieser Länder durch die Europäer als legitim und sie selber als friedensbringende Zivilisatoren.
Cobbing dagegen versuchte zu zeigen, dass dieses Bild des Mfecane eine Erfindung und ein Alibi ist. Jedoch wurde seine Darstellung als „Verschwörungstheorie“ in dieser Form abgelehnt. Dennoch ist die Idee des Mfecane als Alibi in vieler Hinsicht fruchtbar. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass man die Entstehung dieses Alibis und der damit zusammenhängenden Mythen, nicht all zu statisch und konstruiert sehen darf. Selbst Erfindungen basieren auf einem weiten Feld von schon vorhandenem Wissen einer Zeit. Jeder Mythos hat einen wahren Kern. Auch wenn also die Zulu nicht unbedingt das Zentrum der Ereignisse waren, so hat der Mythos vom Mfecane dennoch in gewisser Hinsicht seine Ursprünge in der Realität.
Die Arbeit gibt einen kurzen Abriss der Neuerungen durch Cobbing und untersucht, wie es zur Entstehung von verschiedenen Mythen und Alibis kam, welche Sicht die Perspektive der Afrikaner dabei spielte und wie diese Mythen die Geschichte überdauerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mfcane als Alibi
- Die Revision Cobbings
- Der Mfecane: Mythen und Alibis von Schwarzen und Europäern
- Umdeutung und Konservierung des Mythos im 20Jh.
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte des Mfecane, einem Zeitraum in der Geschichte Südafrikas, der von gewalttätigen Konflikten und Fluchtbewegungen geprägt war. Sie hinterfragt die traditionellen Interpretationen des Mfecane, die die Zulu als Hauptverursacher der Ereignisse darstellen, und beleuchtet die Rolle der europäischen Kolonialisierung und des Sklavenhandels.
- Die Kritik an der traditionalen Interpretation des Mfecane als Zulu-zentrierte Kettenreaktion.
- Die Rolle der europäischen Kolonialisierung und des Sklavenhandels in der Entstehung des Mfecane.
- Die Entstehung und Entwicklung verschiedener Mythen und Alibis über den Mfecane, sowohl von Afrikanern als auch von Europäern.
- Die Bedeutung der Perspektive der Afrikaner in der Geschichte des Mfecane.
- Die Kontinuität der Mythen über den Mfecane im 20. Jahrhundert.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die bisherige Forschungslage zum Mfecane dar und skizziert die Bedeutung des Werks von Julian Cobbing.
Das erste Kapitel beleuchtet die traditionellen Interpretationen des Mfecane und präsentiert die Kernaussagen von Cobbing, der den Mfecane als „Alibi“ für die europäische Kolonisierung deutet. Es zeigt die Auswirkungen des Sklavenhandels und der europäischen Einmischung auf die Gesellschaften der Schwarzen in Südafrika.
Schlüsselwörter
Mfecane, Shaka Zulu, Zulu-Reich, Kolonialisierung, Sklavenhandel, Mythen, Alibis, Afrikaner, Europäer, Geschichte Südafrikas, Revisionismus, Quellenkritik.
- Quote paper
- Niko Pankop (Author), 2009, Der Mfecane: Multiple Mythen und Alibis von Schwarzen und Weißen in Südafrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/163598