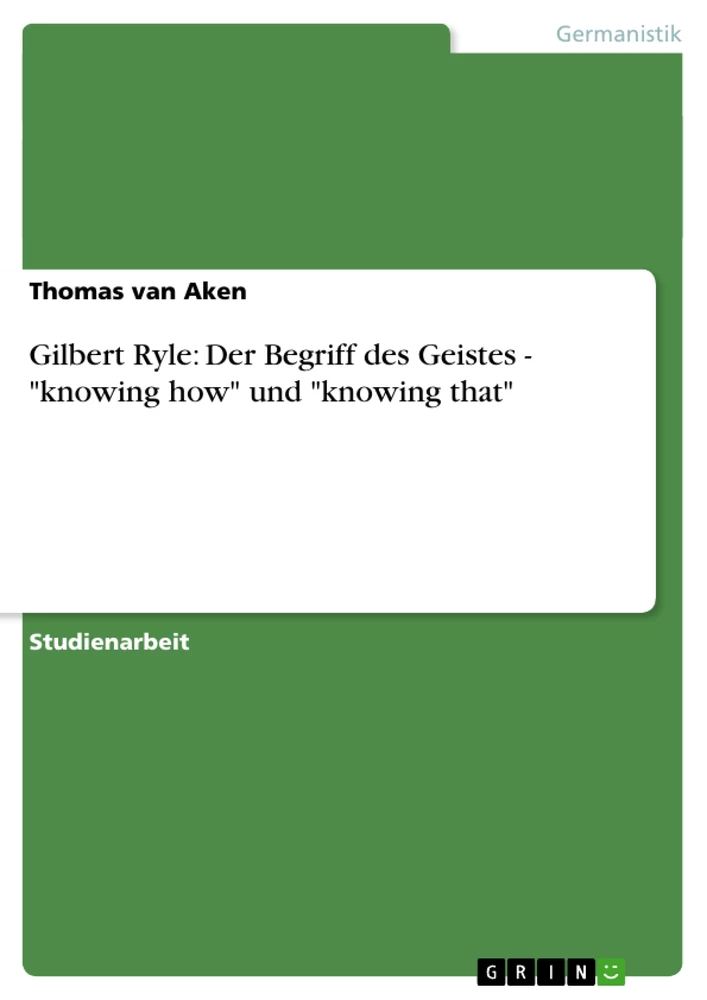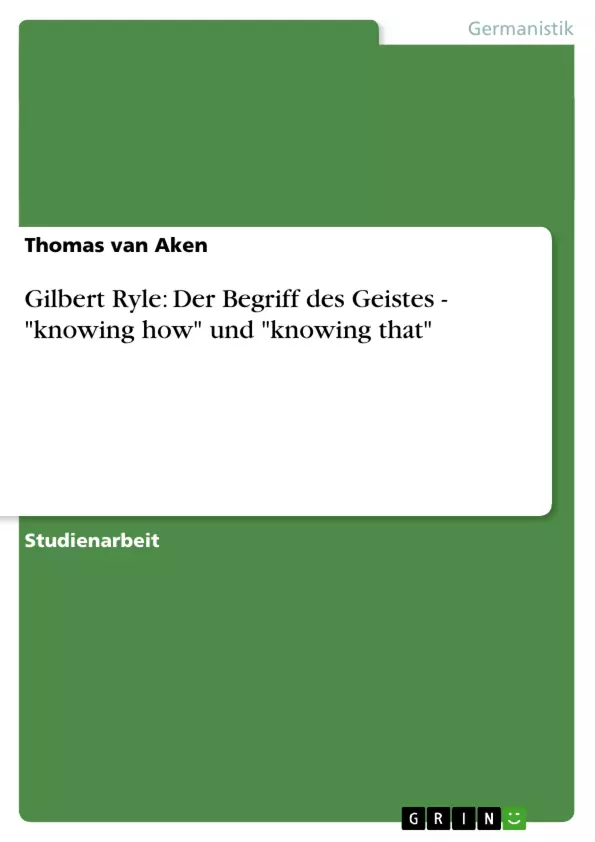Platon war einer der ersten griechischen Philosophen, die Körper und Geist voneinander trennten. Er glaubte, dass der Geist über die sinnlich wahrnehmbare physische Welt hinausreiche und abstrakte Gedanken und ideale Wirklichkeiten entwickele. Lange Zeit ruhten diese unter der Bezeichnung „Leib-Seele-Dualismus“ zusammengefassten Thesen, bis Descartes sie im 17. Jahrhundert wieder aufgriff und sie zu seiner Idee vom Menschen als belebte Maschine fortentwickelte. Seine Vorstellungen sind bis heute noch durchaus verbreitet und üben weiterhin Einfluss auf die aktuellen Vorstellungen vom Geist des Menschen aus.
Der Sprachphilosoph Gilbert Ryle (1900-1976) versucht mit seiner Abhandlung „Der Begriff des Geistes“ mit gewissen Vorbehalten eine eigene Theorie des Geistes aufzustellen. Dies tut er, in dem er auf sprachanalytischem Wege Begriffsklärung betreibt und sich von den in der Tradition Platons und Descartes stehenden und seiner Meinung nach nicht länger haltbaren Denkmustern und Sprachgebräuchen abgrenzt.
In der vorliegenden Arbeit, die hauptsächlich das zweite Kapitel „Können und Wissen“ („knowing how“ und „knowing that“) der Abhandlung untersucht, soll zuerst auf die grundlegenden Theorien Descartes eingegangen werden. Nach einer kurzen Einführung in den sprachphilosophischen Hintergrund Ryles, werden dessen Hauptkritikpunkte an der cartesischen Theorie Lehre dargelegt. Danach soll die zentrale Bedeutung des Begriff des Könnens bei Ryle gezeigt werden. Zwei weitere Ansatzpunkte der Kritik Ryles, die Begriffe „im Kopf“ und „im Geiste“ sowie der Solipsismus, bilden den Schluss dieser Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Descartes' Mythos vom „Gespenst in der Maschine“
- Ryles Auseinandersetzung mit der cartesischen Lehre
- Die Philosophie der Alltagssprache
- Ryles destruktive Analyse
- Kategorienverwechslung
- Descartes Intelligenzbegriff
- Theoriebildung: Aspekte des Könnens
- Dispositionen
- Können als bestimmendes Merkmal der Intelligenz
- Intelligenz und Gewohnheiten
- Verstehen, Missverstehen und Fehler
- Weitere Kritikpunkte an der „Zwei-Welten-Theorie“
- „Im Kopf“ und „im Geiste“
- Solipsismus
- Zusammenfassung und kritische Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Ryles Kritik an der cartesischen Lehre vom Geist und entwickelt eine eigene Theorie des Geistes, die auf der Sprachanalyse basiert. Ryle kritisiert Descartes' Dualismus von Körper und Geist, der seiner Meinung nach zu einer falschen Vorstellung vom Geist führt.
- Kritik an Descartes' „Gespenst in der Maschine“-Metapher
- Ryles Konzept der „Philosophie der Alltagssprache“
- Die Bedeutung des „Könnens“ für Ryles Theorie des Geistes
- Ryles Kritik an den Begriffen „im Kopf“ und „im Geiste“
- Ryles Kritik am Solipsismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Leib-Seele-Dualismus von Platon bis Descartes.
- Descartes' Mythos vom „Gespenst in der Maschine“: Dieses Kapitel beschreibt Descartes' Theorie vom Geist als einem unabhängigen Wesen, das vom Körper getrennt ist. Descartes' Argumente werden dargestellt und seine These vom „Gespenst in der Maschine“ erläutert.
- Ryles Auseinandersetzung mit der cartesischen Lehre: Dieses Kapitel analysiert Ryles Kritik an Descartes' Theorie. Ryles sprachphilosophischer Ansatz und seine Kritikpunkte werden vorgestellt, darunter seine Argumentation gegen den Dualismus von Körper und Geist.
- Die Philosophie der Alltagssprache: Dieses Kapitel beschreibt Ryles Sprachphilosophie und erklärt, warum er die Alltagssprache als Ausgangspunkt für die Analyse des Geistes verwendet.
- Ryles destruktive Analyse: Dieses Kapitel geht auf die Hauptargumente von Ryles Kritik an Descartes ein, darunter seine Kritik an der Kategorienverwechslung und an Descartes' Intelligenzbegriff.
- Theoriebildung: Aspekte des Könnens: Dieses Kapitel zeigt die zentrale Bedeutung des „Könnens“ für Ryles Theorie des Geistes. Es werden verschiedene Aspekte des Könnens untersucht, wie z. B. Dispositionen, Gewohnheiten und das Verhältnis zwischen Können und Intelligenz.
- Weitere Kritikpunkte an der „Zwei-Welten-Theorie“: Dieses Kapitel behandelt weitere Kritikpunkte Ryles an der cartesischen Lehre, darunter seine Kritik an den Begriffen „im Kopf“ und „im Geiste“ sowie am Solipsismus.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Gilbert Ryle, Philosophie der Alltagssprache, Sprachphilosophie, Descartes, Dualismus, Körper-Geist-Problem, „Gespenst in der Maschine“, „Knowing how“, „Knowing that“, Können, Intelligenz, Solipsismus, „Im Kopf“, „Im Geiste“.
- Quote paper
- Magister Artium Thomas van Aken (Author), 2002, Gilbert Ryle: Der Begriff des Geistes - "knowing how" und "knowing that", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/16343