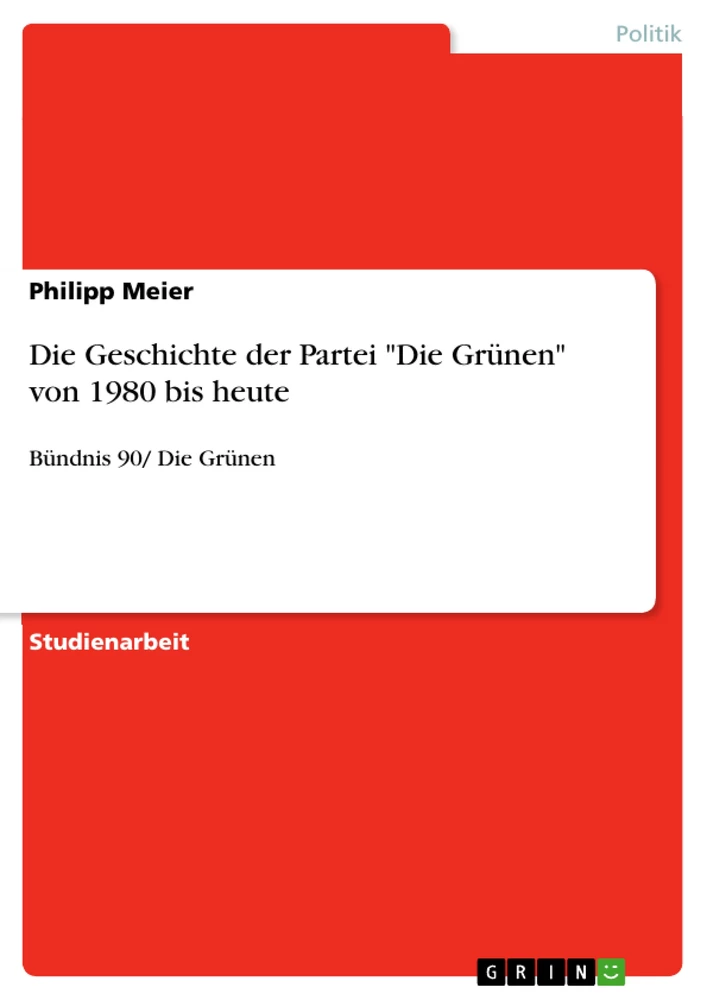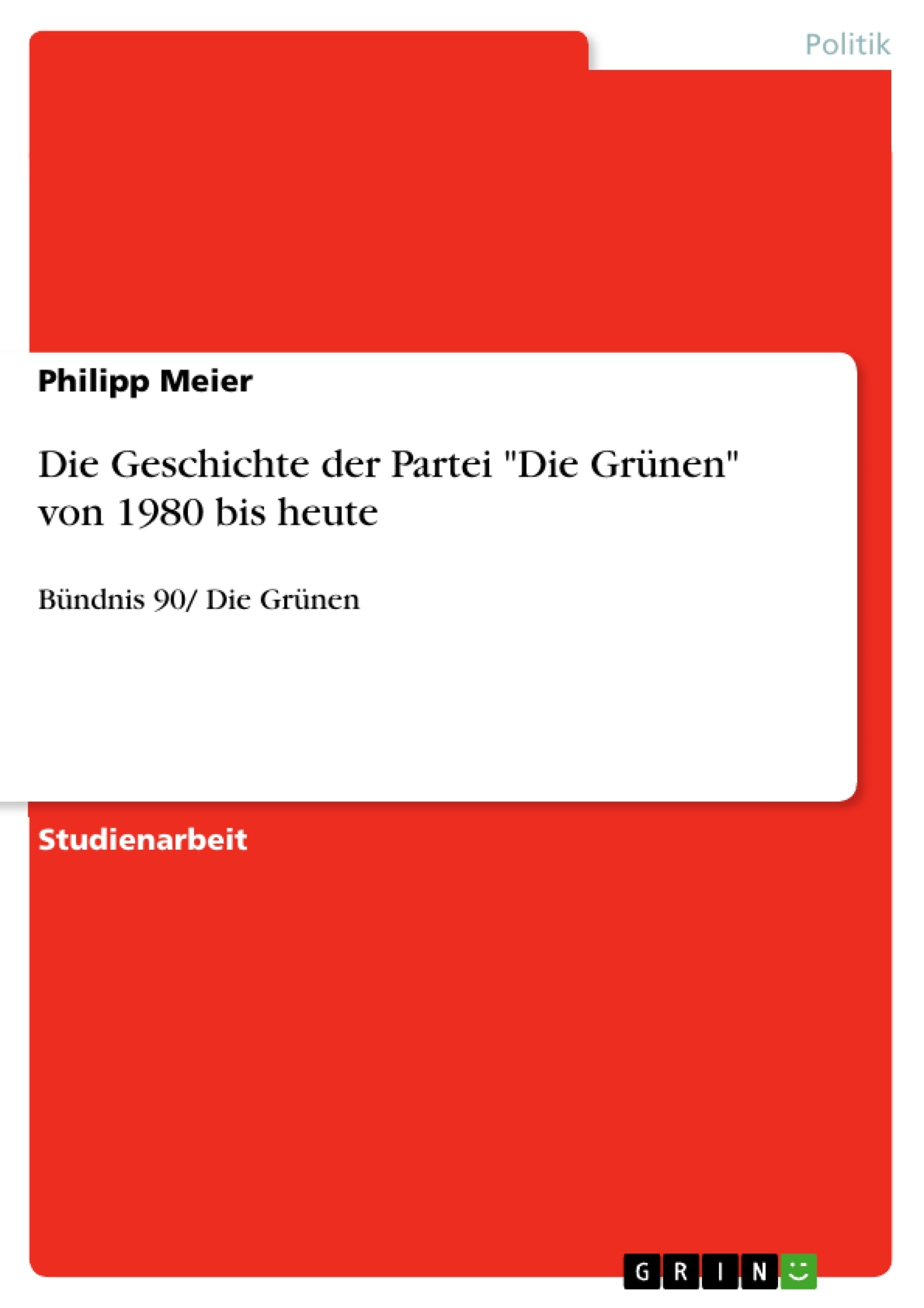„Die Grünen“ feierten dieser Tage das 30. Jubiläum ihres Bestehens. Seit der Gründung im Jahre 1980 durchlief die Partei eine durchwachsene Entwicklung. Die Grünen schafften es, sich von einer Rand- und Oppositionspartei bis hin zur Regierungspartei auf Landes- und Bundesebene zu wandeln. In den ersten Wahlen an denen die Grünen in ihren Anfangsjahren teilnahmen erreichten sie nur wenige Prozentpunkte. Doch schon innerhalb kurzer Zeit und wenigen Jahren schafften die Grünen es mit umweltbezogenen Programmschwerpunkten ein ernst zu nehmender Teil der deutschen Parteienlandschaft zu werden.
Ziel meiner Facharbeit ist es, die junge aber doch spannende und aufregende Geschichte der Partei "Bündnis 90/ Die Grünen" darzustellen und die Entwicklung von der anfänglichen Rand- bis hin zur Regierungspartei näher darzulegen und zu erläutern.
Wer genau sind "Die Grünen" eigentlich und wer steckt hinter dieser Partei? Was waren die Beweggründe für die Entstehung der Partei und welche Personen waren an der Gründung beteiligt? Wieso heißt die Partei „Bündnis 90/Die Grünen“? Welche Rolle spielten die Grünen in den Anfangsjahren ihrer Geschichte und welche Rolle spielen sie heute? Diese Fragen möchte ich klären.
In meiner Arbeit möchte ich zurückblicken in die Jahre vor der Gründung der Grünen und aufzeigen wieso es zu der Gründung kam und was die Menschen damals bewegte eine neue Partei zu gründen. Im Weiteren möchte ich die Entwicklung der Grünen darstellen und politische Herausforderungen und Erfolge der Partei erläutern.
Ferner soll eine Darstellung der Regierungsjahre auf Bundesebene unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer Teil dieser Arbeit sein sowie eine Betrachtung der aktuellen Situation der Grünen als Oppositionspartei in der derzeitigen Legislaturperiode.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte und Gründung 1980
- Die Entstehung der Grünen
- Erste Wahlerfolge und Gründung der Partei
- Die ersten Jahre der Partei
- Etablierung im Bundestag 1983 - 1990
- Die Spaltung der Partei in „Fundis“ und „Realos“
- Weitere Wahlerfolge und politische Einflussnahme
- Fusion mit Bündnis 90 und Restrukturierung 1990 - 1998
- Die Grünen in der Bundesregierung 1998 - 2005
- Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag seit 2005
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit befasst sich mit der Geschichte der Partei „Bündnis 90/ Die Grünen“ von ihrer Gründung im Jahr 1980 bis zur heutigen Zeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Entwicklung der Partei von einer Rand- und Oppositionspartei zu einer Regierungspartei auf Landes- und Bundesebene.
- Die Entstehung und Entwicklung der Partei „Die Grünen“
- Die Rolle der Grünen in der deutschen Politik und Gesellschaft
- Die wichtigsten politischen Themen und Herausforderungen der Partei
- Die Bedeutung der Grünen in der Regierungsbildung und als Oppositionspartei
- Die Herausforderungen und Chancen der Grünen in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Partei „Die Grünen“ sowie über die Zielsetzung und den Aufbau der Facharbeit.
Vorgeschichte und Gründung 1980
Dieses Kapitel beschreibt die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die zur Gründung der Grünen führten. Es beleuchtet die verschiedenen sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen, die sich gegen Atomkraft, Umweltverschmutzung und die Nachrüstung einsetzten. Es wird dargestellt, wie aus diesen Bewegungen die „Grünen“ als politische Kraft entstanden.
Die ersten Jahre der Partei
Dieses Kapitel beschreibt die frühen Jahre der Partei, ihre ersten Wahlerfolge und die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sah. Es werden die politischen Themen, die die Grünen in den ersten Jahren beschäftigten, wie zum Beispiel Umweltschutz und Friedenspolitik, beleuchtet.
Etablierung im Bundestag 1983 - 1990
Dieses Kapitel behandelt den Einzug der Grünen in den Bundestag im Jahr 1983 und die Herausforderungen, die mit der Etablierung als parlamentarische Partei einhergingen. Es beschreibt den Konflikt zwischen den „Fundis“ und den „Realos“, die unterschiedliche Strategien für die politische Arbeit der Partei verfolgten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder der Facharbeit sind: „Die Grünen“, „Bündnis 90/ Die Grünen“, „Umweltpolitik“, „Friedenspolitik“, „Atomkraft“, „Nachrüstung“, „Alternative Politik“, „Grünbewegung“, „Politische Entwicklung“, „Regierungspartei“, „Oppositionspartei“, „Fundis“, „Realos“.
- Arbeit zitieren
- Philipp Meier (Autor:in), 2010, Die Geschichte der Partei "Die Grünen" von 1980 bis heute, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/163126