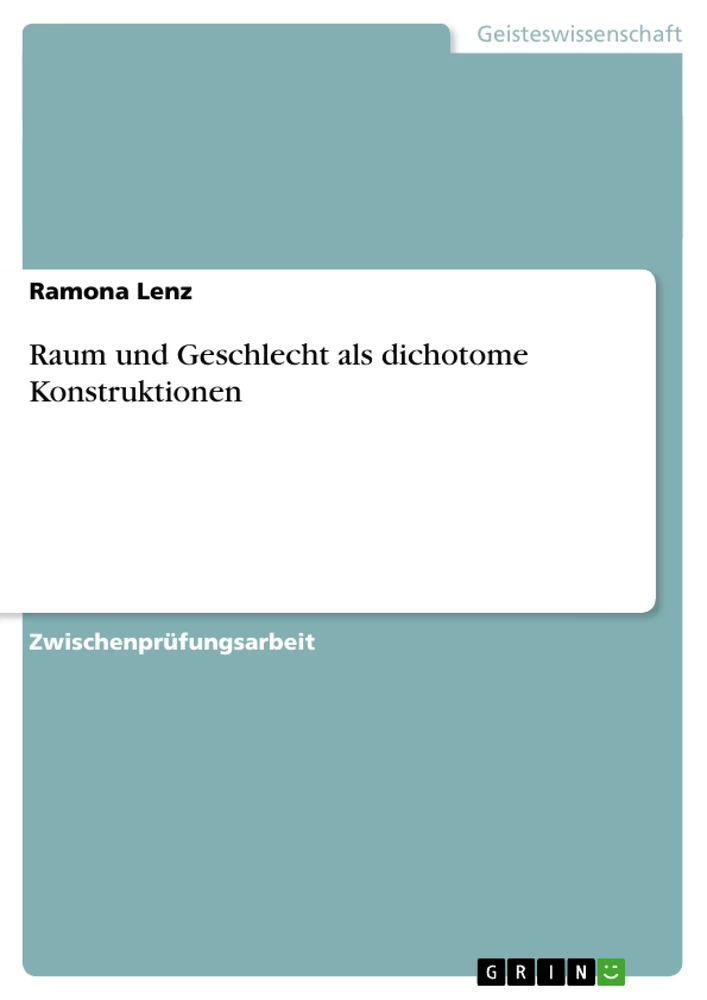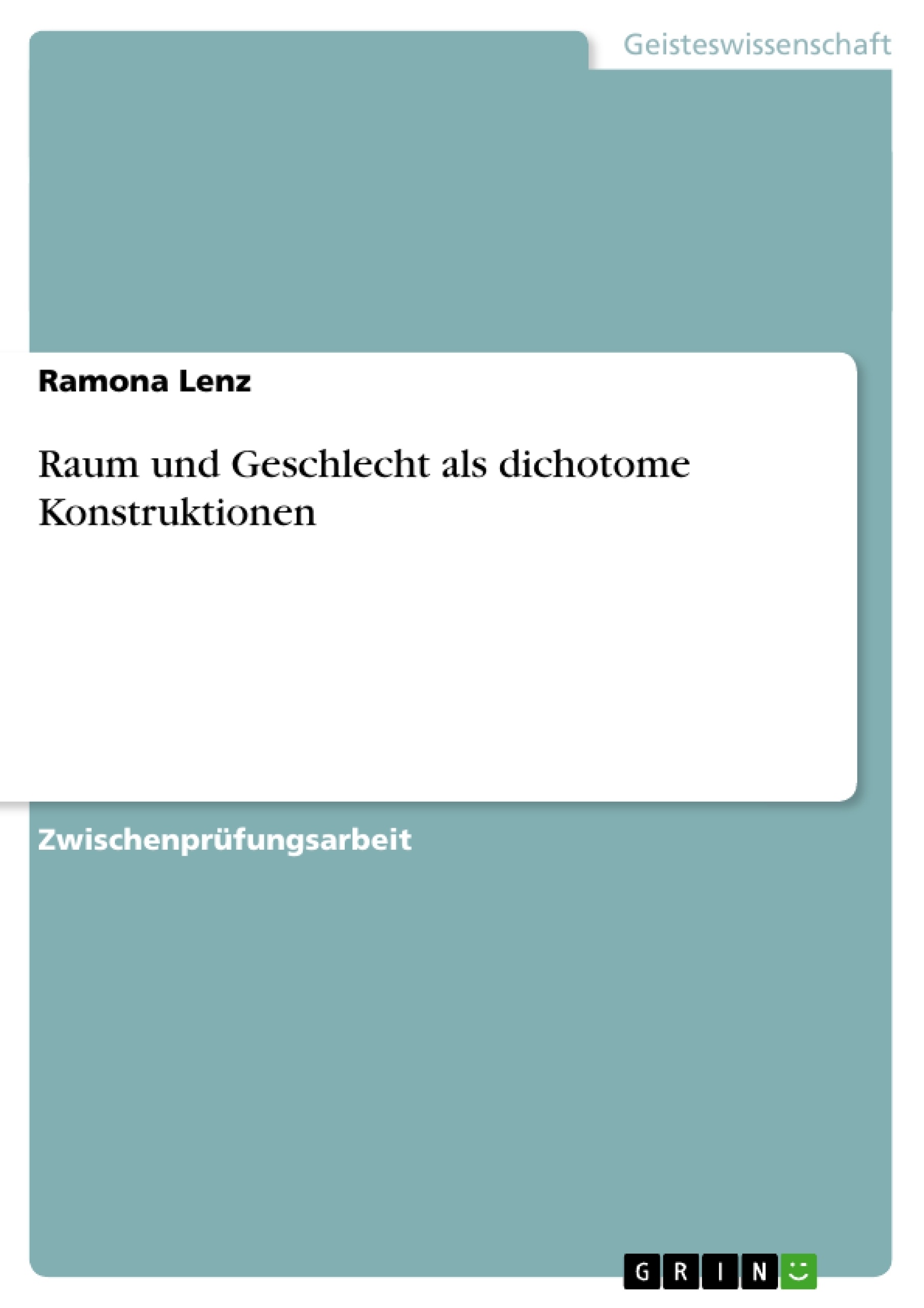Raum und Geschlecht sind zwei Faktoren, die untrennbar miteinander verbunden scheinen. Ich
werde im Folgenden zeigen, dass die Dichotomie öffentlich/privat analog zur binären Struktur des
Geschlechterverhältnisses männlich/weiblich ein hierarchisches Konstrukt ist, dem die soziale Realität
selten oder gar nicht entspricht. Es wird dabei zu erklären sein, wie dieses hegemoniale Modell trotz
vervielfältigter und fragmentierter Lebensweisen im Sinne einer Stabilisierung von Machtstrukturen
wirksam ist. Zu diesem Zweck werde ich verschiedene androzentrische Theorien aus
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen kritisch dahingehend untersuchen, wie sie diese
Bipolarität reproduzieren. Anschließend werde ich Theorien vorstellen, die m.E. Material für ein
Denken jenseits der Dichotomien Frau/Mann, Privat/Öffentlich bereitstellen. Anhand zweier
ethnologischer Studien zeige ich dann, wie die Erkenntnis der Existenz von Lebensweisen jenseits
des binären Rahmens methodisch umgesetzt werden kann und schließe mit einem Vorschlag für
dementsprechende kulturanthropologische Forschung in der Großstadt.
Entsprechend den sich vervielfältigenden und verkomplizierenden Lebensweisen, ist auch meine
Arbeit in Teilen fragmentarisch und bisweilen vielleicht widersprüchlich. Vieles wird lediglich
angedacht und ohne die Formulierung künstlicher Zusammenhänge nebeneinandergestellt. Und wenn
dennoch sprachlich Überschriften und Überleitungen geschaffen werden, so meine ich zwar, dass sie
Sinn machen. Dennoch bzw. gerade deswegen sind sie kritisch zu betrachten.
Vor diesem Hintergrund möchte ich noch kurz auf die Begriffe Feminismus und Postmoderne
eingehen, die in der vorliegenden Arbeit, wenn auch nicht immer explizit und intendiert, eine Rolle
spielen. Wenn feministisches Arbeiten sich dadurch auszeichnet, dass androzentrische
Erklärungsmodelle als unzulässig verallgemeinernd und hegemonial kritisiert und Ansätze jenseits
dessen formuliert bzw. aufgegriffen werden, dann ist meine Arbeit als feministisch zu begreifen. Wenn
es aber das Merkmal jeglichen wissenschaftlichen Arbeitens - und insbesondere des sog.
postmodernen - ist, unzulässig verallgemeinernde und hegemoniale Erklärungsmodelle zu kritisieren
und Ansätze jenseits dessen zu formulieren bzw. aufzugreifen, dann kann meine Arbeit als in der
Vorgehensweise postmodern und in Thema und Zielrichtung feministisch betrachtet werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die dichotome Setzung von Mann/Frau analog zu Öffentlich/Privat
- Geschlechterdifferenz als soziale und kulturelle Konstruktion
- Privatheit und Öffentlichkeit als ein Konzept des 19. Jahrhunderts
- „Materialer Raum“ und „gesellschaftliche Sphäre“
- Kritik androzentrischer Theorien zu Öffentlichkeit und Privatheit
- Kritik androzentrischer Theorien zum Haus
- Otto Friedrich Bollnow
- Pierre Bourdieu
- Kritik androzentrischer Theorien zur Öffentlichkeit
- Jürgen Habermas
- Clifford Geertz
- Kritik androzentrischer Theorien zum Haus
- Theorien zum Raum jenseits der Dichotomien Privat/Öffentlich
- ,,Andere Räume“
- ,,Praktiken im Raum“
- ,,Nicht-Orte“
- ,,Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum“
- „Gesellschaftliche Produktion des Raumes als Bedingung spätkapitalistischer Umstrukturierung“
- Die Faktoren Raum und Geschlecht in der ethnologischen Feldforschung
- Sigrid Westphal-Hellbusch: Transvestiten (1956)
- Dorle Dracklé: „Die Frau gehört ins Haus und der Mann auf die Straße“ (1998)
- Schlussbemerkung und Ideen zu Feldforschung auf der Straße
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Dichotomie von öffentlich und privat im Verhältnis zur Geschlechterdifferenz. Ziel ist es aufzuzeigen, dass diese binäre Struktur ein hierarchisches Konstrukt darstellt, das die soziale Realität nicht immer abbildet und wie dieses Modell trotz veränderter Lebensweisen zur Stabilisierung von Machtstrukturen beiträgt. Kritisch analysiert werden androzentrische Theorien, und es werden alternative Theorien vorgestellt, die ein Denken jenseits dieser Dichotomien ermöglichen.
- Kritik androzentrischer Theorien zu Raum und Geschlecht
- Konstruktion von Öffentlichkeit und Privatheit als soziale und kulturelle Konstrukte
- Alternative Raumkonzepte jenseits der Dichotomie öffentlich/privat
- Methodische Umsetzung alternativer Raumkonzepte in der ethnologischen Feldforschung
- Vorschlag für kulturanthropologische Forschung in der Großstadt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Forschungsfrage, die sich mit dem Verhältnis von Raum und Geschlecht als dichotome Konstrukte beschäftigt. Es wird die These aufgestellt, dass die Dichotomie öffentlich/privat analog zur binären Struktur Mann/Frau ein hierarchisches Konstrukt ist, welches die soziale Realität nur unzureichend abbildet. Die Arbeit wird die kritische Auseinandersetzung mit androzentrischen Theorien und die Vorstellung alternativer Konzepte umfassen, sowie die methodische Umsetzung in der ethnologischen Feldforschung beleuchten.
Die dichotome Setzung von Mann/Frau analog zu Öffentlich/Privat: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die Dichotomie von Mann/Frau und öffentlich/privat als sozial und kulturell konstruiert darstellt und ihre historische Entwicklung beleuchtet. Es werden die Konsequenzen dieser Dichotomie für die Machtstrukturen in der Gesellschaft diskutiert. Die Analyse legt den Fokus auf die hierarchischen Implikationen dieser binären Oppositionen. Das Kapitel dient als theoretische Basis für die spätere Kritik an androzentrischen Theorien.
„Materialer Raum“ und „gesellschaftliche Sphäre“: Dieses Kapitel behandelt den komplexen Zusammenhang zwischen physischem Raum und gesellschaftlicher Sphäre. Es analysiert wie materielle Räume soziale Praktiken beeinflussen und wie soziale Strukturen wiederum die Gestaltung und Nutzung des Raumes prägen. Die Verbindung zwischen dem physischen und dem gesellschaftlichen Raum bildet die Grundlage für die anschließende Analyse androzentrischer Theorien.
Kritik androzentrischer Theorien zu Öffentlichkeit und Privatheit: Dieses Kapitel liefert eine kritische Auseinandersetzung mit ausgewählten androzentrischen Theorien aus unterschiedlichen Disziplinen. Es untersucht, wie diese Theorien die Bipolarität von Mann/Frau und öffentlich/privat reproduzieren und welche Auswirkungen dies auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Raum und Geschlecht hat. Die Analyse umfasst die Theorien von Bollnow, Bourdieu, Habermas und Geertz und zeigt deren Stärken und Schwächen im Kontext der Forschungsfrage auf.
Theorien zum Raum jenseits der Dichotomien Privat/Öffentlich: In diesem Kapitel werden Theorien vorgestellt, die über die beschränkende Dichotomie von Privatheit und Öffentlichkeit hinausgehen. Es werden alternative Konzepte und Perspektiven auf Raum präsentiert, wie z.B. die Konzepte "andere Räume", "Praktiken im Raum", "Nicht-Orte" und der "angeeignete physische Raum", welche ein differenzierteres Verständnis von der Interaktion zwischen Raum und Geschlecht ermöglichen.
Die Faktoren Raum und Geschlecht in der ethnologischen Feldforschung: Dieses Kapitel präsentiert zwei ethnologische Studien (Westphal-Hellbusch und Dracklé) als Beispiele für die methodische Umsetzung eines Denkens jenseits des binären Rahmens von Mann/Frau und öffentlich/privat. Die Analyse dieser Studien veranschaulicht, wie die Erkenntnis von Lebensweisen jenseits dieser Dichotomien in die Feldforschung integriert werden kann. Es zeigt auf, wie die Berücksichtigung von Raum und Geschlecht die Interpretation ethnologischer Daten verbessern und erweitern kann.
Schlüsselwörter
Raum, Geschlecht, Öffentlichkeit, Privatheit, Dichotomie, Androzentrismus, Feminismus, Postmoderne, ethnologische Feldforschung, soziale Konstruktion, Machtstrukturen, alternative Raumkonzepte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text untersucht die Dichotomie von öffentlich und privat im Verhältnis zur Geschlechterdifferenz. Er analysiert kritisch, wie diese binäre Struktur ein hierarchisches Konstrukt darstellt, das die soziale Realität nicht immer abbildet und wie dieses Modell trotz veränderter Lebensweisen zur Stabilisierung von Machtstrukturen beiträgt.
Welche Theorien werden im Text kritisch analysiert?
Der Text analysiert kritisch androzentrische Theorien zur Öffentlichkeit und Privatheit von Autoren wie Otto Friedrich Bollnow, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas und Clifford Geertz. Es wird aufgezeigt, wie diese Theorien die Bipolarität von Mann/Frau und öffentlich/privat reproduzieren und welche Auswirkungen dies auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Raum und Geschlecht hat.
Welche alternativen Raumkonzepte werden vorgestellt?
Der Text präsentiert alternative Raumkonzepte, die über die beschränkende Dichotomie von Privatheit und Öffentlichkeit hinausgehen. Dazu gehören Konzepte wie „andere Räume“, „Praktiken im Raum“, „Nicht-Orte“ und der „angeeignete physische Raum“, die ein differenzierteres Verständnis der Interaktion zwischen Raum und Geschlecht ermöglichen.
Wie wird die methodische Umsetzung in der ethnologischen Feldforschung behandelt?
Der Text zeigt anhand von ethnologischen Studien (Westphal-Hellbusch und Dracklé), wie ein Denken jenseits des binären Rahmens von Mann/Frau und öffentlich/privat in die Feldforschung integriert werden kann. Es wird veranschaulicht, wie die Berücksichtigung von Raum und Geschlecht die Interpretation ethnologischer Daten verbessern und erweitern kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Raum, Geschlecht, Öffentlichkeit, Privatheit, Dichotomie, Androzentrismus, Feminismus, Postmoderne, ethnologische Feldforschung, soziale Konstruktion, Machtstrukturen, alternative Raumkonzepte.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die dichotome Setzung von Mann/Frau analog zu Öffentlich/Privat, „Materialer Raum“ und „gesellschaftliche Sphäre“, Kritik androzentrischer Theorien zu Öffentlichkeit und Privatheit, Theorien zum Raum jenseits der Dichotomien Privat/Öffentlich, Die Faktoren Raum und Geschlecht in der ethnologischen Feldforschung und Schlussbemerkung und Ideen zu Feldforschung auf der Straße.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung des Textes ist es aufzuzeigen, dass die binäre Struktur von öffentlich/privat analog zur binären Struktur Mann/Frau ein hierarchisches Konstrukt darstellt, das die soziale Realität nicht immer abbildet. Der Text möchte alternative Theorien vorstellen, die ein Denken jenseits dieser Dichotomien ermöglichen und die methodische Umsetzung in der ethnologischen Feldforschung beleuchten.
Welche Konsequenzen der Dichotomie öffentlich/privat werden diskutiert?
Der Text diskutiert die hierarchischen Implikationen der Dichotomie öffentlich/privat für die Machtstrukturen in der Gesellschaft und die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Raum und Geschlecht.
- Quote paper
- Ramona Lenz (Author), 1999, Raum und Geschlecht als dichotome Konstruktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/16278