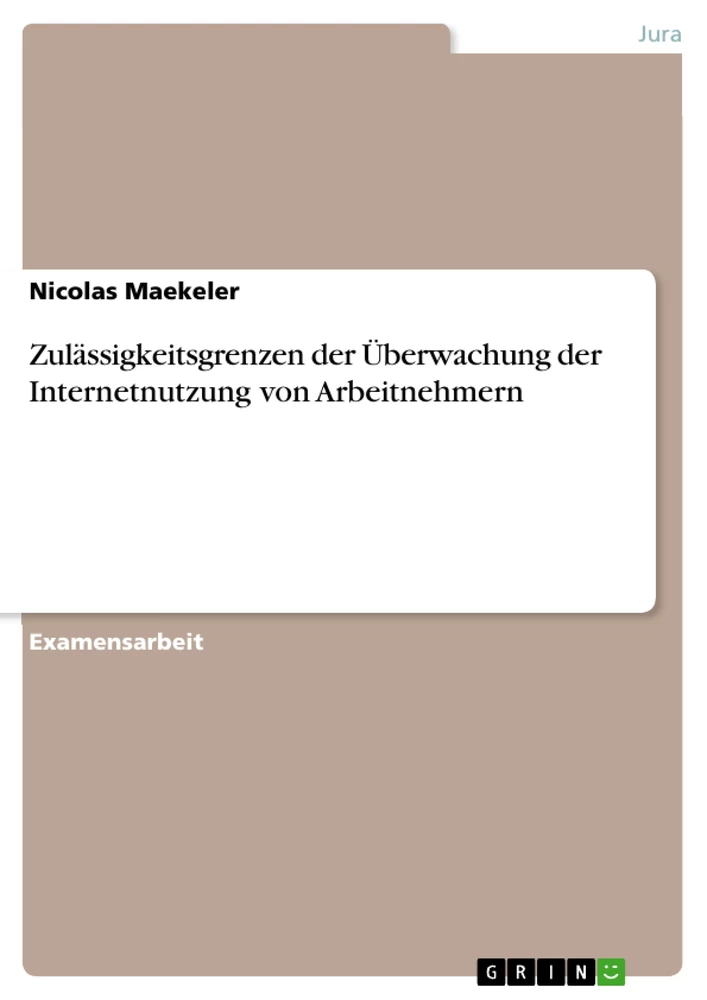Auszug aus der Einleitung:
Die Evolution der Informationstechnologie führt zu einer rasanten und kontinuierlichen Weiterentwicklung der digitalisierten Arbeitswelt. Um die Konkurrenzfähigkeit eines Betriebes zu sichern, kann es sich längst kein Unternehmen mehr erlauben, auf moderne Kommunikationsmittel zu verzichten. Telekommunikationsmedien wie das Internet steigern in einem immensen Maße die Effektivität des Arbeitseinsatzes von Angestellten, weswegen jeder Arbeitgeber bemüht sein wird, die wirtschaftlichen Ergebnisse durch die Bereitstellung eines weitgehend digitalisierten Arbeitsumfeldes wirtschaftlich zu optimieren. Doch die Investition für ein fortschrittliches Firmennetzwerk können noch so hoch sein, letztlich ist es der persönliche Einsatz eines jeden Angestellten, der die Funktionsfähigkeit der betrieblichen Organisation gewährleistet. So liegt es im natürlichen Interesse des Arbeitgebers, die qualitativen und quantitativen Arbeitsergebnisse seiner Angestellten zu kontrollieren.
Einhergehend mit der Weiterentwicklung von IuK-Technologien eröffnen sich dem Arbeitgeber völlig neuartige Überwachungsmöglichkeiten, die ihm zur Leistungskontrolle zur Verfügung stehen; denn jeder Umgang mit Kommunikationsmedien hinterlässt eine Vielzahl von Informationsspuren, welche ohne großen technischen Aufwand zur Kenntnis genommen und ausgewertet werden können. Gleichwohl besteht aber eine große Unsicherheit bzgl. des Umgangs mit derartigen Daten, hauptsächlich bedingt durch die unbestimmte Rechtslage. In wieweit diese erhoben, kontrolliert oder in irgendeiner Form verwendet werden dürfen, wird den meisten Arbeitgebern nicht bekannt sein.
Ziel der folgenden Untersuchung ist es deswegen, einen Teilbereich der Arbeitnehmerüberwachung rechtlich zu durchleuchten. Der Fokus wird dabei auf die Überwachung des bedeutendsten Kommunikationsmediums gerichtet, dem Internet. Primär sollen dabei die arbeitgeberseitigen Zulässigkeitsgrenzen von Kontrollmaßnahmen aufgezeigt werden, welche in Bezug auf die Internetnutzung durch Arbeitnehmer einzuhalten sind.
Um ein Verständnis dafür zu bekommen, in welchem Umfang sich die Internetnutzung eines Unternehmens bewegt, werden zunächst die relevanten Internetanwendungen skizziert. Grundlegend für eine Beurteilung der Internetüberwachung sind vor allen Dingen die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten; eine Abwägung der widerstreitenden Interessen scheint für eine Lösung der Problemstellung unablässig zu sein.....
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Internetnutzung in Unternehmen
- I. Internetdienste
- 1. World Wide Web
- 2. E-Mail
- 3. Usenet
- 4. File Transfer Protocol
- 5. Echtzeitkommunikationsdienste
- a. Internet Relay Chat/Instant Messaging
- b. Voice over IP
- 6. Intranet
- II. Arbeitgeberinteressen
- 1. Allgemeine Interessenlage
- 2. Grundrechtlich geschützte Interessen des Arbeitgebers
- III. Arbeitnehmerinteressen
- 1. Allgemeine Interessenlage
- 2. Grundrechtlich geschützte Interessen des Arbeitnehmers
- IV. Abgrenzung zwischen dienstlicher und privater Nutzung des Internets
- 1. Dienstliche Nutzung
- 2. Private Nutzung
- 3. Differenzierung zwischen erlaubter und nicht erlaubter Privatnutzung
- C. Überwachungsmöglichkeiten der Internetnutzung
- I. Die Spuren im Netz
- II. Technische Möglichkeiten der Überwachung
- 1. Präventivmaßnahmen: Nutzungsbeschränkung/Filterung
- 2. Überwachung durch „Standardsoftware“
- 3. Besondere Überwachungssoftware
- D. Gesetzliche Vorgaben für die Arbeitnehmerüberwachung
- I. Telekommunikationsrechtliche Vorgaben
- 1. Anwendbarkeit des TKG im Arbeitsverhältnis
- 2. Arbeitgeber als Diensteanbieter und Normadressat der §§ 88 ff. TKG?
- 3. Das Fernmeldegeheimnis gem. § 88 TKG
- 4. Erlaubnistatbestände des TKG
- a. Einwilligung
- b. Aufbau bzw. Aufrechterhaltung der Telekommunikation/Abrechnungszwecke/Störungsprävention und Datensicherheitsmaßnahmen
- c. Aufdecken und Unterbinden von Missbräuchen
- II. Spezielle datenschutzrechtliche Vorgaben
- 1. Anwendbarkeit des TDDSG im Arbeitsverhältnis
- 2. Unternehmensnetzwerk als Teledienst i.S.d. TDDSG
- 3. Vorschriften des TDDSG
- 4. Erlaubnistatbestände des TDDSG
- a. Einwilligung/Kollektivvereinbarung
- b. Gesetzliche Erlaubnistatbestände
- III. Allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben
- 1. Anwendbarkeit des BDSG im Arbeitsverhältnis
- 2. Regelungsgehalt des BDSG
- a. Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1)
- b. Interessenabwägung/Erforderlichkeit (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG)
- c. Informationspflicht (§§ 33 Abs. 1, 4 Abs. 3 BDSG)/Datensicherheitsmaßnahmen (§ 9 BDSG)
- IV. Betriebsverfassungsrechtliche Bedingungen
- E. Zulässigkeitsgrenzen der Internetüberwachung
- I. Grenzen der E-Mail-Überwachung
- 1. Überwachung von E-Mails bei verbotener Privatnutzung
- a. Verbindungsdaten
- b. Inhalt
- 2. Überwachung von E-Mails bei erlaubter Privatnutzung
- a. Verbindungsdaten
- b. Inhalt
- c. Sonderfall der E-Mail-Filterung
- II. Grenzen der WWW-Überwachung
- 1. Überwachung des WWW bei verbotener Privatnutzung
- a. Verbindungsdaten
- b. Inhalt
- 2. Überwachung des WWW bei erlaubter Privatnutzung
- III. Grenzen der Überwachung weiterer Internetdienste
- 1. Usenet
- 2. FTP
- 3. Echtzeitkommunikationsdienste
- a. VoIP
- aa. Verbotene Privatnutzung
- bb. Erlaubte Privatnutzung
- b. Instant Messaging
- c. IRC
- 4. Intranet
- IV. Sonderregeln für Angehörige bestimmter Berufsgruppen
- V. Verbot der „Vollkontrolle“
- F. Rechtsfolgen bei unzulässiger Internetüberwachung
- I. Ansprüche des Arbeitnehmers
- II. Strafrechtliche Folgen für den Arbeitgeber
- G. Reflexion
- I. Kritische Beurteilung
- II. Lösungsansätze für die Praxis
- H. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Zulässigkeit der Überwachung der Internetnutzung von Arbeitnehmern durch Arbeitgeber. Dabei wird die Abwägung zwischen den Interessen des Arbeitgebers an der Kontrolle der Internetnutzung und den Grundrechten des Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz und Privatsphäre untersucht.
- Die Abgrenzung zwischen dienstlicher und privater Internetnutzung
- Die technischen Möglichkeiten der Internetüberwachung
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Überwachung durch das Telekommunikationsrecht, Datenschutzrecht und Betriebsverfassungsrecht
- Die Zulässigkeit der Überwachung verschiedener Internetdienste wie E-Mail, World Wide Web und Echtzeitkommunikationsdienste
- Die Rechtsfolgen bei unzulässiger Internetüberwachung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Studienarbeit vor und erläutert die Relevanz der Untersuchung.
- Kapitel B befasst sich mit der Internetnutzung in Unternehmen. Hier werden die verschiedenen Internetdienste, die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie die Abgrenzung zwischen dienstlicher und privater Nutzung des Internets beleuchtet.
- Kapitel C geht auf die technischen Möglichkeiten der Überwachung der Internetnutzung ein. Es werden Präventivmaßnahmen, Standardsoftware und spezielle Überwachungssoftware vorgestellt.
- Kapitel D behandelt die rechtlichen Vorgaben für die Arbeitnehmerüberwachung. Es werden die Regelungen des Telekommunikationsrechts, des Datenschutzrechts und des Betriebsverfassungsrechts näher betrachtet.
- Kapitel E analysiert die Zulässigkeitsgrenzen der Internetüberwachung. Dabei werden die Grenzen der Überwachung von E-Mails, des World Wide Web und weiterer Internetdienste untersucht. Außerdem werden Sonderregeln für Angehörige bestimmter Berufsgruppen und das Verbot der „Vollkontrolle“ behandelt.
- Kapitel F beschreibt die Rechtsfolgen bei unzulässiger Internetüberwachung. Es werden Ansprüche des Arbeitnehmers und strafrechtliche Folgen für den Arbeitgeber aufgezeigt.
- Kapitel G widmet sich einer kritischen Beurteilung der Thematik und bietet Lösungsansätze für die Praxis.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerüberwachung, Internetnutzung, Telekommunikationsrecht, Datenschutzrecht, Betriebsverfassungsrecht, Grundrechte, informationelle Selbstbestimmung, Privatsphäre, E-Mail-Überwachung, WWW-Überwachung, Echtzeitkommunikationsdienste, Zulässigkeitsgrenzen, Rechtsfolgen.
- Quote paper
- Nicolas Maekeler (Author), 2006, Zulässigkeitsgrenzen der Überwachung der Internetnutzung von Arbeitnehmern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/162420