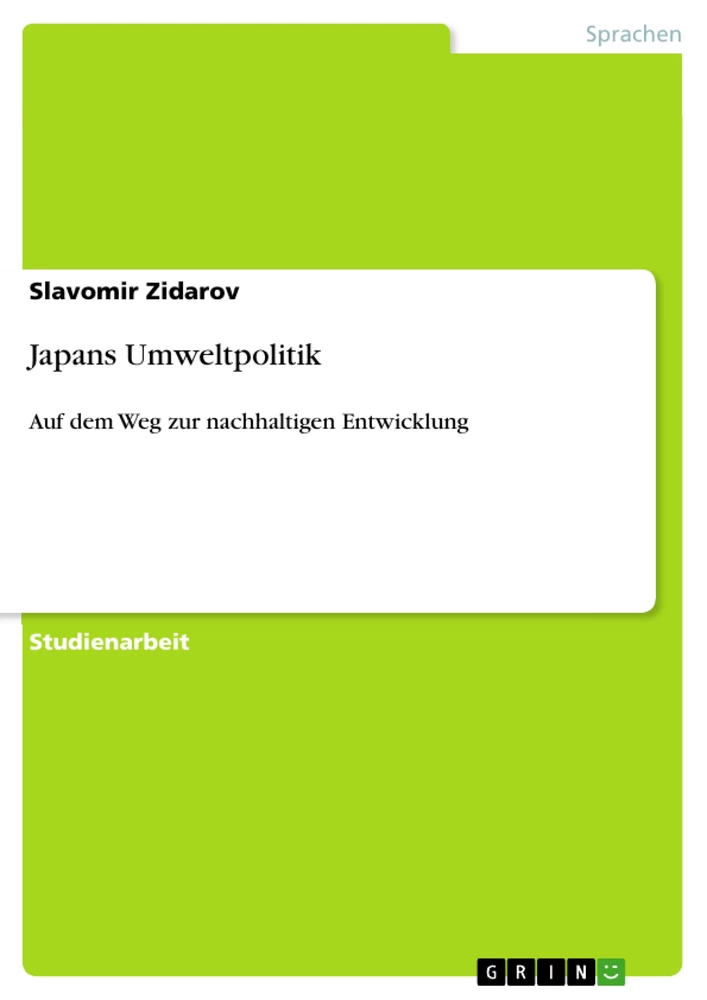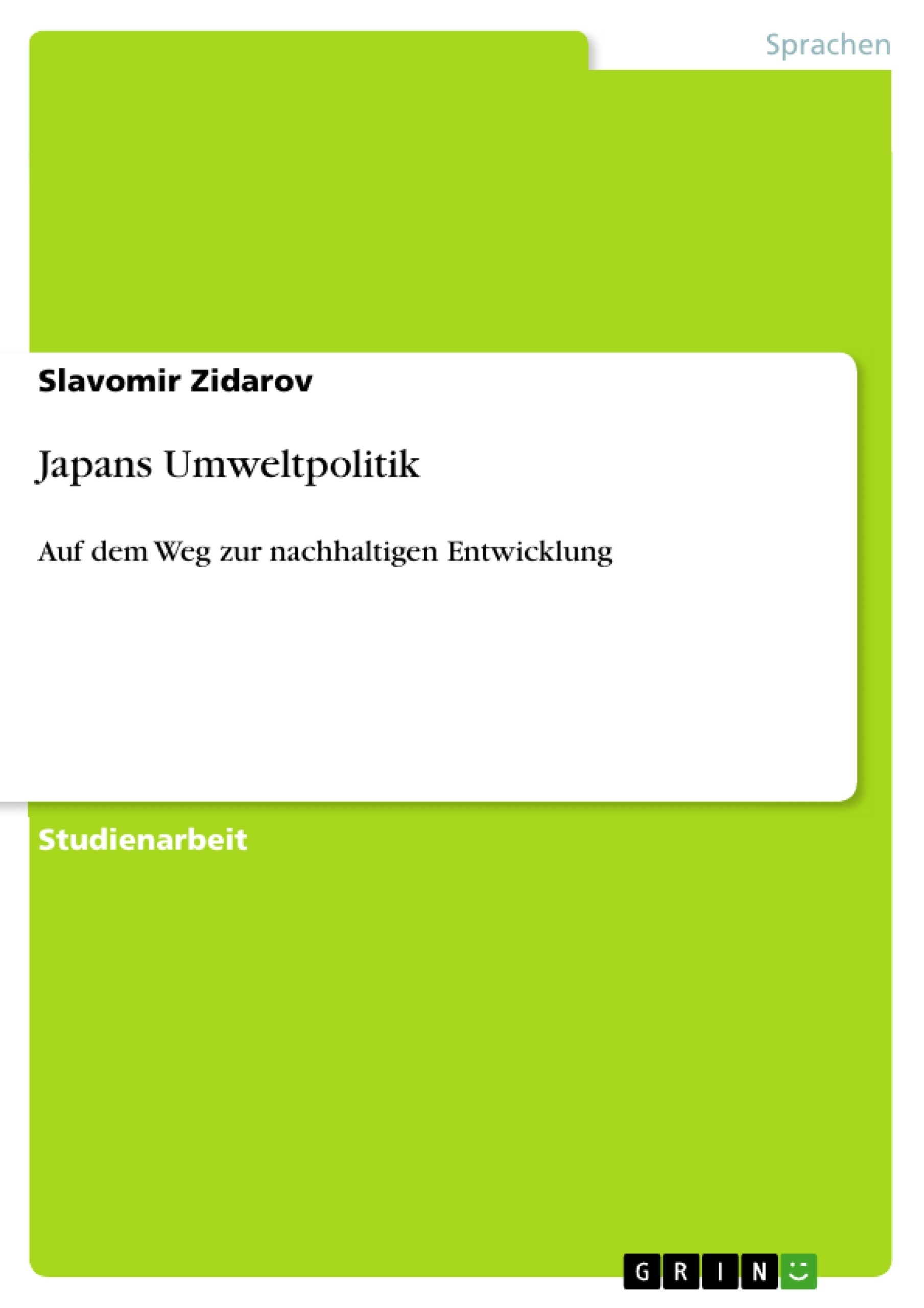1960 verspricht der damalige Premierminister Japans Ikeda Hayato, das nationale Einkommen innerhalb der nächsten Dekade zu verdoppeln . Die darauf folgende rasante industrielle Entwicklung in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts führt dazu, dass dieses Versprechen vollständig eingehalten wird – die japanische Wirtschaft erlebt einen eindrucksvollen Aufschwung, der eine enorme Steigerung des allgemeinen Wohlstands und Lebensstandards bewirkt und das Land in die Position einer wirtschaftlichen und politischen Großmacht im asiatisch-pazifischen Raum befördert. Der hohe Preis, den die japanische Gesellschaft für diese in der Tat beeindruckenden Leistungen ihrer Wirtschafts- und Industrialisierungspolitik bezahlen muss, macht sich erst mit den ersten schweren Fällen von umweltverschmutzungsbedingten Erkrankungen bemerkbar . Sie sind die ersten spürbaren Folgen der entfesselten Industrialisierung.
Die Probleme des Umweltschutzes und des verantwortungsvollen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen werden in den darauf folgenden Jahren zu zentralen Themen in allen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen. Sie ziehen einen aufwendigen institutionellen Wandelprozess nach sich, der sich in die Schaffung neuer administrativer Institutionen zur Konzipierung, Implementierung und Kontrolle von adäquaten Umweltschutzregelungen, beeinflussen die sozialen Wertkonstellationen und führen sogar neuartige Lebensstils herbei. Das reibungslose Zusammenspiel der politisch – administrativen und der zivilgesellschaftlichen Ebenen ist konstitutiv für die Effizienz solcher Maßnahmen und begünstigt gleichzeitig die Entstehung und Verwirklichung neuartiger Konzepte zur Sicherstellung der ökonomischen Wohlfahrt, aber auch der ökologischen Unversehrtheit als Träger von Lebensqualität für die Mitglieder einer Gesellschaft. Eines dieser Konzepte beschäftigt sich mit den Inhalten, Zielsetzungen und möglichen Vorteile des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
- I.2 Zielsetzung
- II. Hintergründe der japanischen Umweltproblematik
- III. Entwicklungszüge der japanischen Umweltpolitik
- IV. Komponenten der nachhaltigen Entwicklung mit Hinblick auf Japan
- IV.1 Japans Rolle bei der Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung im asiatisch - pazifischen Raum
- IV.2 Nachhaltigkeit im innenpolitischen Kontext
- V. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung der japanischen Umweltpolitik auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung. Sie analysiert die Hintergründe der japanischen Umweltproblematik, die Entwicklungszüge der Umweltpolitik und die Rolle Japans bei der Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum.
- Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und seine Relevanz im japanischen Kontext
- Die Herausforderungen der japanischen Umweltproblematik, die aus der rasanten Industrialisierung entstanden sind
- Die Entwicklungszüge der japanischen Umweltpolitik und die Einflüsse auf die gesellschaftlichen Werte und Lebensstile
- Die Rolle Japans bei der Förderung nachhaltiger Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum
- Die Integration von Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Dieses Kapitel führt das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ein und erläutert die Bedeutung dieses Konzepts im Kontext der japanischen Umweltpolitik. Es werden die Herausforderungen der Umweltproblematik in Japan im Zusammenhang mit der Industrialisierung und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Entwicklungspfads beleuchtet.
- II. Hintergründe der japanischen Umweltproblematik: Dieses Kapitel analysiert die historischen und gesellschaftlichen Hintergründe der japanischen Umweltproblematik. Es beleuchtet die Expansion Japans, die Industrialisierung und die daraus resultierenden Umweltbelastungen.
- III. Entwicklungszüge der japanischen Umweltpolitik: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der japanischen Umweltpolitik, die Reaktion der Regierung auf die Umweltproblematik und die Entstehung neuer Institutionen und Regelungen. Es beleuchtet auch die Auswirkungen der Umweltpolitik auf die Gesellschaft und die Entstehung neuer Lebensstile.
- IV. Komponenten der nachhaltigen Entwicklung mit Hinblick auf Japan: Dieses Kapitel betrachtet die nachhaltige Entwicklung im Kontext der japanischen Politik und Gesellschaft. Es analysiert die Rolle Japans bei der Förderung nachhaltiger Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum und die Integration von Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik in Japan.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Japans Umweltpolitik, nachhaltige Entwicklung, Industrialisierung, Umweltproblematik, Umweltschutz, Wirtschaftspolitik, Gesellschaftliche Werte, Lebensstil, Asien-Pazifik-Raum und Umweltbewusstsein.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich die Umweltproblematik in Japan?
Die rasante Industrialisierung der 1960er Jahre führte zu schweren Umweltverschmutzungen und Erkrankungen, was schließlich ein Umdenken in Politik und Gesellschaft erzwang.
Was ist das Ziel der japanischen Umweltpolitik heute?
Das zentrale Ziel ist die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung, die ökologische Unversehrtheit mit wirtschaftlicher Wohlfahrt verbindet.
Welche Rolle spielt Japan im asiatisch-pazifischen Raum?
Japan fungiert als Vorbild und wichtiger Akteur bei der Förderung von Umweltschutzstandards und nachhaltigen Konzepten in der gesamten Region.
Wie reagierte die japanische Regierung auf die frühen Umweltkrisen?
Es wurden neue administrative Institutionen geschaffen und strenge Regelungen zur Kontrolle der Industrieemissionen implementiert.
Welchen Einfluss hat die Umweltpolitik auf den Lebensstil in Japan?
Die Politik beeinflusst soziale Werte und führt zur Entstehung neuer, umweltbewussterer Lebensstile unter den Bürgern.
Was versprach Premierminister Ikeda Hayato im Jahr 1960?
Er versprach das nationale Einkommen innerhalb einer Dekade zu verdoppeln, was zwar gelang, aber einen hohen ökologischen Preis forderte.
- Quote paper
- Slavomir Zidarov (Author), 2008, Japans Umweltpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/162358