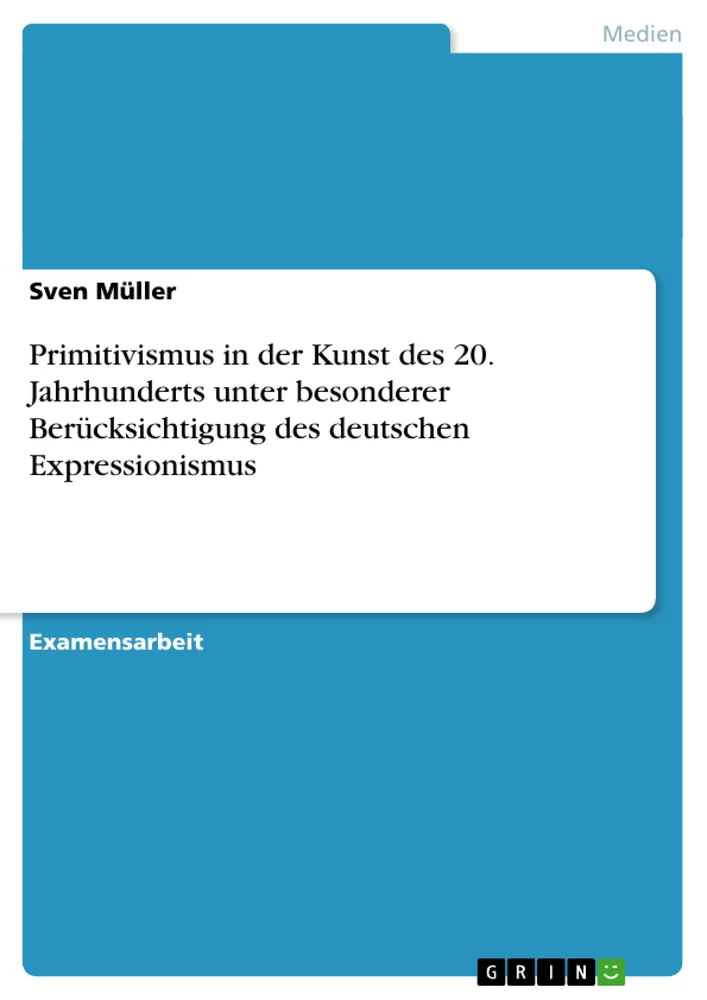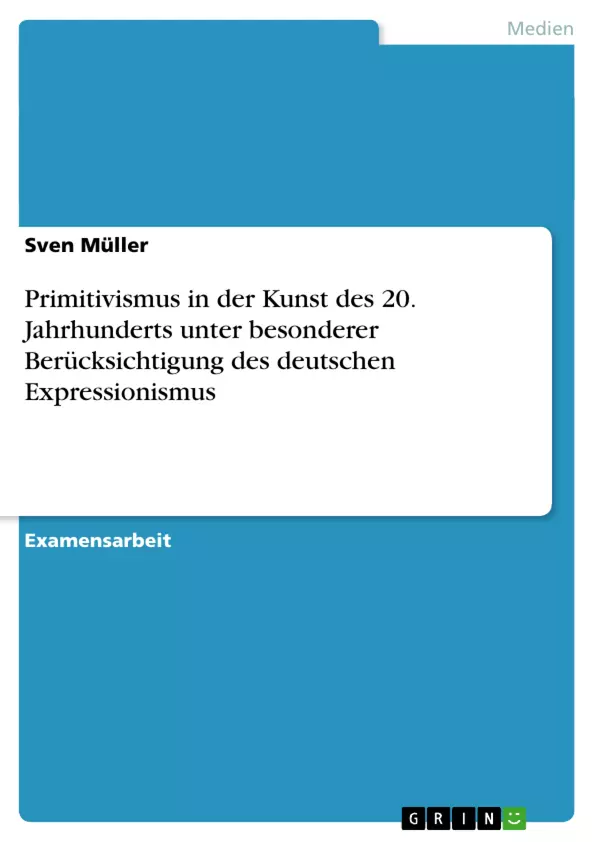Der kunsthistorische Terminus „Primitivismus“ bezeichnet „die Aufnahme sog. primitiver Kulturen in der Moderne“ als Rezeption und Imitation. Der Begriff in seiner heutigen Verwendung bezieht sich vor allem auf den bewussten „Zugriff auf Formen, Inhalte, Materialien und Techniken der Kunst vormoderner Völker in Malerei und Skulptur durch die klassischen Avantgarden zwischen 1890 und 1940“. Die Idee dahinter kann mit dem Versuch beschrieben werden, sich bestimmter Werte des Ursprünglichen, Elementaren oder kraftvoll Vitalen zu versichern, und sich damit vom bestehenden Zustand in Kultur, Kunst und Gesellschaft abzugrenzen.
Seine Bedeutung für die Moderne bezeichnet William Rubin als eines der Schlüsselthemen der Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Begriff bezieht sich dabei vorrangig auf die Rezeption der „sog. Negerkunst (art nègre) Afrikas und Ozeaniens“, die Anfang des 20. Jahrhunderts zum gängigen Synonym primitiver Kunst wurde und moderne Richtungen wie den Fauvismus, Kubismus und Expressionismus nachhaltig beeinflusste.
Die vorliegende Arbeit versucht, ausgehend von den Vorbedingungen, die Entwicklung des künstlerischen „Primitivismus“ im Deutschen Expressionismus aufzuzeigen. Hierbei soll zuerst die Frage beantwortet werden, wie und auf welchem Wege Künstler mit außereuropäischer Kunst in Berührung kamen.
Dabei wird Interesse an sogenannter „primitiver“ Kunst aber auch an ihren Trägern, den Menschen anderer Kulturen, beleuchtet. Die Entstehung der völkerkundlichen Museen und ihren Lehrmeinungen spielt dabei ebenfalls eine Rolle, die die künstlerische Avantgarde auf der einen Seite anregte, aber auch Rezeptionsmuster vorgab.
Der Wunsch neuen Idealen zu folgen und die akademischen Schranken zu durchbrechen fand im deutschen Expressionismus einen Höhepunkt der klassischen Moderne. Vor allem die Künstlergruppe „Die Brücke“ in Dresden beschritt dabei neue Wege. Exemplarisch soll das plastische Werk Ernst Ludwig Kirchners für die Übernahme außereuropäischer Elemente betrachtet werden. Daneben stehen vor allem Emil Nolde und Max Pechstein im Blickpunkt, die beide den Schritt wagten, ihrem Traum bis in die Südsee zu folgen und sich radikal vom Althergebrachten und von der bürgerlichen Gesellschaft abzusetzen um neue Perspektiven zu eröffnen.
In der Schlussbetrachtung muss auch noch ein Blick auf die Diskussion um den Begriff des „Primitivismus“ selbst geworfen werden, da seine Entstehung nicht ohne Kontroversen gesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorbedingungen des modernen „Primitivismus“
- 2.1. „Die Expansion des Abendlandes“
- Exkurs: Entstehung einer Wissenschaft, vom Kuriositätenkabinett zur Ethnologie
- 2.2. Ordnung der Dinge Von Evolutionismus und Kulturkreisen
- 2.3. Ethnologie Die Entstehung einer Wissenschaft
- 3. „Primitiv“ und „Primitivismus“ in der Kunstgeschichte
- 3.1 Paul Gauguin
- 3.2. Der Fauvismus
- 3.3 Die „Entdeckung“ der Stammeskunst
- 4. „Primitivismus“ im deutschen Expressionismus
- 4.1. Expressionismus
- 4.2. Künstlergruppen im deutschen Expressionismus
- 4.2.1. Der Blaue Reiter
- 4.2.2. „Die Brücke“
- 4.3. „Primitivismus“ in der "Brücke"
- 4.3.1. Palau-Hausbalken und Afrikanische Impulse
- 4.4. Ernst Ludwig Kirchner
- 4.4.1. Kurzbiografie
- 4.4.2. „Primitivismus“ bei Kirchner
- Exkurs: Atelierprimitivismus
- 4.5. „Die Brücke“ in der Südsee
- 4.6. Emil Nolde
- 4.6.1. Kurzbiografie
- 4.6.2. „Primitivismus“ bei Nolde
- 4.6.2. Noldes Reise in die Südsee
- 4.7. Hermann Max Pechstein
- 4.7.1. Kurzbiografie
- 4.7.2. „Primitivismus“ bei Pechstein
- 5. Begriffskritik und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Entwicklung des künstlerischen „Primitivismus“ im deutschen Expressionismus. Sie beleuchtet die Vorbedingungen, die zur Auseinandersetzung mit außereuropäischer Kunst führten, die Rezeption der Kunst von Paul Gauguin und den Fauvisten sowie den Einfluss afrikanischer und ozeanischer Kunst auf die Künstlergruppe „Die Brücke“. Insbesondere wird die Bedeutung des „Primitivismus“ für die Werke von Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde und Hermann Max Pechstein analysiert. Die Arbeit endet mit einer kritischen Betrachtung des Begriffs „Primitivismus“ selbst und seinen problematischen Konnotationen.- Die Entstehung des Interesses an außereuropäischer Kunst im 19. Jahrhundert
- Der Einfluss der Ethnologie und der Kulturkreislehre auf die Kunst der Moderne
- Die Rolle von Paul Gauguin und dem Fauvismus in der Entwicklung des „Primitivismus“
- Die Rezeption afrikanischer und ozeanischer Kunst im deutschen Expressionismus
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff „Primitivismus“
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt den Begriff „Primitivismus“ in der Kunstgeschichte ein und beschreibt seine Bedeutung für die klassische Moderne. Sie stellt die Thematik der Arbeit vor und umreißt den Forschungsgegenstand, den Einfluss von außereuropäischer Kunst auf den deutschen Expressionismus.Kapitel 2: Vorbedingungen des modernen „Primitivismus“
Dieses Kapitel beleuchtet die Vorbedingungen, die zur Auseinandersetzung mit dem „Primitiven“ in der Kunst führten. Es thematisiert die Expansion des Abendlandes und die Entstehung der Ethnologie als Wissenschaft. Weiterhin werden die dominierenden Ordnungsmodelle der frühen Ethnologie, der Evolutionismus und die Kulturkreislehre, in ihren Auswirkungen auf die Wahrnehmung außereuropäischer Kulturen analysiert.Kapitel 3: „Primitiv“ und „Primitivismus“ in der Kunstgeschichte
Dieses Kapitel stellt die historischen Wurzeln des Begriffs „Primitiv“ in der Kunstgeschichte dar. Es geht auf die Verwendung des Begriffs bei der Beurteilung der Kunst des Mittelalters und die spätere Erweiterung auf außereuropäische Kulturen ein. Der Abschnitt beleuchtet die negative Wertung der Stammeskunst im 19. Jahrhundert und die Entstehung des Begriffs „Primitivismus“. Zudem wird die Rolle von Paul Gauguin und dem Fauvismus, die in ihrer Kunst außereuropäische Einflüsse aufgriffen, beschrieben.Kapitel 4: „Primitivismus“ im deutschen Expressionismus
Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung des „Primitivismus“ im deutschen Expressionismus. Es beschreibt die Künstlergruppen „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ und ihre Auseinandersetzung mit außereuropäischer Kunst. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Einflusses afrikanischer und ozeanischer Kunst auf die Werke von Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde und Hermann Max Pechstein.Kapitel 5: Begriffskritik und Schluss
Das letzte Kapitel beleuchtet die problematische Konnotation des Begriffs „Primitivismus“ und dessen Ambivalenz. Es werden die historischen und aktuellen Debatten um die Wertung außereuropäischer Kunst und die Notwendigkeit einer neuen Sichtweise auf die Interaktion zwischen Kulturen diskutiert.Schlüsselwörter
Primitivismus, Expressionismus, Die Brücke, Der Blaue Reiter, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Hermann Max Pechstein, afrikanische Kunst, ozeanische Kunst, Stammeskunst, Ethnologie, Kulturkreislehre, Evolutionismus, Kolonialismus, Moderne.- Arbeit zitieren
- Sven Müller (Autor:in), 2010, Primitivismus in der Kunst des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Expressionismus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/161631