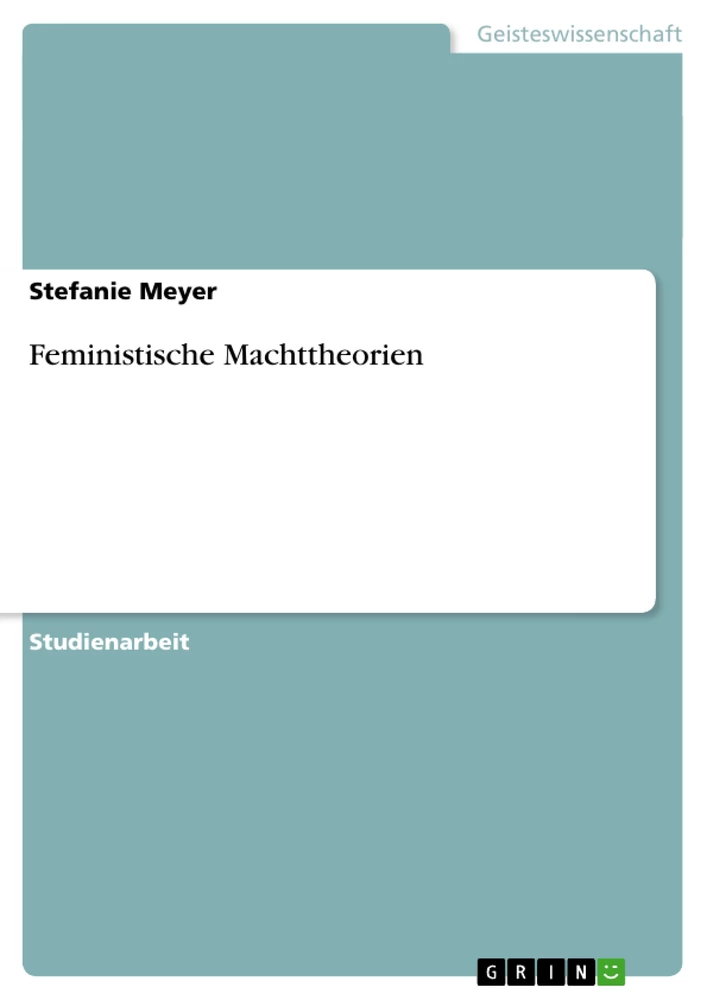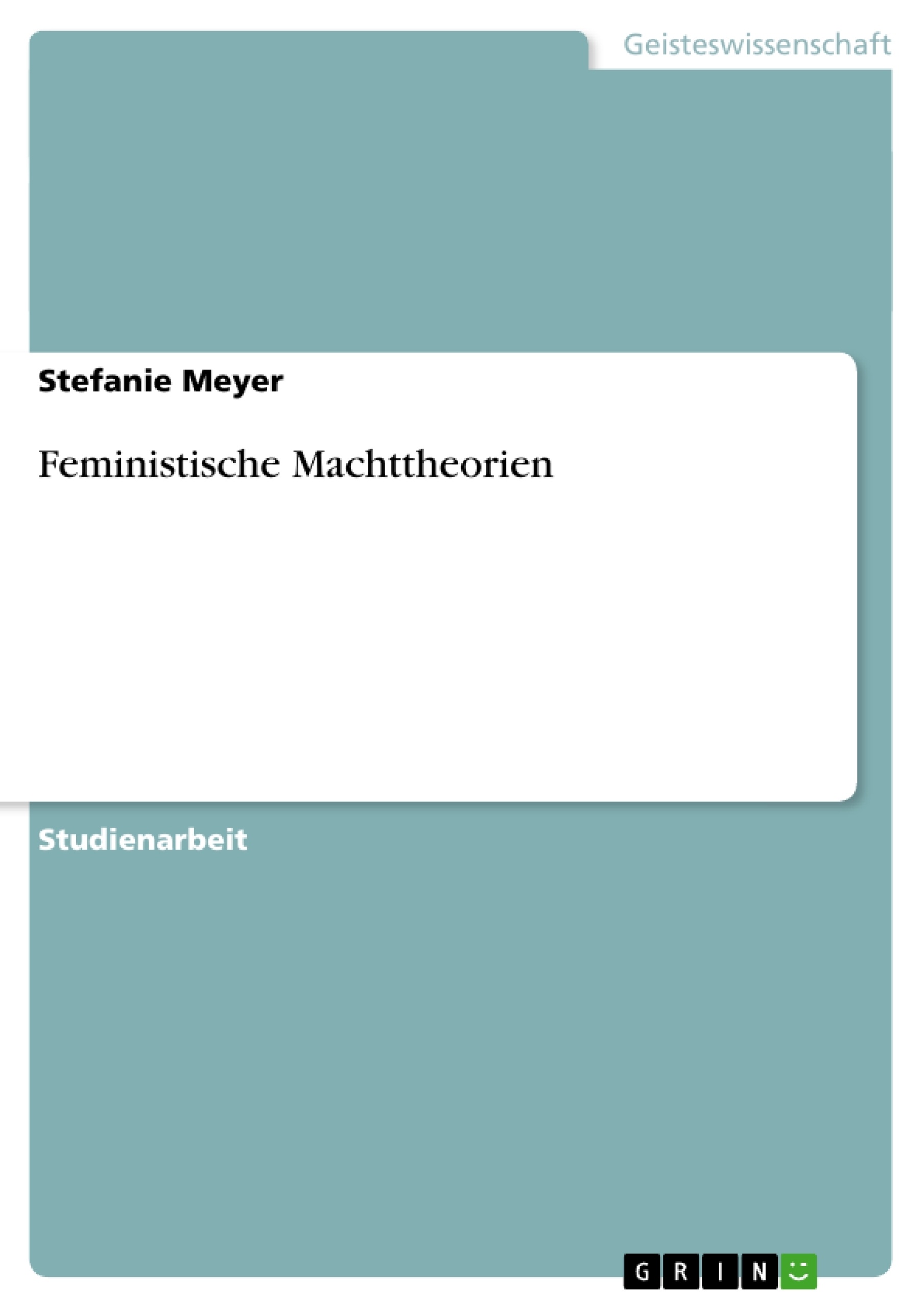Feministische Machttheorien haben ihren Ursprung in der Frauenforschung, die sich seit dem Ende der sechziger Jahren mit Fragen beschäftigt wie:
- welche empirischen Befunde weisen Geschlechterdifferenzen in sozialem Verhalten, Dispositionen oder Einstellungen nach?
- wenn es sie denn gibt, worauf sind sie zurückzuführen?
- haben Faktoren, wie geschlechtsspezifische Erziehung, Verinnerlichung von gesellschaftlichen Weiblichkeits- oder Männlichkeitsklischees oder sexuierte Praxen darauf einen Einfluß?
Verschiedene Ansätze feministischer Machttheorien griffen diese Fragen auf und untersuchten z.B., ob die Behauptung der Sozialforschung, dass sich männliche Verhaltensweisen von denen der Frauen unterscheiden einer empirischen Untersuchung standhalten würde, oder z.B. inwieweit alltagsweltliche Vorurteile in soziologische Hypothesen unüberprüft einfließen.
Auch wenn die Gewichtung der feministischen Theorien sehr unterschiedlich ist, gibt es doch einen Konsens, nämlich die Ablehnung der Naturalisierung von Geschlechterdifferenzen, d.h. nicht das Geschlecht mit dem wir geboren werden bestimmt unser Schicksal, sondern es sind die Erziehung und die kulturelle Einflußnahme durch die Frauen ihre Positionierung in der Gesellschaft erfahren.
In fast allen Gesellschaften ist das Geschlechterverhältnis von der Dominanz der Männer geprägt. Diese Dominanz führte dazu, dass Frauen von gesellschaftlicher Macht und öffentlicher Entscheidungsbefugnis ausgeschlossen wurden.
Immer wieder gab es Forscher wie Talcott Parson, der in den USA die Rollentheorie entwickelte, die besagt, dass der Mensch als soziales Wesen Normen und Regeln verinnerlicht, die an spezifische gesellschaftliche Funktionen geknüpft sind und somit eine Zweckmäßigkeit erfüllen. Für die Feministinnen stellte sich hier die Frage, ob eine solche Zwangsverpflichtung mit den Bedürfnissen von Menschen übereinstimmen kann, insbesondere da Frauen immer eingeschränkte und einseitige Rollen zugeschrieben und somit die Geschlechterhierarchie aufrecht erhalten wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Ausgangspunkt, verschiedene Theorien
- Die Basis moderner feministischer Ideologie
- Die Grundlagen des konstruktivistischen Ansatzes
- Die konstruktivistische Bewegung in Deutschland
- Die Kritik an der Geschlechterdifferenz
- Von der Konstruktion zur Dekonstruktion
- Judith Butler's postmoderne feministische Theorie
- Die heterosexuelle Normierung des Begehrens
- Die sprachlich-diskursive Konstruktion von Sex und Gender
- Donna Haraway's naturwissenschaftlicher Ansatz
- Die Kritik der Technosiences
- >Differenzen<< - noch eine andere Sichtweise
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung moderner feministischer Theorien und analysiert die unterschiedlichen Perspektiven auf die Unterscheidung von Sex und Gender. Dabei werden insbesondere die ethnomethodologisch-sozialkonstruktivistische Theorie, die postmoderne feministische Theorie nach Judith Butler und der naturwissenschaftliche Ansatz nach Donna Haraway beleuchtet.
- Kritik an der Naturalisierung von Geschlechterdifferenzen
- Die Rolle von Kultur und Gesellschaft in der Konstruktion von Geschlecht
- Die Bedeutung von Sprache und Diskurs in der Geschlechterdebatte
- Die Kritik an der Technowissenschaft und ihre Auswirkungen auf die Geschlechterordnung
- Die "Differenzen"-Debatte in der feministischen Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der feministischen Machttheorien und stellt die Frage nach den Ursachen von Geschlechterdifferenzen in den Mittelpunkt. Sie beleuchtet die Kritik an traditionellen Rollenbildern und der Ungleichheit von Frauen in der Gesellschaft.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Basis moderner feministischer Ideologie. Es stellt den konstruktivistischen Ansatz und seine Kritik an der Geschlechterdifferenz vor. Hier wird betont, dass das biologische Geschlecht (Sex) nicht determinierend für die soziale Konstruktion von Geschlecht (Gender) ist.
Das dritte Kapitel widmet sich Judith Butlers postmoderner feministischer Theorie. Es untersucht die sprachlich-diskursive Konstruktion von Sex und Gender und die heterosexuelle Normierung des Begehrens.
Kapitel 4 stellt Donna Haraways naturwissenschaftlichen Ansatz vor und kritisiert die Technowissenschaften, die zur Verfestigung von Geschlechterhierarchien beitragen.
Schlüsselwörter
Geschlechterdifferenz, Sex, Gender, Konstruktionismus, Postmoderne, Feminismus, Technowissenschaft, Differenzen, Ethnomethodologie, Judith Butler, Donna Haraway
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Sex und Gender?
In feministischen Theorien bezeichnet "Sex" das biologische Geschlecht, während "Gender" die soziale und kulturelle Konstruktion von Geschlechterrollen beschreibt.
Was besagt Judith Butlers Theorie zur Dekonstruktion?
Butler argumentiert, dass Geschlecht keine feste Identität ist, sondern durch performative Akte und sprachliche Diskurse erst geschaffen und aufrechterhalten wird.
Warum lehnen Feministinnen die Naturalisierung von Differenzen ab?
Die Naturalisierung dient oft dazu, soziale Ungleichheiten und männliche Dominanz als "naturbedingt" und damit unveränderbar zu rechtfertigen.
Welchen Ansatz verfolgt Donna Haraway?
Haraway nutzt einen naturwissenschaftlichen Ansatz und kritisiert Technowissenschaften, die traditionelle Geschlechterhierarchien verfestigen, während sie gleichzeitig Potentiale für neue Identitäten sieht.
Was ist der konstruktivistische Ansatz in der Frauenforschung?
Er besagt, dass Geschlechterrollen das Ergebnis von Erziehung, kultureller Einflussnahme und sozialen Praktiken sind, nicht von biologischen Vorgaben.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Meyer (Autor:in), 1999, Feministische Machttheorien, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/16162