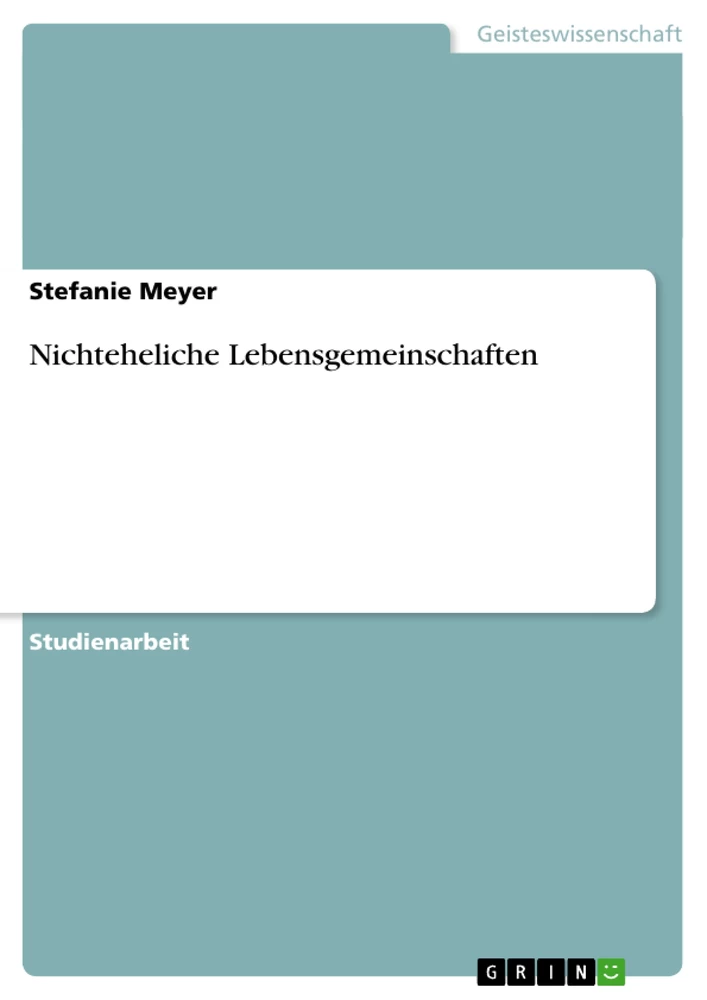Die Nichteheliche Lebensgemeinschaft war damals als Alternative zu den Frühehen der 60er Jahre gedacht, man wollte verhindern, dass die Jugend heiratet nur um das Elternhaus zu verlassen. Doch wer hätte gedacht, dass die nichtehelichen Lebensgemeinschaften einen so großen Anklang finden, dass selbst die "Wissenschaftler" sich ernsthaft Gedanken machen, ob die Institution Ehe gefährdet ist. Die umfangreiche Literatur zeigt, dass es ein Thema ist, über das man diskutieren kann und vielleicht sogar auch muß. Schon der Begriff nichteheliche Lebensgemeinschaft regt zum Denken an, denn was genau versteht man darunter?
Unter diesen Begriff fallen alle Formen von Lebensgemeinschaften: gleichgeschlechtliche Paare, Wohngemeinschaften, eheähnliche Gemeinschaften, getrenntlebende Paare, u.v.m. An diesen Beispielen sieht man, dass die nichtehelichen Lebensgemeinschaften ein großes Spektrum abstecken.
Dieser Text beschränkt sich auf "eheähnliche" Lebensformen. Für eheähnliche Lebensgemeinschaften gibt es verschiedene Definitionen, doch die aussagekräftigste ist die Definition von Max Wingen (1984) : "Grundsätzlich geht es um auf eine gewisse Dauer angelegte Verbindung eines verschiedengeschlechtlichen Paares, das in einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft (Haushalt) in umfassender Lebens- und Geschlechtsgemeinschaft zusammenlebt,ohne dass die Beziehung durch eine Eheschließung offiziell bestätigt (legitimiert) ist."
Auf das Ausland wird nicht gesondert eingegangen, genauso wie auf die DDR. Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften werden nur anhand von Deutschland behandelt. Zuerst wird die Geschichte der nichtehelichen Lebensgemeinschaften behandelt, und zwar speziell das 18. -19. Jahrhundert und ab den 60er Jahren bis heute. Danach werden die Strukturen der nichtehelichen Lebensgemeinschaften aufgezeigt, und die Frage behandelt, ob es sich bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften um eine Form der Probeehe handelt oder um eine Alternative zur Ehe. Am Schluß werden alle Ergebnisse nochmals kurz zusammengefasst dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichtliche Einordnung
- 2.1 18. - 19. Jahrhundert
- 2.2 60er Jahre bis jetzt
- 3. Strukturen nichtehelicher Lebensgemeinschaften
- 3.1 Alter
- 3.2 Schicht
- 3.3 Konfession
- 3.4 Stadt- Land
- 3.5 Nord-Süd
- 3.6 Kinder in nichtehelichen Lebensgemeinschaften
- 4. Alternative oder Probeehe?
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht nichteheliche Lebensgemeinschaften in Deutschland, ihre historische Entwicklung und soziale Strukturen. Sie beleuchtet die Frage nach ihrer Rolle als Alternative oder Probeehe zur traditionellen Ehe.
- Historische Entwicklung nichtehelicher Lebensgemeinschaften
- Soziale Strukturen und Merkmale nichtehelicher Lebensgemeinschaften
- Vergleich nichtehelicher Lebensgemeinschaften mit der Ehe
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz nichtehelicher Lebensgemeinschaften
- Definition und Abgrenzung nichtehelicher Lebensgemeinschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der nichtehelichen Lebensgemeinschaften ein und beschreibt den Umfang der Arbeit. Sie stellt die Frage nach der Definition des Begriffs und der Relevanz des Themas in Bezug auf die Institution der Ehe. Der Fokus liegt auf „eheähnlichen“ Lebensformen, wobei ausländische Beispiele und die Situation in der DDR ausgeklammert werden. Die Arbeit gliedert sich in historische Einordnung, strukturelle Analyse und die Diskussion der Rolle nichtehelicher Lebensgemeinschaften als Alternative oder Probeehe.
2. Geschichtliche Einordnung: Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, zunächst im 18. und 19. Jahrhundert, und anschließend ab den 1960er Jahren. Im 18. und 19. Jahrhundert wird der Kontrast zwischen der repressiven Sexualmoral der breiten Bevölkerung und der liberaleren Haltung des Adels und des aufstrebenden Bürgertums herausgearbeitet. Die unterschiedlichen Ehe- und Familienmodelle in verschiedenen sozialen Schichten werden beleuchtet, mit Fokus auf Adel, Bauern und Handwerker. Der Wandel vom traditionellen Familienmodell zum bürgerlichen Ideal wird beschrieben. Die Bedeutung ökonomischer Faktoren für die Heiratsentscheidungen wird betont.
Schlüsselwörter
Nichteheliche Lebensgemeinschaften, Ehe, historische Entwicklung, soziale Strukturen, Alternative, Probeehe, Sexualmoral, Familienmodell, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit nichtehelichen Lebensgemeinschaften in Deutschland. Er untersucht deren historische Entwicklung, soziale Strukturen und die Rolle als mögliche Alternative oder Probeehe zur traditionellen Ehe.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: die historische Entwicklung nichtehelicher Lebensgemeinschaften (18./19. Jahrhundert und ab den 1960er Jahren), soziale Strukturen (Alter, Schicht, Konfession, regionale Unterschiede, Kinder in nichtehelichen Lebensgemeinschaften), einen Vergleich mit der Ehe und die gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz dieser Lebensform. Der Fokus liegt auf „eheähnlichen“ Lebensformen in Deutschland; ausländische Beispiele und die Situation in der DDR werden nicht berücksichtigt.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel gegliedert: Einleitung, Geschichtliche Einordnung (18.-19. Jahrhundert und ab den 60er Jahren), Strukturen nichtehelicher Lebensgemeinschaften (nach Alter, Schicht, Konfession, Region und Kinder), Alternative oder Probeehe? und Zusammenfassung. Zusätzlich enthält er ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt des Textes?
Die zentrale Fragestellung ist die Rolle nichtehelicher Lebensgemeinschaften als Alternative oder Probeehe zur traditionellen Ehe. Der Text untersucht, ob und inwieweit diese Lebensform eine tatsächliche Alternative zur Ehe darstellt oder eher als eine Art „Probelauf“ vor der Ehe gesehen werden kann.
Welche Methoden werden im Text verwendet?
Der Text verwendet eine historisch-soziologische Analysemethode. Er untersucht die historische Entwicklung und die sozialen Strukturen nichtehelicher Lebensgemeinschaften, um deren Rolle im Kontext der traditionellen Ehe zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Nichteheliche Lebensgemeinschaften, Ehe, historische Entwicklung, soziale Strukturen, Alternative, Probeehe, Sexualmoral, Familienmodell, Deutschland.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Der Text betrachtet die Entwicklung nichtehelicher Lebensgemeinschaften im 18. und 19. Jahrhundert sowie ab den 1960er Jahren bis zur Gegenwart.
Wer ist die Zielgruppe des Textes?
Die Zielgruppe des Textes ist primär akademisch, da es sich um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema handelt. Der Text ist für Personen geeignet, die sich wissenschaftlich mit nichtehelichen Lebensgemeinschaften, der Geschichte der Familie und soziologischen Aspekten der Partnerschaft beschäftigen.
- Quote paper
- Stefanie Meyer (Author), 1999, Nichteheliche Lebensgemeinschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/16160