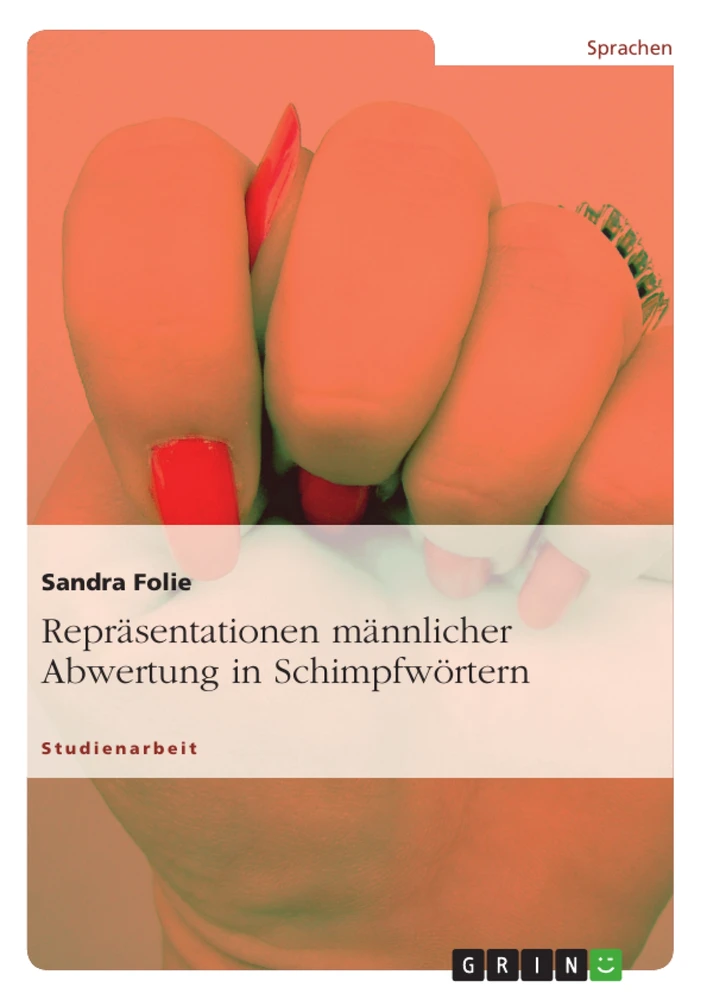Sprache ist, zumindest für den Großteil aller männlichen wie weiblichen Menschen, allgegenwärtig, immer da, sie steht ständig zur Verfügung, wenn man sie braucht; zwar womöglich nicht immer genau so wie gewollt, Versprecher, linguale Ausreißer etc. gehören dazu, aber sie ist doch konstant vorhanden, ohne dass lange gesucht werden müsste.
Was damit zum Ausdruck kommen soll ist, dass Sprache, obwohl sie gewissermaßen unser Denken ist und es in filtrierter Form auch wiedergibt, kein beliebter Gegenstand des Nachdenkens an sich ist. Sie wird zumeist als fertiges Objekt hingenommen, vergleichbar mit einem Stuhl oder Tisch, bei denen im Normalfall auch nicht lange nach der Herstellung gefragt wird, sondern die gefallen oder nicht, qualitativ hochwertig sind oder nicht etc. Ebenso gibt es innerhalb der Sprache schöne oder weniger schöne, prestigeträchtige oder weniger reputative Ausdrücke.
Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive bietet es sich an, genau dort anzusetzen und zwischen offensichtlichen sprachlichen Hierarchien, die im Allgemeinen ohne Probleme akzeptiert werden, und deren Ursprung bzw. Erfindung Bezüge herzustellen. Aus feministisch bzw. postfeministisch linguistischer Perspektive können und müssen diese sprachlichen Hierarchien zusätzlich auf die Geschlechter und deren scheinbare Differenzen bezogen werden.
In dieser Arbeit hier greife ich auf die vorhin angesprochenen „Ausreißer“ oder „weniger schönen, reputativen Ausdrücke“ zurück, die, wie ich meine, angesichts ihres hohen emotio-nalen Authentizitätsgrades, da meist im Affekt geäußert, etwas mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Linguistik verdient hätten. Es stehen folglich Schimpfwörter, genauer gesagt solche für bzw. gegen Männer, im Mittelpunkt. Obgleich es vielleicht interessanter wäre, sich die Schimpfwortbesetzung beider Geschlechter anzusehen, und somit Symmetrien wie Asymmetrien aufzuzeigen, konzentriere ich mich hier ausschließlich auf Repräsentationen männlicher Abwertung. Einerseits aus dem einfachen Grund, dass alles weitere den Umfang einer Proseminararbeit sprengen würde, andererseits auch um auf kürzestem Weg einer klaren Linie folgen zu können, die letztendlich zu einem ähnlichen, wenn auch weniger detaillierten und differenzierten Ergebnis führt wie ein Vergleich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärungen
- 2.1. Repräsentationen von Abwertung
- 2.1.1. Was heißt „Schimpfen“?
- 2.1.2. Was sind Schimpfwörter?
- 2.1.3. Wer oder was wird beschimpft?
- 2.2. Das Geschlecht von Abwertungen
- 2.2.1. Die Doppelrolle der Sprache
- 2.2.2. Die Geschlechtscharaktere
- 2.2.3. Schlussfolgerung
- 3. Umfrage
- 3.1. Verwendung der einzelnen Lexeme
- 3.1.1. Vorkommen
- 3.1.2. Geschlechtsneutralisierung
- 3.1.3. Kontroverse Beispiele
- 3.2. Kategorisierung der Lexeme
- 3.2.1. Fäkalbereich/Ekel
- 3.2.2. Sexualität
- 3.2.3. Tiernamen
- 3.2.4. Geistige Mängel
- 3.3. Semanalyse
- 3.3.1. Definition, Sem'
- 3.3.2. Merkmalsmatrix
- 3.4. Wortfeldanalyse
- 3.4.1. Dummheit
- 3.4.2. Gemeinheit
- 3.4.3. Versagen/Unfähigkeit
- 3.4.4. Normabweichendes Sexualverhalten
- 3.4.5. Unsauberkeit
- 4. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Abwertung von Männern im Deutschen, indem sie Schimpfwörter und deren Verwendung analysiert. Das Hauptziel ist es, die Geschlechterdimension in der Verwendung abwertender Sprache zu beleuchten und die historischen Konstrukte von Geschlechtscharakteren zu untersuchen, die sich in der Sprache niederschlagen.
- Definition und Analyse von Schimpfwörtern im Kontext der männlichen Abwertung
- Untersuchung der Geschlechterrollen und -stereotypen in der Verwendung abwertender Sprache
- Empirische Analyse der Häufigkeit und des Vorkommens spezifischer Schimpfwörter
- Semantische und wortfeldanalytische Untersuchung der verwendeten Lexeme
- Beziehung zwischen sprachlicher Abwertung und historisch konstruierten Geschlechtscharakteren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Abwertung von Männern ein und begründet die Fokussierung auf Schimpfwörter als besonders aussagekräftige sprachliche Mittel. Sie erwähnt die Arbeit von Ingeborg Breiner als theoretischen Ausgangspunkt und skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit, der eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff „Schimpfen“ und eine empirische Umfrage umfasst, um das Schimpfwortverhalten zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Asymmetrien in der sprachlichen Abwertung zwischen den Geschlechtern.
2. Begriffsklärungen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit. Es definiert „Schimpfen“ und „Schimpfwörter“ anhand vorhandener Literatur und unterscheidet zwischen „Schimpfen“ und „Beschimpfen“. Die Autorin erläutert den ambivalenten Charakter abwertender Bezeichnungen und betont die Dynamik des Schimpfwortschatzes. Schließlich wird die Fokussierung auf die männliche Abwertung begründet und die methodische Herangehensweise erläutert.
3. Umfrage: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte empirische Untersuchung zum Schimpfwortverhalten gegenüber Männern. Es beinhaltet sowohl eine lexikalische Analyse der verwendeten Schimpfwörter (Vorkommen, Häufigkeit, Geschlechtsneutralisierung) als auch eine semantische und wortfeldanalytische Betrachtung. Die Analyse fokussiert auf die Lexeme mit der höchsten Aussagekraft innerhalb der Wortfelder, um die dominierenden Muster der männlichen Abwertung zu identifizieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachliche Abwertung von Männern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sprachliche Abwertung von Männern im Deutschen, konzentriert sich dabei auf Schimpfwörter und deren Verwendung. Sie untersucht die Geschlechterdimension in der Verwendung abwertender Sprache und die in der Sprache reflektierten historischen Konstrukte von Geschlechtscharakteren.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Geschlechterdimension in der Verwendung abwertender Sprache zu beleuchten. Sie untersucht die Definition und Analyse von Schimpfwörtern im Kontext der männlichen Abwertung, Geschlechterrollen und -stereotypen in der abwertenden Sprache, die Häufigkeit und das Vorkommen spezifischer Schimpfwörter, sowie deren semantische und wortfeldanalytische Untersuchung und den Zusammenhang zwischen sprachlicher Abwertung und historisch konstruierten Geschlechtscharakteren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist deren Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und beschreibt die Methodik. Kapitel 2 (Begriffsklärungen) definiert zentrale Begriffe wie „Schimpfen“ und „Schimpfwörter“. Kapitel 3 (Umfrage) präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Verwendung von Schimpfwörtern gegenüber Männern, inklusive lexikalischer, semantischer und wortfeldanalytischer Betrachtungen. Kapitel 4 (Conclusio) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Auseinandersetzung mit empirischer Forschung. Sie verwendet eine lexikalische Analyse der verwendeten Schimpfwörter (Vorkommen, Häufigkeit, Geschlechtsneutralisierung), semantische Analyse und Wortfeldanalyse. Die empirische Untersuchung basiert auf einer Umfrage zum Schimpfwortverhalten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und Analyse von Schimpfwörtern im Kontext der männlichen Abwertung, die Untersuchung der Geschlechterrollen und -stereotypen in der Verwendung abwertender Sprache, eine empirische Analyse der Häufigkeit und des Vorkommens spezifischer Schimpfwörter, die semantische und wortfeldanalytische Untersuchung der verwendeten Lexeme und die Beziehung zwischen sprachlicher Abwertung und historisch konstruierten Geschlechtscharakteren.
Welche Wortfelder werden in der Wortfeldanalyse untersucht?
Die Wortfeldanalyse untersucht die Lexeme innerhalb der Wortfelder Dummheit, Gemeinheit, Versagen/Unfähigkeit, Normabweichendes Sexualverhalten und Unsauberkeit.
Welche Kategorien von Schimpfwörtern werden betrachtet?
Die Arbeit kategorisiert Schimpfwörter nach den Bereichen Fäkalbereich/Ekel, Sexualität, Tiernamen und Geistige Mängel.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit erwähnt die Arbeit von Ingeborg Breiner als theoretischen Ausgangspunkt.
- Arbeit zitieren
- Sandra Folie (Autor:in), 2010, Repräsentationen männlicher Abwertung in Schimpfwörtern, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/161527