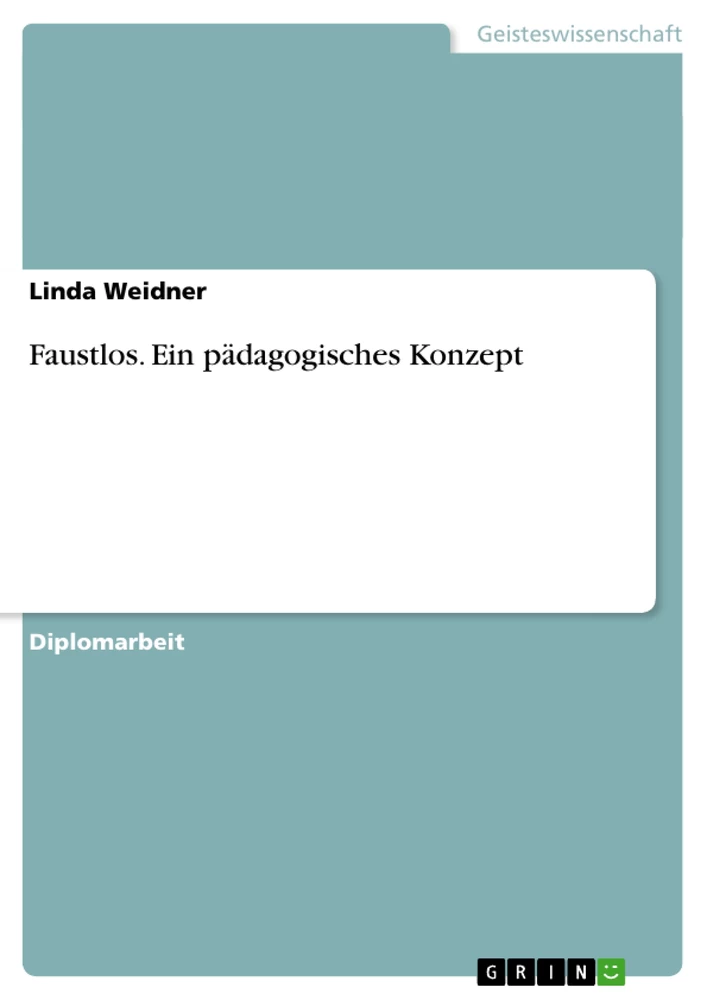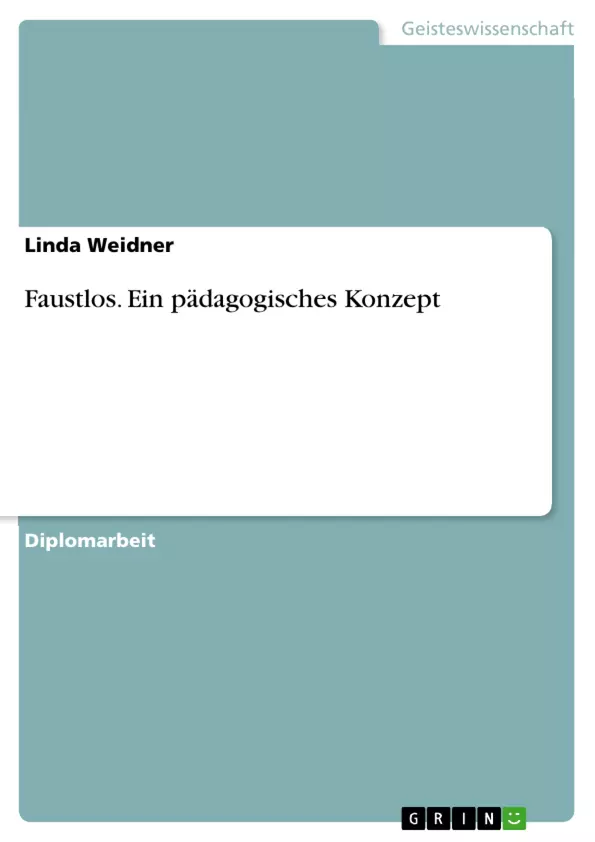„Eine gelungene Prävention erkennt man daran, dass man ihre Wirkung nicht mehr sieht. Wenn alles gewirkt hat, wie es sollte, dann hat niemand ein Problem gehabt, niemand etwas gemerkt. Sofort wird sich dann die Frage gestellt, wozu man denn diesen aufwändigen Kurs, dieses Training, diese Schulung, diese Supervision überhaupt
gebraucht hat – es gab doch gar kein Problem. Das ist natürlich falsch, aber es ist verständlich, denn das Leben hat keine Kontrollgruppe, leider. Wir sehen niemals, wie das Leben verlaufen wäre, wenn dieses oder jenes nicht so gewesen wäre, wie es eben tatsächlich war. Und so sehen wir insbesondere niemals, ob
die Vorbeugung, die wir uns geleistet haben, wirklich nötig war, weil wir nicht wissen, wie es ohne sie gekommen wäre.“ (Greve 2010, S. 9).
Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit bei Kindern und Jugendlichen sind weder neue noch besonders akute Themen, jedoch in ihrer Aktualität nicht weniger erheblich. Auch wenn die 2009 veröffentlichte Studie des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen seit 1998 tendenziell rückläufige Zahlen in der Kriminalstatistik verzeichnet, ist die fast 100%iger Zunahme von Gewalttaten bei 14-18 Jährigen von 1990 bis 1999 nicht zu vernachlässigen.
Die Verschärfung dieser Problematik und die sich abzeichnende Entwicklung verlangen zunehmend nach Lösungen. Im Zuge dessen wuchs die Anzahl der Interventions- und vor allem der Präventionsmaßnahmen, um dieser Entwicklung vorzubeugen.
Im Vergleich zu Interventionen sind präventive Konzepte sowohl langfristig erfolgreicher als auch deutlich kostengünstiger. Da an Kindergärten und Schulen aggressive und gewaltbereite Verhaltensweisen zum Dauerthema geworden sind, konzentrieren sich effektive Präventionsansätze, über die Unterstützung der Familien hinaus, auf die Entwicklungsbedingungen der Kinder in den außerfamiliären sozialen Beziehungen in Kindergärten und Schulen. Auch aus entwicklungspsychologischen und neurobiologischen Forschungsbefunden geht hervor, dass sich vorbeugende Maßnahmen auf die frühe Kindheit fokussieren sollten. Demnach bieten sich die Jahre im Vorschulalter besonders für primäre Präventionsmethoden an.
FAUSTLOS ist das einzige in Deutschland existierende Gewaltpräventionsprogramm, das für diese Altersgruppe entwickelt wurde. Vor diesem Hintergrund ergab sich das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit.
Intention ist es, unter Einbeziehung von Erzieherinnen, das Projekt FAUSTLOS an Kindergärten zu evaluieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Gewalt
- Begriffsklärung
- Klassische Ursachenmodelle von Gewalt
- Trieb- und Instinkttheorie
- Frustrations- und Aggressionshypothese
- Lerntheorie
- Kindheit und Gewalt
- Der familiäre Kontext für die Entstehung von aggressiven Verhaltensweisen
- Schule und Kindergarten als Kontext für aggressives Verhalten von Kindern
- Gewalt im gesellschaftlichen Kontext
- Gewaltprävention
- Begriffsklärung
- Möglichkeiten der Gewaltprävention bei Kindern
- Personenzentrierte Prävention
- Familienzentrierte Prävention
- Außerfamiliäre Präventionsansätze
- Stand der empirischen Forschung
- Familienbezogene Präventionsprogramme
- Programme der Frühprävention
- Elternprogramme
- Außerfamiliäre Präventionsprogramme
- Fragestellung der Untersuchung
- Beschreibung des Programms "FAUSTLOS"
- Qualitative Evaluation als methodischer Ansatz
- Grundprinzipien und Gütekriterien qualitativer Forschung
- Forschungsdesign
- Untersuchungsverfahren
- Fallbestimmung
- Erhebungsverfahren
- Aufbereitungsverfahren
- Auswertungsverfahren
- Darstellung der Ergebnisse
- Profile der Kindergärten
- Charakteristika der Zielgruppe
- Vergleichende thematische Auswertung der Einzelfalldarstellungen
- Gestaltung des FAUSTLOS-Unterrichtes
- Erfahrungen während der Umsetzung von FAUSTLOS
- Resonanz und Umgang der Kinder mit FAUSTLOS
- Altersbezogene Erfahrungen
- Geschlechtsbezogene Erfahrungen
- Einbindung der Eltern
- Kritik
- Wirksamkeit des Projektes
- Bilanzierung
- Evaluation des Projektes
- Theoretische Grundlagen der Gewaltprävention
- Empirische Forschung zu Gewaltpräventionsprogrammen
- Qualitative Analyse der Umsetzung von "FAUSTLOS" in Kindergärten
- Evaluation der Wirksamkeit von "FAUSTLOS" in Bezug auf die Reduktion von Gewalt und die Förderung von Sozialkompetenz
- Reflexion der Bedeutung von frühkindlicher Bildung für die Prävention von Gewalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit analysiert das pädagogische Konzept „FAUSTLOS“ mit dem Ziel, die Wirksamkeit des Programms in der Praxis zu evaluieren. Dabei werden sowohl die theoretischen Grundlagen des Konzepts als auch die praktischen Erfahrungen in der Umsetzung beleuchtet. Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die Bereiche Gewaltprävention, die Entwicklung von sozialen Kompetenzen und die Bedeutung der frühkindlichen Bildung im Kontext von Gewaltprävention.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über das Thema Gewalt und die Bedeutung der Gewaltprävention, insbesondere im Kontext der frühkindlichen Bildung. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem theoretischen Rahmen. Hier werden die wichtigsten Theorien zur Entstehung von Gewalt vorgestellt, wobei ein besonderer Fokus auf die Rolle der Kindheit gelegt wird. Es werden verschiedene Ursachenmodelle von Gewalt erläutert und die Bedeutung von Familienzentrierter und Außerfamiliärer Gewaltprävention hervorgehoben. In einem weiteren Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der empirischen Forschung zu Gewaltpräventionsprogrammen zusammengefasst. Die Arbeit geht dann auf die Fragestellung der Untersuchung ein und beschreibt das Programm "FAUSTLOS". Die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die qualitative Evaluation, wird im Detail erläutert. Die Darstellung der Ergebnisse ist dann der Kern der Arbeit. Hier werden die Profile der beteiligten Kindergärten, die Charakteristika der Zielgruppe sowie die Erfahrungen während der Umsetzung von "FAUSTLOS" beschrieben.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Frühkindliche Bildung, Sozialkompetenz, "FAUSTLOS", Qualitative Evaluation, Kindergarten, Kinderschutz, Aggression, Sozialisation, Familienbezogene Prävention, Außerfamiliäre Prävention, Bildungsforschung, Pädagogisches Konzept.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Programm „FAUSTLOS“?
FAUSTLOS ist ein Gewaltpräventionsprogramm für Kindergärten und Schulen, das darauf abzielt, soziale Kompetenzen zu fördern und aggressives Verhalten frühzeitig zu reduzieren.
Warum ist Gewaltprävention im Kindergarten so wichtig?
Neurobiologische und entwicklungspsychologische Befunde zeigen, dass Präventionsmaßnahmen in der frühen Kindheit am effektivsten sind, da sich hier grundlegende Verhaltensmuster festigen.
Welche klassischen Ursachenmodelle von Gewalt werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit erläutert die Trieb- und Instinkttheorie, die Frustrations-Aggressions-Hypothese sowie lerntheoretische Ansätze zur Entstehung von Gewalt.
Wie wurde die Wirksamkeit von FAUSTLOS evaluiert?
Die Arbeit nutzt einen qualitativen methodischen Ansatz, indem sie Erzieherinnen zu ihren Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung und zur Resonanz der Kinder befragt.
Welche Rolle spielen die Eltern bei FAUSTLOS?
Die Einbindung der Eltern ist ein wichtiger Aspekt des Programms, da Prävention über den Kindergarten hinaus auch im familiären Kontext unterstützt werden sollte.
Was sind die Ergebnisse der qualitativen Evaluation?
Die Arbeit zieht eine Bilanz zur Wirksamkeit, zum Umgang der Kinder mit den Inhalten und gibt Einblicke in geschlechts- und altersbezogene Erfahrungen während des Unterrichts.
- Quote paper
- Linda Weidner (Author), 2010, Faustlos. Ein pädagogisches Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/161335